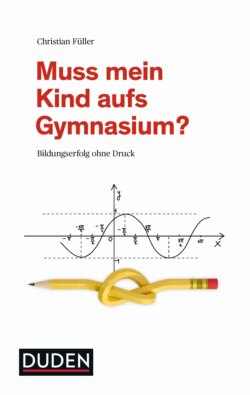Читать книгу Muss mein Kind aufs Gymnasium? - Christian Füller - Страница 7
Оглавление1 FLUCHT INS ABITUR
Auf einmal wurde dem Abitur der Prozess gemacht. Am Casimirianum, einem Gymnasium im bayerischen Coburg, hatte es 2013 eine regelrechte Flut von Einser-Abituren gegeben. Dreißig Schülerinnen und Schüler schlossen ihre Schullaufbahn mit einer Eins vor dem Komma ab, das war ein Drittel des Jahrgangs. Wenige Tage später trudelte eine Anzeige bei der bayerischen Polizei ein. »Wir haben das jetzt mal zur Überprüfung gegeben«, verrieten Lehrer des Gymnasiums, das 1605 von Herzog Johann Casimir von Sachsen-Coburg gegründet worden war.1
Der Schulleiter des heute humanistischen und neusprachlichen Gymnasiums, Burkhard Spachmann, hatte seinen Lehrern bei der Verkündung der Noten noch überschwänglich gedankt, dass sie die Abiturienten »auf die Erfolgsspur gesetzt« hätten. »Wir am Casimirianum stehen verlässlich für gymnasiale Bildung, die muss man sich allerdings erarbeiten.«2 Freilich kam dann bei einer Überprüfung heraus, dass der Rektor selbst nicht ganz unbeteiligt gewesen war. Er hatte die Abiturklausur in Deutsch nachkorrigiert – und um einen Punkt angehoben. Für alle Schüler. Er habe die Zensur heraufgesetzt, sagte Spachmann, um den Schülern »gerechtere Noten zu verschaffen«.3
Was lief da am Casimirianum?, fragten sich nicht nur die Coburger. Die getunten Noten sorgten weit über die Grenzen Bayerns hinaus für Schlagzeilen. Wollte sich das Gymnasium einen Vorsprung verschaffen? Wurden den Schülern die guten Noten nachgeworfen? Kollegen anderer Schulen sprachen von Wettbewerbsverzerrung. »Ein Rektor darf in solche Prozesse nicht eingreifen«, schimpfte der ehemalige Schulleiter des Nachbargymnasiums. Ein anderer sprach von »Manipulationen, die die Lehrer viel zu lange mitgemacht haben«.4
Die Notenkosmetik beschäftigte von da an fast fünf Jahre lang die Gerichte. In zwei Instanzen wurde Rektor Spachmann für die kreative Nachkorrektur zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Nachdem er in dritter Instanz freigesprochen worden war, musste sich Spachmann schließlich noch einem Disziplinarverfahren stellen, wo es um seine mögliche Absetzung ging. Der Schulleiter bekam das schärfste Schwert des Beamtenrechts gezeigt. Und das alles nur, weil er seinen Schülern einen einzigen Punkt Aufschlag gegeben hatte – bei insgesamt 900 Punkten, die Schüler im Abitur erringen können. Er wurde nicht entlassen, aber es wurde alles unternommen, um den Rektor zur Rechenschaft zu ziehen.
Der Fall am Casimirianum zeigt wie in einem Brennglas das Drama von Abiturboom, Aufstieg durch Bildung und neuen Konkurrenzen. Seit einigen Jahren steigt die Zahl der Abiturienten steil an. Die Deutschen haben mit dem Ausbau ihres wichtigsten Abschlusses für mehr Chancengleichheit gesorgt – und zugleich das Bildungssystem aus der Balance gebracht.
Im Jahr 2001 hatte der Pisa-Schock der Nation vor Augen geführt, wie finster es vor allem in den unteren Schulformen aussieht. Seitdem versuchen immer mehr Eltern, ihre Kinder aufs Gymnasium zu hieven.
Abi-Boom und Bildungssystem
Der Abiturboom wird die individuellen Bildungsbiografien von Hunderttausenden auf Touren bringen. Es geht aber nicht nur um neue Aufstiegsmöglichkeiten. Wenn sich die Gewichte zwischen Gymnasium und beruflicher Ausbildung so grundlegend verschieben, wie das im Moment geschieht, dann hat das Auswirkungen auf das gesamte Bildungssystem. Schaffen in Staaten wie Finnland oder Korea 70 Prozent eines Jahrgangs die Hochschulreife, dann ist das kaum ein Problem. Neben der Hochschule kennt man dort nämlich keine mit dem deutschen System vergleichbar hoch organisierte Berufsausbildung. Fast alle anderen Staaten vermitteln berufliche Fertigkeiten in einem maximal mehrwöchigen »training on the job«. Hierzulande ist das anders. Da werden Jugendliche in zwei- bis dreijährigen Lehrgängen ausgebildet. Das heißt, das Abitur war in Deutschland von jeher hoch angesehen, doch es war letztlich nur ein Weg zu beruflicher Anerkennung, zu Erfolg und Status. Auch die Lehre und der mit ihr verbundene Aufstieg zu Facharbeiter oder gar Meister stellen einen gesellschaftlichen Wert dar. Dieses Karrieremodell ändert sich gerade, weil das Abitur so stark in den Vordergrund drängt. »Die Betriebe suchen händeringend Lehrlinge – aber die Kandidaten hocken alle in den Gymnasien und Fachhochschulen rum.«5 So beschreibt die Schülerberaterin einer süddeutschen Arbeitsagentur die Lage.
Was also macht der Boom der Abiturienten mit dem deutschen Bildungssystem?
Die Einser-Blüte in Coburg ist kein Einzelfall. Seit 2006 gibt es in ganz Deutschland eine regelrechte Einser-Schwemme. Die Zahl der 1,0-Abiture ist um 40 Prozent angestiegen – eine Entwicklung, die längst nicht jedem gefällt. »Zeugnisse dürfen nicht zu ungedeckten Schecks werden«, warnte etwa der ehemalige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus. »Anspruchsvollere Bundesländer sollten die Abiturzeugnisse anspruchsloser Bundesländer nicht mehr anerkennen.«6 Ähnlich wie Kraus denken viele. Das ganze Schulsystem komme auf den Hund, hört man nicht selten, wenn man jedem Dahergelaufenen das Abitur hinterherschmeiße. Die Ehrfurcht vor der 1,0 ist dem Spott über praxisferne Eierköpfe und ihre Billigzertifikate gewichen.
Es klingt nach Untergang und Sintflut, wenn man die Klagen über die Einser-Abiture hört. Aber ist der Anstieg der Superzensuren wirklich so ungewöhnlich? Immerhin ist auch die Zahl der Abiturienten insgesamt in den zehn Jahren nach dem ersten Pisa-Test um 47 Prozent angestiegen. Insofern wäre es wohl eher eine Überraschung, wenn nicht auch die Zahl der guten Noten angewachsen wäre. Ein Blick auf die Durchschnittsnote bestätigt das: Zwischen den Jahren 2006 und 2016 hat sich der Notendurchschnitt der deutschen Abiturienten von 2,51 auf 2,40 verbessert. Das klingt nicht nach Einser-Inflation, sondern irgendwie nach Stabilität.
Aber der Schein trügt. Das Bildungssystem ist in Bewegung, und es sind die Eltern, die das spüren und zugleich weiter antreiben.
Nach der ersten Pisa-Studie (sie heißt offiziell »Pisa 2000«) monierten die internationalen Tester stets zwei Fehlleistungen des deutschen Bildungssystems: Es gebe, erstens, zu viele Risikoschüler und, zweitens, zu wenig Abiturienten. Beide Problemkinder haben sich seitdem stark verbessert. Die Zahl der Risikoschüler (also derer, die das, was sie lesen, weder verstehen noch interpretieren können) ist gesunken – von knapp 24 Prozent auf 16 Prozent im Jahr 2015. Die Zahl der Abiturienten wiederum ist gleichzeitig sprunghaft angestiegen – in den zehn Jahren nach Pisa von 343 000 erfolgreichen Abiturienten auf eine halbe Million. Diese Entwicklung ist allerdings nicht der Weisheit der Schulminister geschuldet.
Die im amtlichen Jargon »Kultusminister« genannten politischen Verantwortlichen hatten noch in der Nacht vor der Veröffentlichung der ersten Pisa-Studie sieben aus ihrer Sicht vordringliche Problemzonen im Bildungssystem definiert. So schnell hat die »Ständige Konferenz der Kultusminister« (KMK) noch nie Beschlüsse gefasst. Dazu zählten die Verbesserung der Kindergärten und Grundschulen, die Unterstützung von Migranten, der Ausbau des Ganztagsunterrichts, Programme für besseren Unterricht und die Förderung von Lehrern.
Wir sehen: Alle brennenden Themen, die seitdem die Lehrer und Schulen an den Rand des Kollapses gedrängt haben, standen nicht in diesem Maßnahmenkatalog: Die Verkürzung des Abiturs auf acht Jahre – kein Thema. Die bevorstehende Explosion der Abiturientenzahlen – mit keinem Wort erwähnt. Der inzwischen eingetretene historische Lehrermangel – von den Kultusministern glatt übersehen.
Auch das Folgende wurde nicht thematisiert, im Gegenteil, die Kultusminister versprachen sogar, diesen alten Streitpunkt auf keinen Fall aufwärmen zu wollen: die frühe Aufteilung der Schüler nach der Grundschule auf drei konkurrierende Schulformen. Das bedeutet, die Öffnung der Wege zum Abitur hatte ausdrücklich keine Priorität.
Dennoch setzte nach Pisa ein beinahe unheimlicher Zuwachs der Abiturzahlen ein. Wie war das möglich? Wenn man so will, haben die Eltern und ein bayerischer Ministerpräsident dem Schulsystem Beine gemacht.
Den ersten Teil des Abi-Booms hat Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber bewirkt, indem er 2003 geradezu überfallartig eine Verkürzung der Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre verkündete. Fast alle Bundesländer zogen nach. Doch nicht allein Bayerns Ministerpräsident half, die magere Abiturquote des Exportweltmeisters anzuheben. Es waren auch die Eltern, die nach dem Pisa-Schock alle Anstrengungen unternahmen, um die Bildung – und damit die Abschlüsse – ihrer Kinder aufzumöbeln. Unter Eltern herrscht inzwischen eine »Fokussierung auf das Abitur als alleinigem Bildungsmaßstab«.7 Bildungsbürgerliche Eltern achteten von jeher darauf, dass ihre Kinder die Hochschulreife erlangen. Nach Pisa übernahmen sukzessive auch andere Elternmilieus diesen Anspruch. Sie schöpften alle Möglichkeiten aus, um ihren Nachwuchs auf höhere Schulen zu lotsen.
Diese Entwicklung lässt sich besonders gut erkennen, wenn man die Ergebnisse der aufeinanderfolgenden Tests »Pisa 2000« und »Pisa 2003« vergleicht. Die Zahl der guten Schüler stieg bei »Pisa 2003« an, aber am Fuß der Bildungspyramide tat sich erst mal nicht viel. In Brandenburg zum Beispiel führte das zu einem paradoxen Effekt: Das Bundesland war bei »Pisa 2000« noch die gerechteste unter den deutschen Provinzen gewesen – das bedeutet, die Leistungen von Schülern aus reichen und von solchen aus armen Familien unterschieden sich im bundesweiten Vergleich am wenigsten. Bereits in der Folgestudie gehörten Brandenburgs Schulen plötzlich zu den ungerechtesten. Wie das? Die Lernergebnisse der Schüler an Gymnasien hatten sich extrem stark verbessert, die Zuwächse bei den anderen Schulen hingegen praktisch nicht. So öffnete sich die Schere zwischen den Edelgymnasien in wohlhabenden Orten wie Potsdam, Kleinmachnow und Falkensee einerseits und den Arme-Leute-Schulen in der Uckermark oder den Plattenbausiedlungen in Frankfurt /Oder andererseits. Kurz: Das Bürgertum war die erste soziale Gruppe, die ihre Lektion aus Pisa gelernt hatte.
IST DIE PRIVATSCHULE EINE GUTE ALTERNATIVE?
Der Boom der Privatschulen ist beeindruckend. Im Jahr 1992 lernten 4,8 Prozent der Schüler an Privatschulen, inzwischen sind es 9 Prozent – also fast doppelt so viele. Sieht man sich die Entwicklung genauer an, relativiert sich das Bild. Denn der große Zuwachs fand vor allem in den neuen Ländern statt. Heute herrscht insgesamt eine höhere Akzeptanz von privaten Schulen als früher.
Leistung: Privatschulen sind – anders als vermutet – nicht pauschal besser als staatliche. Laut bundesweiten Vergleichsstudien sind bei den kognitiven Kompetenzen keine signifikanten Vorsprünge Freier Schulen erkennbar. Der große Vorteil der Privatschulen ist, dass sie genau zugeschnittene Profile für die Schüler bieten – und dass die Eltern in der Regel über die entrichteten Schulgelder größeren Einfluss auf ihre Schule haben als an staatlichen Einrichtungen.
Chancengleichheit: Privatschulen seien elitär, heißt es gern. Eine Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung hat gezeigt: Die im Grundgesetz verbotene Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen ihrer Eltern ist keine Spezialität privater Schulen. In dieser Disziplin sind die Staatsgymnasien mit ihren Millionen Schülern der größere Treiber. Staatliche und private Gymnasien unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung nicht, in beiden sind die Kinder wohlhabender Eltern mit 75 Prozent deutlich überrepräsentiert.
Schulgeld: Die von deutschen Schulen in freier Trägerschaft erhobenen Beiträge sind niedriger, als viele glauben. Maßstab sind nicht Schulgelder in Höhe von jährlich 30 000 Pfund, wie sie häufig in England erhoben werden. Acht von zehn der hiesigen Privatschulen sind katholische, evangelische oder Waldorfschulen. Die Schulgelder liegen dort zwischen null und rund 300 Euro pro Monat, je nach Einkommen der Eltern. In Baden-Württemberg ist künftig ein Schulgeld von maximal 160 Euro zulässig.
Privatschulen gliedern sich im Wesentlichen in drei Gruppen:
1 Konfessionelle Schulen: Die katholischen und evangelischen Schulen sind die mit Abstand größte Gruppe der Privatschulen, die zwei Drittel aller Freien Schulen ausmachen. Die Zahl der evangelischen Schulen hat nach der Wiedervereinigung deutlich zugenommen. Unter dem Dach ihrer Schulstiftungen bietet die evangelische Kirche reformpädagogisch orientierten Gründern eine Partnerschaft an.
2 Waldorf- und Reformschulen: Die beiden Gruppen der reformerisch orientierten Schulen sind die Waldorfschulen und jene Schulen, die vom Bundesverband der Freien und Alternativschulen organisiert sind. Die Waldorfschulen unterrichten nach den Konzepten des Anthroposophen Rudolf Steiner. Ihre Lernformate sind relativ modern, da sie in Epochen, also thematischen Blöcken arbeiten, keine Noten geben und grundsätzlich Gesamtschulen sind. Die Alternativschulen decken ein breites Spektrum ab, von Summerhill-Schulen, die einzig auf den Lernimpuls der Schüler achten, über Natur- und Umweltschulen bis hin zu Mischkonzepten der reichen deutschen reformpädagogischen Tradition, die mit Wochenplänen, Projekten und großen Ausflügen arbeiten.
3 Privatschulen und Internate: Unter dem Dach des Verbandes der Privatschulen findet sich eine Mixtur von Schulen, die von Internaten bis zu Schulen reichen, die Sprachen als Schwerpunkt anbieten oder auf eine verlässliche Betreuung und kleine Lerngruppen setzen.
Das Problem der Privatschulen ist der eklatante Lehrermangel. Der Staat kann in dem Wettbewerb um Lehrer mit Verbeamtungen punkten. Privatschulen können das nicht.
Der unbedingte Wille zum höheren Bildungsabschluss ist auch an den steigenden privaten Investitionen in den Schulerfolg der Kinder erkennbar. Die Bildungsbeflissenen unter den Eltern trauten dem Staat nach dem miserablen Pisa-Zeugnis nicht mehr und kauften sich vermehrt Nachhilfe für ihre Kinder – eine Milliarde Euro geben sie dafür heute aus, Tendenz steigend. Oder sie schickten ihren Nachwuchs gleich auf Privatschulen. Deren Zahl erhöhte sich seit der ersten Pisa-Studie im Jahr 2001 um 50 Prozent.8 Der Zuwachs an Privatschulen ist ein zuverlässiger Indikator für das Misstrauen der Bürger in staatliche Schulen und Kultusbürokratie. Von »Bildungspanik« spricht der Soziologe Heinz Bude. Und die hat nicht nur mit Schule zu tun.9
Väter und Mütter durchlebten, ähnlich wie das Schulsystem, seit Beginn der 2000er-Jahre einen tiefgreifenden Wandel. Die erste rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer hatte sich eigentlich zum Anwalt der neuen Mitte machen wollen. Aber das Erbe einer extrem hohen Arbeitslosigkeit aus der Ära Kohl wirkte sich zur Jahrtausendwende drastisch aus. Zwischen 2000 und 2009 ging der Anteil der Mittelschicht um fünf Prozentpunkte zurück. In dieser Zeit sind also 4,5 Millionen Menschen aus der sozialen Mitte abgestiegen. Von einem Verschwinden jenes Teils der Bevölkerung, der gerne als »Stütze der Gesellschaft« bezeichnet wird, kann zwar keine Rede sein. Aber das preisbereinigte Nettoeinkommen ist laut den Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in den letzten zwanzig Jahren um über vier Prozent gesunken.
Diese realen Einkommensminderungen haben dazu geführt, dass die gefühlten Abstiegsängste für die Mitte umso bedrohlicher geworden sind. Besonders betroffen von diesen Ängsten sind Eltern.
Bildung ist ein wichtiger Faktor für die Selbstdefinition des Bürgertums. Sie gilt als Voraussetzung für Erfolg und Status. Inmitten des realen wie gefühlten ökonomischen Drucks um die 2000er-Jahre wird nun das Hausgut Bildung infrage gestellt. Erst erschreckt die Pisa-Studie die Eltern. Dann beginnt fast zeitgleich die Politik jene Schulform mittels einer rabiaten Schulzeitverkürzung zu beschneiden, die als die natürliche Heimat der Bürgerfamilien gilt: das Gymnasium.
Aus dieser Perspektive ist es verständlich, dass bildungsbürgerliche Eltern aufgeschreckt reagieren. Schaut man sich die Entwicklung genauer an, so zeigt sich, dass daraus so etwas wie eine historische Zäsur im Bildungswesen geworden ist: Die Eltern haben das ganze System durcheinandergewirbelt.
Die neue Bildungsrepublik
Nimmt man eine Gesamtbetrachtung der deutschen Bildungslandschaft der vergangenen knapp zwanzig Jahre vor, so ist diese von einem dominierenden Faktor geprägt: einer regelrechten Flucht ins Abitur. Die Gymnasien erzielen große Zuwächse an Schülerzahlen. Im Gegensatz zu ihnen sind die Hauptschulen die großen Verlierer. In den ersten zehn Jahren nach Pisa büßen die Hauptschulen eine halbe Million Schüler ein, ein Minus von 41 Prozent.10
Die ganze Dynamik wird aber erst erkennbar, wenn man sich ansieht, wie sich die Schülerverteilung in den folgenden fünf Jahren von 2011 bis 2016 weiterentwickelt hat. Nun wird deutlich, dass es sich nicht mehr bloß um eine Übergangsphase handelt oder um eine Verschiebung von Proportionen. Nicht ein Einmaleffekt doppelter Abi-Jahrgänge ist zu bestaunen, sondern das ganze Schulsystem gerät ins Wanken: Die Hauptschulen bluten aus (minus 62 Prozent), auch die Realschulen verlieren ein Drittel ihrer Schüler. Die Zahl der Gymnasien bleibt zwar relativ stabil, doch die Zahl der Abiturienten steigt steil an. Das wird möglich, weil die Gymnasien so viele Schüler wie möglich aufnehmen. Es ist ein historischer Kipppunkt zu beobachten: Die Säule der Abiturientenzahlen wächst in der Statistik immer höher, während ihr jene für Hauptschüler entgegenschrumpft. 2016 ist es dann so weit: Nun ist die Zahl allein der Abiturienten größer als die aller Hauptschüler zusammen.11 Früher gab es in den Hauptschulen mehr Schüler als in allen anderen weiterführenden Schulen. Jetzt ist die Bildungsrepublik eine andere als vorher.
Deutschland hat den bildungspolitischen Fußabdruck verändert, der die Nation über 200 Jahre lang prägte. Ein Teil der Entwicklungen fand sukzessive seit den 1960er-Jahren statt. Aber die eigentliche Revolution hat sich in den wenigen Jahren seit 2011 zugetragen. Der Marsch Richtung Abitur wälzt im Eiltempo ein Bildungssystem um, das sich lange bewährt hat.
Schauen wir noch einmal kurz zurück in das Jahr 1960. Damals standen 2,1 Millionen Hauptschüler nur 54 000 Abiturienten gegenüber. Das ist die alte Grundstruktur eines Ausbildungswesens aus dem 19. Jahrhundert: Nur sehr wenige erhalten das wertvollste Bildungszertifikat, das Abitur. Sehr viele gehen in die Hauptschulen – die genau deswegen auch so heißen –, um das Rohmaterial für den Fachkräfte-Nachschub bereitzustellen, den Mittelständler und Industrie brauchen. Ganz ähnlich sieht das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Auszubildenden und Studenten aus: Im Jahr 1970 steht es 70 : 30 für die Azubis. Heute hat sich das praktisch umgekehrt. Nun lautet das Verhältnis Auszubildender zu Studierenden 40 : 60.
In der Berufswelt wird diese Entwicklung von lautem Jammern begleitet. Mit Plakat-Kampagnen versucht man junge Leute darüber aufzuklären, wie cool und sinnvoll es wäre, Bäcker oder Schreiner zu werden. Über Jahrzehnte, nein Jahrhunderte waren Gesellen und Facharbeiter hierzulande klar in der Mehrheit. Nun ändert sich das. Eine wichtige Figur des Wirtschaftssystems droht an Schwindsucht zu erkranken: der Facharbeiter.
Gleichzeitig erleben wir einen Siegeszug der Abiturienten. Etwa eine halbe Million von ihnen werden jedes Jahr aus den höheren Schulen entlassen. Die Abiturquote des Altersjahrgangs pendelt zwischen 50 und knapp 60 Prozent, und das inzwischen ganz ohne doppelte Jahrgänge. Der jüngste Bundesbildungsbericht von 2018 verkündete gerade stolz, »dass die Zahl der Studienanfänger zum fünften Mal in Folge über einer halben Million lag«.12
Es gibt viele, die sich nur schwer daran gewöhnen können. Die ehemalige Vorsitzende des Bildungsausschusses im Bundestag, Patricia Lips (CDU), etwa sagt: »Wir haben erfreulich viele Studenten, aber wir müssen jetzt aufpassen, dass das duale System nicht in Gefahr gerät.«13 Sie wünscht sich, dass die Länder wieder verstärkt Maßnahmen ergreifen, um den Übergang in weiterführende Schulen zu steuern – auf Deutsch: dass die Abiturquote wieder gesenkt wird. Wie Lips denken viele. Und das hat Tradition. Helmut Kohl etwa war ein großer Streiter gegen hohe Abiturienten- und Studentenzahlen.
Heute wissen wir, dass der Kanzler der Einheit einen Kampf kämpfte, den er nicht gewinnen konnte – den gegen eine Revolution in der Bildungsbeteiligung. Soziologen und Bildungsforscher sprechen zwar nach wie vor von »sozialer Schließung« oder einer blockierten Aufwärtsmobilität. Titel wie Die Abstiegsgesellschaft14 oder Marco Maurers Du bleibst, was du bist15 verkaufen sich prima. »Von der Bildungsoffensive der 1960er- und 1970er-Jahre, als hunderttausende so genannte Nichtakademikerkinder Abitur machen und studieren konnten, ist wenig geblieben«, lautet der Schlüsselsatz Maurers. Glücklicherweise ist er schlicht falsch.
Damals machten gar keine Hunderttausenden Nichtakademiker Abitur. Es legten beispielsweise im Jahr 1979 insgesamt nur 120 000 das Abitur ab, und der Anteil an Arbeiterkindern an ihnen war minimal. Maurer und all jene, die von der damaligen Bildungsoffensive schwärmen, übersehen aber vor allem, dass die Zahl derer, die heute studieren können, um ein x-Faches die Vergleichsgröße der Sechziger und Siebziger übertrifft. Die Stationen sehen so aus: Von 56 000 Abiturienten (1961) ging es damals mählich auf 81 000 hinauf (1971); inzwischen aber hat sich die Zahl von 214 000 Abiturienten (2001) auf 506 000 Abiturienten (2011) mehr als verdoppelt.16
Die reale Entwicklung im Bildungssystem ist offenbar so frisch und so rasant, dass viele sie nicht erkennen (wollen). Tatsache ist: Noch nie war es in Deutschland so leicht wie heute, das Abitur zu erringen. Das gilt auch für Kinder aus bildungsarmen Familien und benachteiligten Schichten, ja gerade für sie.
Es findet im Moment die größte Öffnung der höheren Bildungseinrichtungen statt, seit es diese gibt. Dagegen war der Zuwachs von drei Prozent Studierenden im Jahr 1870 auf zehn Prozent einhundert Jahre später ein Klacks. Gleichwohl war die erste Bildungsexpansion in den 1970er-Jahren schon aufregend genug für die Nation, die immer auch eine der Facharbeiter war, wie wir in Kapitel 4 sehen werden. Mit dem Abiturboom jedoch, der seit der Pisa-Studie eingesetzt hat, droht das System aus dem Gleichgewicht zu geraten. »Wirtschaft und Gesellschaft erkennen zunehmend, welches Problem sie sich mit der Expansion des Gymnasiums eingefangen haben«, berichtet zum Beispiel Petra Lölkes, die Leiterin der Schülerberatung »Gesellschaft für Jugendbeschäftigung« in Frankfurt. »Viele Gymnasiasten wissen nichts über Ausbildungsberufe – obwohl zunehmend mehr von ihnen eher für das duale System als für die Uni passen.«17
Das bedeutet, dass die Chancen auf Abitur und Bildungsaufstieg für Schüler jeder Herkunft schon bestehen – der Umbau des institutionellen Gefüges samt der nötigen Beratung und Information hinkt aber noch hinterher. An den Hochschulen tun sich viele überforderte Abiturienten schwer: Die Studienzeiten steigen wieder, viele Studierende brechen das Studium ab. Zur gleichen Zeit fahnden die Meister in den Betrieben nach Jugendlichen mit guten Noten – und sieben immer mehr Schüler aus, die keinen oder nur einen schlechten Abschluss haben. Die Gymnasien machen unterdessen weiter Dienst nach Vorschrift. Ihr Unterricht richtet sich an künftige Studierende, obwohl nun viele »nicht-traditionelle« Gymnasiasten dabei sind. So nennen die Bildungsforscher die neue Klientel, in deren Familien es nie ein Abitur gegeben hat.
Steigende Abiturnachfrage
Wenn man noch mal genau hinsieht, dann merkt man: Der Abi-Boom ist noch gar nicht an seinem Ende angekommen. Wer glaubt, der Spuk sei bald wieder vorbei, dürfte sich genauso täuschen wie einst die Hochschulpolitiker nach der ersten Bildungsexpansion. Man dachte damals, die vielen Studierenden würden irgendwann wieder verschwinden. Heute gibt es ähnliche Hoffnungen, was die Abiturienten angeht. Die Wahrheit ist: Jetzt geht’s erst richtig los.
Guckt man in die einschlägigen Statistiken der vergangenen Jahre, stellt man fest: Das Gros der Abiturienten kommt – bislang – von Gymnasien, Fachgymnasien und beruflichen Gymnasien. Die Abiturienten, die von Gesamtschulen stammen, spielen bei dem exorbitanten Abiturboom um das Jahr 2011 noch keine große Rolle, um nicht zu sagen: Ihr Anteil ist kümmerlich. Den 149 000 Abiturienten von allgemeinbildenden Gymnasien standen im Jahr 2010 ganze 11 157 Abiturienten von Gesamtschulen gegenüber.18 Im Jahr 2016 kamen von Gesamtschulen aber bereits 28 216 Abiturienten – ein Plus von 180 Prozent.19 Wie ist das möglich?
Während alle Welt auf den langsamen Tod der Hauptschulen fixiert war und gleichzeitig über die vielen Abiturienten schimpfte, veränderte das Schulsystem beinahe unbemerkt seine Grundstruktur. An die Stelle eines Modells, bei dem drei Arten weiterführender Schulen um die Schüler konkurrieren, tritt nun sukzessive eines mit nur noch zwei Schulformen: auf der einen Seite das Gymnasium – und daneben eine zweite Schule, die das Abitur anbietet. Die großen Zuwächse verzeichnen Schulformen, die lange als die Schmuddelkinder des Bildungssystems galten. Es existieren heute dreimal so viele Gesamtschulen wie im Jahr 2006 – nur haben sie viele und ganz andere Namen: Oberschulen, Sekundarschulen, Stadtteilschulen, vor allem aber heißen sie Gemeinschaftsschulen (siehe auch Im Labyrinth der Schulformen). Ihr wesentliches, gemeinsames Prinzip ist, dass sie die Schüler nicht mehr trennen. Es sind vielmehr integrative Schulformen, sie vereinen alle Schüler in denselben Einrichtungen und Klassenzimmern. Die alte Bildungspyramide wird gerade auf den Kopf gestellt. Kein Stein bleibt auf dem anderen.
Im Moment kommt die große Mehrheit der Abiturienten noch von den Gymnasien. Die Gesamtschulen hinken, wie gesehen, noch deutlich hinterher. Das liegt daran, dass die wie Pilze aus dem Boden schießenden integrativen Schulen – anders als ab den 1970er-Jahren die Gesamtschulen – keine riesigen Lernkästen mit oft 1500 Schülern mehr sind. In der Regel werden die heutigen neuen Schulen nicht am Reißbrett geplant und auf die grüne Wiese gepflanzt. Vielmehr kooperieren nun viele kleine Schulen, die es bereits gibt – spätere Fusion nicht ausgeschlossen. Hauptschulen werden nicht abgewickelt, sondern mit der örtlichen Realschule vereint. Gerade Bürgermeister von Gemeinden und Kleinstädten, die sonst ihr schulisches Angebot vor Ort verlieren würden, engagieren sich in diese Richtung. Auch Eltern, Schulleiter und die örtliche Wirtschaft tun sich für die Gründung von lokalen Schulen mit Abiturmöglichkeit zusammen. So ist aus vielen kleinen Initiativen eine große Bewegung entstanden. Aus bundesweit 670 integrierten Gesamtschulen (unter diesem Namen führt sie das Statistischen Bundesamt) im Jahr 2006 wurden über 2000 im Jahr 2016.20 Das heißt: Die integrativen Schulen werden die Gymnasien in absehbarer Zeit einholen.
Bereits jetzt steht also ein Reservoir von Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen und so weiter bereit, um das Abitur anzubieten. Dazu kommen 1000 »Schulen mit mehreren Bildungsgängen«; sie vereinen die bisherigen Haupt- und Realschüler unter einem Dach, wenn auch nicht im selben Klassenzimmer. Auch diese Schulen ließen sich leicht in integrative Schulen umwandeln. Man muss ihnen nur eine Oberstufe geben, dann gäbe es das, wovon viele Bildungsreformer ihr Leben lang träumten: ein zweigliedriges Schulsystem, in dem man in beiden Zweigen das Abitur ablegen kann. Solche Schulen würden eine ganz neue Schülerklientel zur Hochschulreife führen: Kinder von Eltern, die selbst kein Abitur gemacht und keine Universität besucht haben. Diese mischen sich mit den Kindern jener Eltern, die Wert darauf legen, dass ihre Kinder in der Schule nicht zu sehr unter Druck gesetzt werden. Noten, Sitzenbleiben und das sogenannte Abschulen (in niedrigere Schulformen) sind in ihren Augen nämlich die Druckmittel eines selektiven Schulsystems.
In Zukunft werden wohl ebenso viele Abiturienten von den Gesamtschulen und anderen integrativen Schulen kommen wie von Gymnasien. Ein solcher Strukturwandel war bereits 1973 vom sogenannten Bildungsrat vorgesehen. Das Gremium, eingerichtet, um Bund und Länder bei der Bildungsoffensive zu beraten, empfahl die dreigliedrige Struktur auf mittlere Sicht abzulösen. Stattdessen sollten im großen Stil Gesamtschulen gebaut werden, in denen möglichst alle anderen Schulen aufgehen. Dieser Versuch einer Generalreform mündete in einem Schulkrieg um die sogenannten Einheitsschulen – und versandete. Nun wird, mit vierzigjähriger Verspätung, die vom Bildungsrat vorgezeichnete Entwicklung nachgeholt. Nur, dass es diesmal keinen Masterplan dafür gibt.
Ende der Dreiklassenschule
Um zu verstehen, wie grundsätzlich dieser Wandel ist, müssen wir zurückgehen bis ins Jahr 1788. Damals wurde in Preußen das sogenannte Abiturientenexamen eingeführt. Es ist die Vorform des heutigen Abiturs und der Startschuss für die Entwicklung jener Schulstruktur, die heute de facto abgerissen wird. König Friedrich II. hatte die Notwendigkeit erkannt, aus schlechten und schlecht besuchten Elementarschulen echte Schulen zu machen: Einrichtungen, in denen nicht mehr ausschließlich religiöse Texte aufgesagt und nachgebetet wurden, sondern die so etwas wie Wissensvermittlung betreiben sollten. Diese Schulen für das einfache Volk wurden durch die Einrichtung von Lehrerseminaren mit professionellen Pädagogen versorgt. Gleichzeitig bedeutete das Abiturientenexamen für die Latein- und Klosterschulen den Beginn der zentralen staatlichen Reglementierung. Zwischen die Gelehrtenschulen, die nur ein Prozent der Bevölkerung besuchen durfte, und die Elementarschulen für die Masse schoben sich Bürger- und Realschulen.
Diese Zeit markiert somit die Herausbildung eines staatlich organisierten Bildungssystems, das die grundlegenden Qualifikationsanforderungen eines beginnenden modernen Staates befriedigen sollte. Damals entstand das dreigliedrige Schulsystem. Nur vereinzelt wurden übrigens echte Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen – durch Stipendien für gute Schüler aus dem einfachen Volk.
Erst 230 Jahre später, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wird diese Idee in Deutschland nun auf alle Schüler angewendet: In dem neuen zweigliedrigen Schulsystem bekommt im Prinzip jedes Kind die Gelegenheit, ohne komplizierte Schulwechsel bis zum Abitur vorzustoßen.
Anfang des Jahres 2018 sorgte eine gesonderte Auswertung der Pisa-Daten von 2015 für eine kleine Sensation. Zum ersten Mal im Dreijahreszyklus der Pisa-Studien verbesserten sich die Ergebnisse jener Gruppe von Kindern, die den Pisa-Schock ausgelöst hatten: Schüler aus sogenannten Arbeiter- und Zuwandererfamilien. »In Deutschland ist zwischen 2006 und 2015 der Anteil resilienter Schülerinnen und Schüler von 25 auf 32,3 Prozent gestiegen und damit so schnell wie in kaum einem anderen OECD-Land«, teilte die OECD mit.21 Gemeint waren sozial benachteiligte Schüler, die trotzdem Erfolg haben. Deutschland war damit zum ersten Mal bei denen spitze, die früher »Schmuddelkinder« genannt wurden. Nicht ganz zwanzig Jahre nach dem Pisa-Schock scheint demnach auch der zweite große Mangel des hiesigen Schulsystems behoben zu werden: die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen, sich zügig verändernden Schulstruktur ist dieses Ergebnis nicht verwunderlich.
Das Problem des Schulsystems lag in seiner scharfen Trennung zwischen den Schulformen. Auf diese Weise konnten sich in den Hauptschulen jene Kinder sammeln, die keine guten Leistungen erbringen. Separiert man diese Schüler aber, sinkt ihre Leistungsbereitschaft. Laut Schulforschern entstehen so Milieus, »die zu einer kumulativen Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern führen«. In dem System, das sich im Moment herausbildet, wird das anders sein. »Diese Problemgruppe ist in zweigliedrigen Schulsystemen praktisch nicht anzutreffen«, schreiben die Wissenschaftler.22 Um eine Zweigliederung hinzubekommen, muss man also genau das tun, was gerade geschieht: neben dem Gymnasium einen Schulzweig errichten, der den direkten Durchstieg zum Abitur öffnet. Dafür müssten die Kultusminister allerdings die Hauptschulen abschaffen (dazu mehr in Kapitel 2).
Noch einmal zurück ins Casimirianum nach Coburg. Als die Schule im 17. Jahrhundert gegründet wurde, beherbergte sie eine sogenannte Trivialschule, eine Schule, die nur Elementarunterricht im Programm hat und das für jeden. Offenbar wollte der fränkische Herzog Casimir keine der damals so verbreiteten Lateinschulen betreiben, die nur für den Adel, auserlesene Kinder frommer Eltern und die Verwalter seiner Schlösser reserviert waren. Er wollte das Tor zum Casimirianum auch für ein paar normale Untertanen und Bauernkinder öffnen – weil, so der Herzog in seiner Gründungsurkunde, »armer Leuthe kindere […] offtmahls übergangen, negligiert und verseumet werden«.
Der Abiturskandal 400 Jahre später am Casimirianum könnte auf ähnliche Ursachen zurückgehen. Seit 2011 nämlich gibt es an dem Gymnasium wieder so etwas wie einen Trivialzweig. Der korrekte Name lautet »Einführungsklasse«, und sie ist für Schüler aus der Realschule gedacht, die den Sprung aufs Gymnasium wagen. Sie sollen sich in Einführungsklassen ab der zehnten Klasse auf das Abitur vorbereiten, das heißt, sie müssen zunächst eine Fremdsprache hinzulernen und jenen gymnasialen Stoff pauken, den sie an der Realschule verpasst haben. Als das Deutsch-Abitur am Casimirianum kollektiv um einen Punkt angehoben wurde, waren just die ersten Schüler dieser Einführungsklasse bis in die Oberstufe vorgerückt. Sie standen vor dem Abitur. War Schulleiter Spachmann womöglich gar kein Betrüger, der sein Gymnasium in hellem Licht erstrahlen lassen wollte, sondern ein guter Hirte für Schüler aus der Einführungsklasse, die er vor dem Scheitern bewahren wollte? Ist er am Ende Bote des neuen Verständnisses von Gymnasium: Lasst sie leichter ans Ziel kommen?