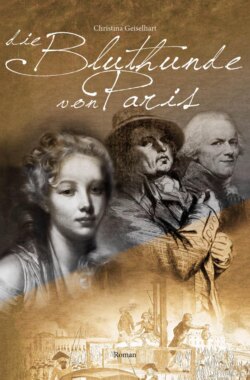Читать книгу Die Bluthunde von Paris - Christina Geiselhart - Страница 9
5. Kapitel
ОглавлениеMai 1786.
Mit angewinkelten Beinen saß Lea im Gras und beobachtete ihre schöne Tochter, die schwerelos auf Vraem an den Ufern der Seine entlang trabte. Hin und wieder machte sie ein paar Kunststücke, zog die Knie bis ans Kinn oder streckte die Beine aus und kitzelte mit ihren Füßen die Pferdeohren. Dann drehte sie sich, saß mit dem Rücken zu seinem Kopf und ritt verkehrt herum, ohne Sattel, ganz mit dem Tier verwachsen. Nichts brachte sie aus dem Gleichgewicht. Sie vertraute Vraem und das Pferd vertraute ihr. Fast ein Jahr hatte Albano sie im Reiten unterrichtet. Er hatte ihr geholfen, täglich den Stall zu säubern, denn das war mit ihrem verkrüppelten Fuß Schwerstarbeit.
Er hatte ihr gezeigt, wie man ein Tier wäscht und trocknet, wie man es bürstet, damit sein Fell schimmerte, sein Schweif und seine Mähne seidig glänzten. Das tägliche Reittraining hatte die Muskulatur des Pferdes gestärkt, nun rundete sich seine Kruppe und kein Knochen stand mehr heraus. Pflege und Liebe verwandelten das stumpf aussehende Tier in einen silbernen Schimmel, und manchmal hätte Lea nicht sagen können, wer nun schöner war: Vraem oder ihre Tochter. Ja, der junge Mann war doppelt nützlich gewesen. Er hatte Philippine zu einer ausgezeichneten Reiterin gemacht und gleichzeitig Leas Schoß viel Gutes getan.
Dank ihrer Leitung hatte sich der ungeschickte Junge zu einem brauchbaren Liebhaber entwickelt, war gehorsam, fügsam geworden und hatte eine erstaunliche Auffassungsgabe und Ausdauer gezeigt. Und er war nicht dumm gewesen. Leider hatte er sich längst davon gemacht und statt seiner hielt sich Lea den einfältigen Merlen. Dessen Hirn war nicht größer als das eines Spatzes, jedoch sein Schwanz funktionierte Tag und Nacht.
Die Frau ließ sich auf den Rücken fallen und blickte verträumt in den Himmel. Kein Wölkchen trübte das glasklare Blau, die Luft strich sanft über die hohen Gräser und Leas Wangen, so dass ein köstlicher Schauder sie erfasste. Sie verspürte Lust, wenn sie an den hübschen Albano dachte und unwillkürlich öffnete sie ihre Schenkel, lüftete den Rock und hielt ihren Schoß der Sonne entgegen. Meistens war sie nackt unter ihrem Kleid und als die heißen Strahlen ihre Scham kitzelten, stöhnte sie sehnsüchtig auf. Ich bin ein verruchtes Weib, dachte sie und streichelte ihre Schenkel. Ich kenne nur meine Tochter und die Wollust.
Alles andere ist mir egal. Mein einfältiger Mann, die beiden Mädchen, sie alle interessieren mich nicht. Sie können alle zum Teufel gehen, wenn nur meiner geliebten Philippine eine glänzende Zukunft winkt und sich ein junger Kerl hin und wieder um meinen Hintern kümmert.
Warum aber bin ich so verrucht, und warum so schrecklich, dass ich nicht einmal um meine toten Kinder trauere, geschweige denn um die verschollene Alberta? Ha, verschollen! Ich bin recht froh, sie los zu sein. Aber warum sind alle herzlichen Regungen für Menschen, die mir am nächsten stehen, in mir abgestorben?
Während sie sich ihren Gedanken hingab, wanderten ihre Hände zwischen ihre Schenkel. Sie liebkoste ihre Scham behutsam, zärtlich, wie um sie zu besänftigen, sie zu trösten. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte sie an Gott geglaubt und daran, dass er sie unter seine Fittiche nehmen und entschädigen würde für die bittere Kindheit unter dem Dach ihres Vaters.
Doch Gott scherte sich einen Dreck um sie. Als sie sechzehn wurde, lenkte er die Schritte eines Verhörvollstreckers ins elterliche Haus und keinen Prinzen. Gott sah ungerührt zu, wie sie von diesem Kerl brutal entjungfert wurde, ließ es geschehen, dass der rohe Mann jahrelang fast täglich ihre Brüste knetete, seinen übel riechenden Mund auf ihre Lippen presste und ihr armselige Kinder zeugte. Zuerst hatte sie Frieda geboren. Ein schmächtiges Ding mit einem runden Gesicht, winzigen Augen, langen Ohren. Am meisten jedoch hatte sie das schwarze Mal über Friedas rechtem Mundwinkel entsetzt. Ein unförmiger Auswuchs von der Farbe fauliger Pflaumen zeichnete sich dort ab und Lea fürchtete, er könnte sich ausdehnen, aufblähen.
Ein Jahr nach Frieda brachte sie eine Totgeburt zur Welt und knappe zehn Monate später kam sie sechs Wochen zu früh nieder. Das Kind starb in der Wiege. An einem grauen Tag, an dem der Regen durch die Ritzen der schadhaften Haustür drängte und ein närrischer Wind heftig an dem schiefen Gemäuer rüttelte, gebar sie Rosel. Während sie unter schmerzhaften Wehen das Kind zur Welt brachte, meinte Lea, das Haus stürze über ihr ein. Als sie aber den Säugling anblickte, verstand sie, warum sich die Naturgewalten aufbäumten. Das Mädchen hatte einen entstellten Mund.
Die Oberlippe knüpfte an die Nase an und legte das obere Zahnfleisch frei. Angewidert hatte sich Lea abgewendet und ihr die Brust ebenso verweigert wie Frieda. Ihr Herz, das ohnehin schon Sprünge hatte, zerriss und ein gewaltiger Zorn ballte sich an seiner Stelle. Zorn auf den Ehemann und Zorn auf ihren Schoß, dem nur Unkraut zu entspringen schien. Entweder sie brachte Missgeburten zur Welt oder ihre Kinder starben. Welch’ giftige Säfte tobten in ihrem Bauch? Warum vereinigte sich der verfluchte Samen des Folterknechtes in ihrem Schoß mit den übelsten Elementen? Vielleicht strafte sie Gott dafür, dass sie einen Mann geheiratet hatte, der täglich Menschen quälte? Vielleicht hatte Gott sie längst verlassen. Oder aber sie war kein Kind Gottes und der Teufel hatte an ihrer Wiege gestanden. Sie, die Tochter eines Säufers und einer Wäscherin. Sie, die nur Armut, Krankheit und Gewalt gekannt hatte.
Lea hatte aufgehört, ihre Scham zu streicheln, zog den Rock bis zum Bauch und blickte an sich hinunter.
„Wie sonderbar? Mein Kopfhaar ist rotbraun, doch du versteckst dich unter rabenschwarzem Gefieder. Deine Mitte spuckte das aus, was sie aufnahm. Hässlichkeit und Tod. Dafür hasste ich dich und gönnte dir Karls ungeschliffene Art, in dich einzudringen. Manchmal wünschte ich, du würdest bluten, zerreißen, vertrocknen und dich für immer schließen. Manchmal rief ich den Teufel an, er möge mich reiten, denn in mir glühte die Hitze der Hölle.“
Erschrocken über sich selbst, warf sie eilig den Rock über ihre Schenkel. Alberta fiel ihr ein. Das Kind vor Philippine. Der Gedanke an die Unglückliche rief sie einen Moment lang zur Ordnung. Zum ersten Mal hatte sie ein ansehnliches Kind geboren. Sein Kopf war wohlgeformt, die Augen schräg geschnitten, der Mund süß, so dass Lea die Brust geben konnte. Aber Alberta hatte eine schuppige Haut und ihre Hände waren die einer alten Frau. Verdorrt, schrumpelig, erdfarben. Anfangs hoffte die Mutter auf Besserung und bevorzugte die Kleine der Ältesten, deren Mal sich in die Wange hinein ausbreitete. Dennoch liebte sie Alberta nicht wirklich. Sie war die Frucht roher Handlungen, der Spross eines königlich anerkannten Quälers. Und als Lea dann Jahre später entdeckte, dass Alberta nicht viel mehr als einen Meter Größe erreichen würde, wuchs tödlicher Groll in ihr. Wieder hatte sie Liebe an eine Missgeburt vergeudet.
Sie schwor sich, ihrem unnützen Leben ein Ende zu setzen, wenn sie nicht bald ein ansehnliches Kind gebären sollte. Dann fing sie an zu beten. Betete zu einer übernatürlichen Kraft, die sie nicht immer Gott nannte. Jedoch betete sie nie im Innern des Hauses. Auch nicht in seiner Nähe. Es schien ihr unwahrscheinlich, diese übernatürliche Kraft, dieses übermenschliche Wesen könnte sie von der erbärmlichen Behausung aus wahrnehmen. Lea glaubte, dass dieses Wesen einer Pflanze ähnlicher war als einem Menschen, deshalb betete sie gerne im Umkreis des Baches, der durch das Dorf floss, in dem sie damals wohnten. Und da erschien ihr eines Tages, als sie völlig im Gebet an das geheimnisvolle Wesen versunken war, zum zweiten Mal ihre Mutter. Wunderschön und stolz redete sie mit zorniger Stimme zu ihr.
An ihrem nackten Körper klebten Schlamm und Blätter. In ihrem gelösten Haar steckten Wasserlilien und sie sprach in Ehrfurcht vom weiblichen Schoß. Was er empfängt muss in höchster Wonne aufgenommen werden, sagte sie und Lea war überzeugt davon, dass sich ihr das Höchste Wesen in Gestalt ihrer Mutter gezeigt hatte, um ihr keine Angst einzujagen.
Ja, und im April 1774 schenkte sie einem ganz besonderen Kind das Leben. Je älter das Kind wurde, umso schöner wurde es. Lea reckte ihren Oberkörper und blickte dankbar in den weiten Himmel:
„Philippine ist das Versprechen eines anderen, eines besseren Lebens. In ihm spiegelt sich ein Neubeginn, eine rosige Zukunft für uns beide!“, sagte sie laut. „Ich danke dir, himmlisches Wesen! Du allein verstehst, dass in dieser Zukunft weder die anderen Mädchen noch mein Mann, der Folterknecht, Platz haben. Und du wirst mich niemals richten, weil ich froh darüber bin, Rosel und Alberta los zu sein. Alberta, die Seltsame. Alberta, die Geheimnisvolle. Alberta, die nicht wachsen wollte, Alberta mit den Händen einer Greisin. Was hatte dieses Kind an meinem Busen zu suchen?“ Leas Stimme bebte. Sie wollte weiter jammern, da drang das Rasseln eines Wagens an ihr Ohr.
Unwillkürlich duckte sie sich ins hohe Gras und beobachtete. Auf dem Weg, der die Ufer der Seine säumte, kam eine prächtige Kutsche von Paris her. Aus ihren scheibenlosen Fenstern drang helles Gelächter. Ein Frauenkopf neigte sich heraus, gefolgt von einem weißen Arm und einer wunderschönen Hand, die ein Taschentuch schwenkte. Lea konnte das gelockte Haar, den Sommerhut und eine Andeutung des hellen Spitzendekolletés entdecken und bohrender Zorn über ihr schäbiges Leben loderte mit einem Mal in ihr auf wie eine Flammensäule. Nein!, schrie es in ihr. Du höchstes Wesen hast noch viel zu tun, um alles Unrecht zu beseitigen. Ein kleiner, ausgewählter Menschenteil lebt auf der Sonnenseite, während der große Teil in Schlamm und Dunkelheit dahin darbt. Wie eine Königin sähe ich aus, steckte man mich in herrliche Kleider und behängte sie mit Diamanten und Perlen. Wie eine Königin würde ich behandelt werden und die schönsten Männer lägen zu meinen Füßen.
„Und wenn ich daran denke, wie gut es diesen Damen geht, dann könnte ich jeder Einzelnen den Kragen umdrehen. Schöne Jünglinge liegen in ihren Damastbetten und liebkosen ihre weißen Hinterteile, küssen ihre Alabasterbrüste und besorgen es ihnen zu jeder Stunde des Tages in allen Lagen auf samtweichen Kissen, seidigen Laken. Nebenbei gibt es duftendes Zimtgebäck und köstlichen Tee aus zierlichen Kännchen. Diese Faulenzerinnen, Tagediebinnen würden sich zu Tode langweilen, würzten nicht schöne Männer ihre öden Tage und Nächte. Oh, ich werde es euch noch zeigen! Bald werde ich mich auch in feinen Betten wälzen. Friedas Hintern ist tüchtig und bringt gutes Geld. Es hat sich bei den Kerlen längst herumgesprochen, wie talentiert sie ihre Reize verkauft. Es wird Zeit, die Preise in die Höhe zu treiben!“ Triumphierend stieß sie die Faust in die Luft, indessen die Kutsche in der Ferne untertauchte. „Ihr Können auf dem Gebiet hat sie allein mir zu verdanken. Ja, mir ganz allein! Warum also sollte ich das Geld nicht in die eigene Tasche stecken?“ Schlagartig senkte Lea die Stimme.
Philippine tauchte wieder aus dem Unterholz des Waldes und ritt in gestrecktem Galopp auf die Mutter zu. Das goldbraune Haar strahlte in der leuchtenden Luft, die blendend weiße Mähne des Pferdes tanzte im Wind. Fasziniert folgten Leas Augen den beiden schönen Geschöpfen. Sie genoss den Anblick intensiv, denn die gemeinsamen Spaziergänge mit Philippine waren in letzter Zeit seltener geworden. Das Mädchen bevorzugte die Einsamkeit, seit ihre Schwester Alberta auf geheimnisvolle Weise verschwunden war. Das märchenhafte Bild der beiden Gestalten, die dem Himmelsblau zu entsteigen schienen, besänftigten Lea und unerwartet heftig wurde sie von einer zärtlichen Liebe zu Natur und Mensch überflutet. Solch seltene Momente öffneten für Sekunden Leas verhärtetes Herz und durchwehten es mit jener Melancholie, die sie zutiefst fürchtete, weshalb sie stets alles vermied, was sie dieser Sanftmut ausliefern könnte. Doch manchmal war der leise Wind stärker als ihre Furcht. Er trug den Geruch nach warmer Milch mit sich. Er umarmte sie, wiegte sie, und sie ahnte, dass es irgendwann Liebe in ihrem Leben gegeben hatte. Blind und empfindungslos geschlagen von den harten Kinder- und Jugendjahren blitzten diese Momente dennoch auf, gerade hier im schönen Bild der Tochter. Und als diese sie erreicht hatte, sagte sie nachdenklich:
„Weißt du, schönes Kind, ich glaube doch an eine Höhere Kraft, an ein Höchstes Wesen. Wenn ich mich allerdings täuschen sollte und es doch einen Schöpfer gibt, den sie Gott nennen, dann hat dieser Schöpfer nicht den Menschen erschaffen, sondern allein das Tier. Vielleicht sogar nur das Pferd, denn kein anderes Tier ist so edel und so schön wie das Pferd.“
Philippine lachte und beugte sich ein wenig zu ihrer Mutter herunter.
„Mama, du sprichst wie Albano! Der Mensch ist so schlecht, dass nur der Teufel ihn erschaffen haben kann, sagte Albano. Das Pferd aber ist gut. Es ist stark, edel, es nützt uns und es liebt und dankt uns, weil wir für es sorgen.“
„Er war nicht dumm, der Albano. Nur schade, dass er nicht mehr kommt.“
„Oh, ja! Er ist sehr klug. Darum kommt er nicht mehr, denn es gibt Besseres zu tun, als einem zwölfjährigen Mädchen reiten beizubringen ...“
... und es einer dreißigjährigen Frau zu besorgen, dachte Lea resigniert, indessen Philippine weiterredete. „Damit er nicht wie sein Vater endet, geht er in die Stadt, will Geld verdienen und alles tun, um ein wichtiger Mann zu werden.“
„Wie soll er das schaffen? Er kann kaum lesen, schreibt und rechnet jämmerlich. Das ist nicht genug, um wichtig zu werden.“ In einem Ruck stand Lea auf und schüttelte ihren Rock sauber.
„Er ist gewandt, Mama. Wir werden sicher noch von ihm hören.“
Anerkennend blickte die Mutter an der Tochter hoch. Sie redet so geschult, die Kleine, dachte Lea stolz. So manierlich, als habe sie nur in Adelshäusern gelebt. Sie ist wahrhaftig auf vielen Gebieten begabt. Wenn sie nun noch im Bett so leidenschaftlich reitet wie auf ihrem Pferd, liegen ihr die dummen Aristokraten zu Füßen.
„Nun, wie sieht es mit dem neuen Schuhwerk aus?“, fragte die Mutter.
„Der Arzt in Paris hat Zeichnngen von meinem Fuß gemacht. Dann will er Holzschuhe anfertigen lassen, in denen ich immer laufen muss, die aber jedes Jahr gewechselt werden, weil ich ja wachse. Das alles ist teuer, sagt der Pfarrer.“
„Er soll den Mund halten. Ich zahle alles.“
Verwundert sah Philippine ihre Mutter an. Diese wollte lästigen Fragen ausweichen und wechselte eilig das Thema:
„Wie steht’s mit deiner Suche nach Alberta?“
Über Philippines Gesicht fiel ein Schatten.
„Ich hab überall gesucht und kann es mir nicht erklären. Aber ein bisschen Hoffnung machte mir der Nachbar. Er wundert sich, warum er noch immer keine Antwort von seinem Sohn hat und kann es sich plötzlich vorstellen, dass die Beiden abgehauen sind. Alberta fühlte sich verlassen, niemand hat sich um sie gekümmert. Auch ich ...“. Sie stockte, ihre Züge verhärteten sich.
„Du hast getan, was du konntest!“, tröstete sie ihre Mutter. Philippine schüttelte den Kopf.
„Hingegen war der Junge nett zu ihr. Aber litt unter der Arbeit in der Ziegelfabrik. Und zu Hause fühlte er sich auch nicht wohl. Beide hatten das Leben hier satt.“
„Na, und da haut man so einfach mir nichts dir nichts ab, was? Wenn es aber nun mal so ist, hat sie vielleicht ihr Glück gefunden und du brauchst nicht mehr weiter zu suchen.“
Philippine hob skeptisch die Schultern. Unwillkürlich streifte ihr Blick zum Himmel, dann über das weiter Feld. Sie seufzte:
„Ach Mutter, wenn du nur Recht hast. Ruhe dich noch etwas aus. Ich will noch einmal ganz durch den Wald und zurück an einem Stück galoppieren. Es ist ein wunderbares Gefühl und Vraem ist leicht wie eine Feder. Mit ihr wachsen mir Flügel.“
Lea war zufrieden. So konnte sie noch ein Weilchen vor sich hin dösen. Sie ließ sich wieder ins Gras sinken und ihre Gedanken in die Vergangenheit reisen. In den Sommer des Jahres 1773. Wie heute war sie auch damals hinaus gelaufen, hatte sich ins Gras geschmiegt, ihre Kleider gelockert, ihre Bluse geöffnet und ihre Brüste von der Sonne wärmen lassen. Und plötzlich hatte sie Pferdegetrappel gehört. Sie erschrak, als sie den Mann heranpreschen sah und bedeckte rasch ihre Blöße. Als er sie entdeckte, machte er abrupt Halt, wobei sich sein Pferd auf die Hinterhufe stellte. Im ersten Moment fürchtete sie sich vor dem Fremden, denn mit herrischer Miene wollte er wissen, wer sie sei und warum sie am helllichten Tage faul im Schatten läge, statt zu arbeiten wie andere Frauen.
Auf seine Worte hin stand Lea auf und ging auf ihn zu. Der Reiter war vermutlich etwas älter als sie, aber noch jung genug, um ihr zu gefallen. Sein dichtes Haar fiel locker auf das helle Hemd, über das er eine Weste gestreift hatte. Er trug die Hosen der feinen Leute und Seidenstrümpfe. Lea wusste um ihre Anziehungskraft. Die sechs Geburten hatten weder ihr prachtvolles Haar noch ihre Körperformen beeinträchtigt.
Sie hatte zwar vier Zähne verloren, doch das war kaum zu sehen. Ihre vollen Lippen lenkten davon ab. Und weil sie um ihre Wirkung wusste, war sie ehrlich. Sie sagte dem Reiter, dass sie alleine sei und es ihr an liebevoller Zuwendung fehle. Deshalb flüchte sie oft in die freie Natur, die nach Blumen und Gräser rieche. Hier, auf diesem Hügel verborgen zwischen den Birken, küsse würzige Luft ihr Haar, streichle der Wind ihre heißen Wangen und rasch würde sie sich besser fühlen. Sie sei die Geliebte des Windes, hatte sie gescherzt. „Der Wind verrichtet seine Arbeit nur halb“, hatte der Fremde geantwortet und war abgestiegen. Es war der schönste Tag in ihrem Leben. Und dieser Tag zog sich in die Länge. Er dauerte einen Sommer, denn der Fremde schien Gefallen an ihr zu finden. Erst als die Temperaturen kühler wurden, blieb er fort. Lea sah ihn nur einmal wieder. Er hingegen beachtete sie nicht. In Begleitung eines bedeutenden Mannes aus der Gironde machte er Halt an der Poststation von Saint-Ouen und hatte keine Augen für seine Umgebung.
Der Herbst kam, da fühlte sie Leben in ihrem Bauch. Bis heute hatte sie den Fremden nicht vergessen können.
„Mutter, wach auf, ich bin zurück!“
Lea hatte tatsächlich die Augen geschlossen, um das Bild ihres einstigen Liebhabers im Geiste festzuhalten.
„Lass uns zu Hause sein, ehe Vater kommt, Mutter!“
Auf dem Rückweg trottete Lea melancholisch gestimmt neben den beiden her. Philippine hatte die Zügel gelockert und den Kopf an Vraems Hals geschmiegt. Schweigend gingen sie eine Weile durch den Wald, die Tochter ließ sich wie auf einer Welle treiben, die Mutter dachte an den geheimnisvollen Reiter. Der Wunsch, ihn irgendwann wiederzusehen, erwachte von Neuem. Vielleicht lebte er mittlerweile in Paris, und es war durchaus möglich, ihm zu begegnen. Aber dazu brauchte sie feine Kleider, schöne Stiefel, Hüte, eine Dienerin und eventuell eine Kutsche. Ganz unrealistisch war die Erfüllung ihres Wunsches nicht, denn allmählich klingelte es in ihrer Kasse. Es war eine ihrer besten Ideen gewesen, Frieda zur Hure zu machen.
*
In dieser Zeit machte ein Bauer des Nachbardorfes eine grässliche Entdeckung im Weiher. Das schwimmende Haar mit Schilfpflanzen verwoben, den leblosen Körper von Blättern und Wasserlilien umspült und im trüben Wasser kaum zu erkennen, fand er ein totes Mädchen auf jener Uferseite, die durch den morastigen Boden kaum zugänglich war. Als die örtlichen Wachhabenden den Leichnam herausfischten, gingen sie davon aus, das Mädchen sei ertrunken, weil es sich zu weit ins Moor vorgewagt hatte und hielten sich nicht lange mit Spurensicherung auf. Sie erinnerten sich an Karls Vermisstenanzeige und benachrichtigen ihn. Der Bote an der Tür sagte dem Folterer, er müsse ins Leichenschauhaus kommen, um die Leiche eines Mädchens zu identifizieren. Karl war zu dem Zeitpunkt alleine zu Hause und wusste nicht so recht, wie er mit der schrecklichen Nachricht umgehen sollte.
„Ich glaub dir kein Wort!“, schrie er den Boten an. „Die Kleine lebt. Wir werden sie finden.“
„Komm in die Morgue, dann wirst du mehr erfahren.“
Karl schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Eine Weile starrte er auf das Holz. Er konnte es nicht fassen. Er wollte es nicht. Und diesen Gang durch die Morgue, um entstellte Körper anzustieren, würde er nicht überstehen. Zumindest nicht alleine. Er schauderte bei dem Gedanken. Viele hässlich zugerichtete Leichname hatte er in seinem Leben gesehen, aber niemals den eines Menschen, den er liebte. Und er hatte Alberta geliebt. Vielleicht mehr als die anderen. Mehr als Frieda und Rosel. Mehr als Philippine, das Lieblingskind seiner Schlampe von Frau. Alberta war schüchtern und leise. Sie wollte niemandem zur Last fallen. Ihre Schritte waren die eines Vogels. Ihre Berührung zart und flüchtig. Oh, verdammt, sie hatte schrumpelige Hände aber ihn hatten sie nicht gestört, denn er sah ihr in die Augen. Alberta hatte schöne Augen. Große, traurige, sanfte Augen.
Jetzt sollten sie leer, gebrochen, tot sein?. Diese schönen, traurigen Augen würden ihn niemals mehr fragend ansehen? Warum hatte er sich den Fragen in Albertas Augen nie gestellt? Warum? Weil er letztendlich ein Feigling war. Darum! Plötzlich musste er weinen. Er, der hartgesottene Folterer, wurde von einem heftigen Schluchzen geschüttelt.
Zusammengesunken fand ihn Philippine eine Stunde später. Sie hatte Vraem in den Stall gebracht, sie gebürstet, ihr Hafer und Wasser hingestellt.
„Du brauchst nicht mehr zu suchen!“, wimmerte er, als sie eintrat und erschrocken nach seinem Befinden fragte. „Man hat sie gefunden. Im Moor.“
„Nein!“, sagte sie nur, dann stützte sie sich am Türrahmen ab. „Du sagst, man hat sie gefunden. Aber woher wissen sie, dass es Alberta ist?“
„Ja! Woher wissen sie es eigentlich?“ Ein zaghafter Hoffnungsschimmer erhellte Karls Gesicht. „Wir müssen es feststellen. Begleitest du mich?“
*
Geruch nach ausgewässertem Fleisch schlug ihnen entgegen und die Haare stellten sich ihnen auf. Sie näherten sich der Glaswand, die die Toten von den Lebenden trennte. Auf schmutzig grauen Steinfliesen lagen die nackten Körper teilweise unbeschädigt, teilweise von der Fäulnis zernagt. Bei manchen hing das Fleisch in Lappen vom Gesicht und die Knochen bohrten sich durch die Haut. Entsetzt tasteten sich Vater und Tochter weiter. Sie suchten nach den frisch Ertrunkenen und der Aufseher führte sie zu einer Fuhre Leichname, welche in den letzten Tagen eingetroffen waren. Vom Wasser aufgedunsen schimmerten sie bläulich, ähnelten ihre Bäuche aufgeblasenen Ballons und waren die Schenkel zur doppelten Stärke angeschwollen. Während sich Karl Mund, Nase und zum Teil die Augen zuhielt, starrte Philippine mit blassem Gesicht und geweiteten Augen durch die Scheibe. Sie zeigte keinen Ekel, wankte nicht und ihre Stimme klang fest, beinahe nüchtern, als sie sagte: „Dort liegt sie, Vater!“
Sie wies in die Richtung, in der sie Alberta auf den kalten Fliesen entdeckte hatte und ging weiter. Schleppend folgte ihr Karl. Er wagte kaum hinzusehen. Doch Philippine rüttelte ihn, zwang ihn, die Augen zu öffnen. Die Tote hatte den Kopf zur Seite geneigt als ruhe sie. Die Lider gesenkt, die Lippen sanft geschlossen, das Gesicht von einem blassen Lächeln erhellt, schien sie zu schlafen. Ihr nackter Körper sah fast unversehrt aus.
„Sie ist schön!“, sagte Philippine ruhig. Ihr Ausdruck war gefasst, unerschütterlich, als wäre sie innerlich unbeteiligt. „Und sie ist dort gut aufgehoben, wo sie jetzt ist. Gott hat seine Hand über sie gehalten und ihren Körper geschützt. So wie er auch ihre Seele schützte, in dem er sie zu sich nahm. Bei uns wäre sie zugrunde gegangen.“
Karl ließ den Arm herunterfallen und starrte das Mädchen verwundert an.
„Weil sie in der Familie eines Folterknechtes lebte?“
„Nicht allein!“ Philippine legte ihre Hand auf seinen Arm. „Du bist ein grober Mensch, Vater. Deine Seele ist verroht, Mutter und Frieda hingegen scheinen ihre Seelen verloren zu haben. Sie sind bedrohlich und flößen mir Schauder ein. Manchmal, wenn ich mit ihnen allein in einem Zimmer bin, bekomme ich eine Gänsehaut.“
„Du bist sonderbar!“ Karl hielt sich wieder die Hand vor den Mund und nuschelte: „Deine Mutter liebt dich mehr als alles andere, tut alles für dich, kratzt jeden Pfennig für dich zusammen, damit du es mal besser haben sollst. Ja, ich weiß, sie ist eine Schlampe, aber sie liebt dich. Warum also redest du schlecht von ihr?“
Philippine zuckte die Achseln.
„Weißt du etwas von den beiden, das ich nicht weiß? Ist sie mehr als eine Schlampe?“ In seinen Augen blitzte Argwohn. Ohne das geringste Zögern verneinte Philippine die Frage. Karl glaubte ihr. Er blickte in ihre schimmernden Augen, die auch im hässlichen Licht der Morgue nichts von ihrer Klarheit verloren.
Der Aufseher wies ihnen das Büro, in dem sie ihre Namen nannten und Zeugnis davon ablegten, dass Alberta ihrer Familie angehörte. Karl wurde eine Vollmacht ausgehändigt, die ihm erlaubte, den Leichnam seiner Tochter mit nach Hause zu nehmen.
Alberta landete nicht auf dem Schindanger. Sie bekam ein schlichtes Grab auf dem Friedhof von Saint-Ouen. Lea weinte echte Tränen, indes Frieda wie betäubt in die Ferne starrte.