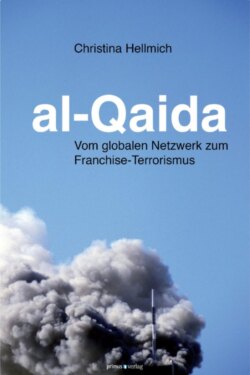Читать книгу al-Qaida - Christina Hellmich - Страница 7
I. Der 11. September und die bange Suche nach Antworten
ОглавлениеAm 23. Februar 1998 sprachen Osama Bin Laden und seine Verbündeten ein islamisches Rechtsgutachten (Fatwa) aus, das alle Muslime dazu aufrief, Amerikaner – ob Zivilisten oder Soldaten – wo immer möglich zu töten, um so die Al-Aksa-Moschee und die Heilige Moschee zu befreien und die US-Truppen aus allen Gebieten des Islam zu vertreiben, bis sie besiegt oder unfähig seien, einen einzigen Muslim zu bedrohen. Dreieinhalb Jahre später, am Morgen des 11. September 2001, demonstrierte al-Qaida das wahre Ausmaß ihrer Drohung und die perfekte Umsetzung ihrer Methoden, als sie das größte terroristische Gräuel verübte, das die Welt jemals gesehen hatte: Zum ersten Mal in der Geschichte kidnappten transnationale Terror-Teams – in dem Wahn, den Islam zu verteidigen – vier Flugzeuge und nutzten sie als fliegende Selbstmordbomben. Zwei wurden in die bekannten Zwillingstürme des World Trade Center in New York gelenkt, eins in das Pentagon; das vierte stürzte außerhalb von Pittsburgh ab, nachdem die Passagiere versucht hatten, das Flugzeug wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Was danach kam, ist Geschichte.
Al-Qaida, die erste globale Terrorgruppe des 21. Jahrhunderts, verkörpert das mysteriöse neue Gesicht des globalen Terrorismus. Seit dem bislang verheerendsten terroristischen Akt am 11. September 2001 beherrscht die Organisation die Diskussionen über nationale und internationale Sicherheit in Medien, Wissenschaft und Politik. Wer tut so etwas, und warum? Zehn Jahre nach Beginn des globalen Krieges gegen den Terror würde man klare Antworten auf diese elementaren, wenngleich entscheidenden Fragen erwarten. Doch obwohl nur wenige Themen eine grundsätzlichere Debatte ausgelöst haben als Erklärungen für die Beweggründe und Anziehungskraft von spektakulären Massenmorden im Namen des Islam, grassieren Spekulationen über Stärke und Ausmaß von al-Qaida noch immer. Verwirrende Beschreibungen eines undurchsichtigen Netzwerks und verdeckter terroristischer Zellen werden von den Massenmedien gierig aufgegriffen und verbreitet; Nachrichten über neuerliche Festnahmen mutmaßlicher Terroristen sowie eindringliche Warnungen vor akuten Gefahren erzeugen weiter Alarmbereitschaft, bringen jedoch wenig Klärung; unterdessen sind erhöhte Sicherheitsstufen und bislang beispiellose Reisebeschränkungen in der Welt nach dem 11. September zum normalen Alltag geworden.
Die Bedrohung durch den so genannten ‚islamistischen‘ Terror beherrscht unübersehbar das kollektive Bewusstsein der westlichen Welt: Eine kurze Google-Recherche zum Begriff ‚al-Qaida‘ liefert über 12 Millionen Links zu Artikeln, Interviews, Büchern und Kommentaren in den unterschiedlichsten Sprachen. Ein genauerer Blick auf die vorhandene Literatur zum Thema wirft jedoch mehr Fragen auf, als er Antworten liefert. Ist al-Qaida eine in sich geschlossene Organisation, ein globales Netzwerk semi-unabhängiger Zellen, ein Franchising oder einfach nur eine Idee, die den Nerv der Zeit trifft? War Osama Bin Laden Ingenieur, Absolvent einer Wirtschaftshochschule, Playboy oder Studienabbrecher? Was meint das Gerede über den ‚globalen salafistischen Dschihad‘ gegen den Westen? Bei genauerer Betrachtung versinken die ‚Tatsachen‘ über die Terrorgruppe, deren Name auf ewig in die Skyline von Manhattan eingebrannt ist, nur allzu schnell in einem Meer von Behauptungen, die sachlicher Grundlage entbehren.
Woran liegt das? Wie kann ein Thema von solcher Wichtigkeit von so viel Ungewissheit geprägt sein? Ein erster Versuch, das diffuse Bild der bis heute berüchtigtsten Terrororganisation zu erklären, beginnt zwangsläufig mit einer genaueren Untersuchung des Informationsstandes vor dem 11. September und der unmittelbar danach einsetzenden Flut von Literatur. In den 1990er-Jahren beschäftigte sich nur eine Handvoll Forscher mit dem, was sich als eines der am breitesten diskutierten Sicherheitsthemen der kommenden Jahre erweisen sollte. So verblüffend es aus der Rückschau auch sein mag – die Welt wurde von der spektakulären Zerstörung der Zwillingstürme vor einem strahlend blauen Septemberhimmel schlicht überrumpelt: Weder Terrorismus-Experten noch Sicherheitsspezialisten noch Wissenschaftler hatten einen Anschlag solchen Ausmaßes vorhergesehen.1 Wie Magnus Ranstorp in seiner umfassenden Besprechung von Literatur zur Terrorismusforschung treffend feststellt, war die Forschung zu al-Qaida vor dem 11. September 2001 ‚außerordentlich beschränkt‘.2
Verständlicherweise haben die Ereignisse des 11. September, die zugleich der spektakulärste Propagandafall aller Zeiten waren, daher ein Wechselbad an Ungewissheit, Angst und Spekulationen ausgelöst; die offensichtlichsten und drängendsten Fragen blieben dennoch unbeantwortet: Wer tut so etwas, und warum? Überzeugende Antworten blieb man schuldig. Erstaunlicherweise wurden die spektakulären Bilder der Zerstörung in der ersten Zeit nach dem Anschlag wieder und wieder verbreitet; sie brannten die Realität dessen, was buchstäblich aus heiterem Himmel gekommen war, in das Bewusstsein all jener ein, die sich dem Zugriff der Medien nicht entziehen konnten. Zugleich fanden Texte – Analysen und Erläuterungen der Geschehnisse – kaum oder keine Beachtung. Dass es deutlich mehr reißerische als analytische Darstellungen gab, war jedoch kein Akt von Medienpropaganda oder gar, wie manche behaupten, eine Art Regierungsverschwörung. Vielmehr war die unausweichliche Präsenz jener grauenhaften Bilder in unseren Zeitungen und auf unseren Fernsehschirmen nur der sichtbare Beweis dafür, dass sich die fassungslose westliche Welt immer mehr mit Fragen konfrontiert sah, auf die es seinerzeit keine Antworten gab. Auf die Gefahr hin, das Thema nur noch reißerischer darzustellen, könnte man sagen, dass der 11. September ein unbeschriebenes Blatt war, auf dem die Biographie von al-Qaida nun zu schreiben war.
Eben weil die Umstände nach dem 11. September 2001 so verwirrend und dringlich waren, wurde blindlings versucht, das von Ground Zero hinterlassene Vakuum mit Antworten zu füllen. Die Kritikfähigkeit setzte auf breiter Front aus, während Kommentatoren sich kopfüber darauf stürzten, Erklärungen zu liefern. Entsprechend galt die größte Aufmerksamkeit jenen, die am lautesten schrien und die die eingängigsten, wenn auch nicht die überlegtesten Antworten zu geben schienen. Fast über Nacht wurden Journalisten zu den maßgeblichen Kommentatoren auf dem Gebiet – nicht etwa, weil sie über bessere Kenntnisse verfügten, sondern weil ihre Worte und Analysen der Situation die meisten Menschen als erste erreichten. Im Gegenzug gaben einige Analysten – insbesondere jene, die bald als Experten gelten sollten – auf der Basis dessen, was sie auf CNN, in der New York Times und Fox News mitbekommen hatten, ‚Tatsachen‘ über al-Qaida, den wahren Charakter des Islam und die Bedeutung des Dschihad von sich. Sie sprachen von al-Qaidas Vision einer Fantasiewelt, die von religiösen Fanatikern, Heuchlern und Verrückten ausgehe. Manche behaupteten, al-Qaida sei frei von jeder Ideologie, während andere die Ursprünge von Osama Bin Ladens Ideen in islamischen Gelehrten wie Taqi ad-Din Ahmad Ibn Taymiyyah (gest. 1328), Muhammad Ibn Abd al-Wahhab (gest. 1792) oder Jamal al-Din al-Afghani (gest.1897) ausmachten; dabei hatten sie sich weder mit den Botschaften Bin Ladens noch mit den Schriften derjenigen, die ihn angeblich beeinflusst haben sollten, eingehender auseinandergesetzt.3 Es spielte keine Rolle, dass viele der populären Geschichten über den ‚globalen Dschihadismus‘ von Personen stammten, die sich auf dem Gebiet kaum auskannten, sich auf frag würdige Quellen stützten und die üblichen wissenschaftlichen Methoden, ja sogar kritisches Denken über Bord warfen. Mit Beginn des uneingeschränkten weltweiten Krieges gegen den Terror, in dem Freiheit und Demokratie ihrem schlimmsten Feind gegenüberstanden – und in dem man eindeutig und kompromisslos für ‚uns‘ oder ‚sie‘ Position beziehen musste4 – wurden Bedenken über wissenschaftliche Seriosität und Methodik, Einwürfe, Differenzierungen und Verweise auf den größeren Kontext meist ausgeblendet und erhielten nicht die nötige Aufmerksamkeit. Marc Sageman weist zu Recht darauf hin, dass sich die meisten frühen Erklärungsversuche von al-Qaida auf wenig mehr belaufen als ‚Argumente, mit denen man politisch punkten konnte, die jedoch in einer wissenschaftlichen Studie fehl am Platze sind‘.5 Angst und überzogene Reaktionen sind geschichtlich gesehen noch nie die beste Grundlage für rationale Überlegungen, Reflektionen und Debatten gewesen, und der 11. September und die unkritische ‚kill and capture‘-Strategie, bei der mehr das Töten als die Festnahme im Vordergrund stand, bilden hierbei keine Ausnahme. So gesehen sind weder die heftige Reaktion des Westens noch das anhaltende reaktionäre Klima überraschend, galten die Anschläge doch als neue Art von Terrorismus mit beispiellosem Ausmaß an Gewalt und Zerstörung und globaler Reichweite.
Um die Kontroverse um al-Qaida vollständig zu erklären, empfiehlt sich ein Blick über die unmittelbaren Umstände des 11. September hinaus auf den Stand der Terrorismusforschung und ihren Untersuchungsgegenstand – den Terrorismus als solchen. In den dreißig Jahren vor den Anschlägen des 11. September spielte die Terrorismusforschung innerhalb der Sozialwissenschaften eine eher marginale Rolle: Nur wenige Forscher gaben Bewertungen zu Terroranschlägen ab, die zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen geographischen und sozio-kulturellen Kontexten stattgefunden hatten. Das Gros der Fachliteratur widmete sich einzelnen terroristischen Anschlägen und wurde – was angesichts der Erfahrungen nach dem 11. September vielleicht nicht weiter überrascht – von Autoren verfasst, die keine oder nur geringe Hintergrundkenntnisse beziehungsweise Fachkompetenz besaßen.6 In Zahlen gefasst wurden von den 490 Artikeln, die in den beiden wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschriften zum Terrorismus – Studies in Conflict and Terrorism und Terrorism and Political Violence – zwischen 1990 und 1999 erschienen, insgesamt 406 (83 Prozent) von Autoren verfasst, die danach keine weiteren Beiträge publizierten.7 Eine derartige Forschungslage ist mit zahlreichen Mängeln behaftet: Den Analysen einzelner Autoren mangelte es an stringenter Argumentation und entsprechendem theoretischen Rahmen, es fehlten zuverlässiges Datenmaterial und geeignete Untersuchungsmethoden. Viele Artikel versuchten, die Ursachen von Terrorismus zu identifizieren und die Entwicklung und Dynamik verschiedener Terrorgruppen zu erfassen; bezeichnenderweise beschäftigten sich die Autoren jedoch meist mit Ereignissen aus der jüngsten Vergangenheit und waren nicht in der Lage, diese in einen breiteren Kontext einzuordnen. Gaben sie Einschätzungen der künftigen Sicherheitsrisiken ab, ließen sie die Beweggründe der Terroristen meist unberücksichtigt, und bei Strategien zur Terrorbekämpfung tendierten sie zu Einzelfall-Lösungen statt zu langfristiger Planung. So entstand das, was Martha Crenshaws als ‚Konstruktion allgemeiner Kategorien terroristischer Akteure, die ungleiche Motivationen, Organisationen, Ressourcen und Kontexte in einen Topf werfen‘, beschrieben hat.8 Die – von der US-Regierung formulierte – mittlerweile berüchtigte Verbindung von al-Qaida zur Hamas, zu den Schia-Schulen in Qum, zu den islamischen Hardlinern der traditionalistischen Deobandi-Seminare im Norden Pakistans und zu den säkularen, arabisch-nationalistischen Regimen der Baath-Partei ist nur ein aktuelles Beispiel für ein seit langem bestehendes Problem der Disziplin.9 ‚Das Gros der Literatur [zum Thema Terrorismus],‘ beklagte Ted Gurr 1988, ‚besteht aus naiver Beschreibung, spekulativem Kommentar und Rezepten für den Umgang mit Terrorismus, die noch nicht einmal minimalen Forschungsstandards in den etablierteren Feldern der Konflikt- und Politikforschung entsprechen.‘10
Die gleichen methodologischen Mängel traten in der Literatur nach dem 11. September auf. Obwohl in dem Jahr nach den Ereignissen eine Rekordzahl an Büchern zum Thema Terrorismus erschien, deutet wenig darauf hin, dass sich das Gesamtbild substanziell verändert hätte. Magnus Ranstorp weist in seiner Untersuchung zum Stand der Terrorismusforschung nach dem 11. September auf einen besorgniserregenden Trend hin; dieser ziehe nicht nur den Ruf des Faches weiter in Mitleidenschaft, sondern – und dies wiegt angesichts des hier untersuchten Themas noch schwerer – verschleiere unser Wissen über al-Qaida beziehungsweise erzeuge dieses scheinbare Wissen überhaupt erst. Da es, anders als bei wissenschaftlichen Beiträgen normalerweise üblich, keinerlei Qualitätskontrolle gab, hat die Suche nach Antworten Pseudo-Wissenschaftlern und bisweilen ausgemachten Betrügern, die sich als Experten ausgeben, einen idealen Nährboden bereitet. Viele behaupten, sie hätten bevorzugten Zugang zu Informationen, oft aus vermeintlich ‚geheimen‘ Quellen; bei näherer Untersuchung erweisen sich diese dann allerdings als nichtverifizierbar, nicht zuverlässig oder nicht existent.
Eins der ungeheuerlichsten Beispiele ist der Fall Alexis Debat, eines ehemaligen Journalisten, der es zu angesehenen Positionen als Direktor des ‚Terrorism and National Security Program‘ am Nixon Center in Washington und als Herausgeber von The National Interest brachte – all dies auf der Basis einer vorgetäuschten Promotion an der Pariser Sorbonne und falschen Angaben zu seinem beruflichen Werdegang, seinen Erfahrungen und Kompetenzen.11 Sein Fall ist leider keine Ausnahme. Viele der so genannten ‚Experten‘, die in Wirklichkeit kaum oder keine fundierten Kenntnisse über al-Qaida besitzen, sind zufällig genau jene, auf deren Meinungen man sich größtenteils stützt, die in öffentlichen Diskussionen zitiert werden und deren Beiträge auf dem Gebiet einen signifikanten Teil unserer ‚Geheiminformationen‘ über die Organisation ausmachen. Ein typisches Beispiel ist das von Evan Kohlmann, dem Autor von Al-Qaeda’s Jihad in Europe: The Afghan–Bosnian Network; ohne irgendeine ersichtliche Fachkenntnis – abgesehen von einem Abschluss in Rechtswissenschaften und einem Praktikum – stieg er zu einem der führenden Experten über islamistischen Terror in Medien und Regierungskreisen auf. Obwohl er seine ‚Sachkenntnis‘ anscheinend vor allem aus Internetquellen bezog, hinderte ihn das nicht daran, Berater des amerikanischen Verteidigungsministeriums, des Justizministeriums, des FBI, des britischen Crown Prosecution Service und der Spezialeinheit SO15, dem Kommando zur Terrorismusbekämpfung von Scotland Yard, zu werden.12 Das wahre Ausmaß seiner ‚Sachkenntnis‘ zeigte sich während des Prozesses Vereinigte Staaten vs. Haref und Hossein, bei dem er als Sachverständiger für die islamistische Partei Jamaat-e-Islami aus Bangladesch, die älteste religiöse Partei Pakistans, auftrat:
Im Kreuzverhör stellte sich heraus, dass [Kohlmann] nie auch nur einen einzigen Aufsatz über die Partei verfasst hatte und nie zur Gruppe befragt worden war. Er war noch nie in Bangladesch gewesen und konnte weder den Namen des Premierministers von Bangladesch noch den Namen des Führers der Jamaat-e-Islami nennen.13
2008 sagte Kohlmann als Zeuge vor der ersten Militärkommission in Guantánamo im Prozess gegen Bin Ladens Chauffeur aus. Das Büro der Militärkommission (OMC), so behauptete er, habe ihn gebeten, ein 90-minütiges Video über die Entwicklung von al-Qaida zu drehen. Kohlmann, der 45.000 Dollar für Film und Zeugenaussage erhalten hatte, gab vor dem OMC zu, dass er
den geplanten Titel des Films von ‚Rise of al-Qaeda‘ (,Al-Qaidas Aufstieg‘) zu ‚The al-Qaeda Plan‘ abgeändert hat, um stärkere Parallelen zu ‚The Nazi Plan‘ zu ziehen, einem berühmten Dokumentarfilm, der während der Nürnberger Prozesse gedreht wurde.14
Wer sich auf solch fragwürdige Expertise verlässt, untergräbt die Glaubwürdigkeit der Verfahren. Doch trotz seiner Vorgeschichte beeinflussen Kohlmanns Thesen in Terrorismusforschung und Sicherheitskreisen weiterhin die Debatten über al-Qaida: Sein jüngster Aufsatz mit dem Titel ‚Al-Qa’ida’s Yemeni Expatriate Faction in Pakistan‘, der auf Informationen aus dubiosen Internetquellen zu beruhen scheint, nahm in der Ausgabe der CTC Sentinel vom Januar 2011, der Zeitschrift von ‚The Combating Terrorism Center‘ der amerikanischen Militärakademie in West Point, einen zentralen Platz ein.15
Beschäftigt man sich eingehender mit dem Stand der Wissenschaft, dann ist einer der ersten und bekanntesten al-Qaida-Experten Rohan Gunaratna. Gunaratna verfasste mit Inside Al Qaeda eins der ersten und – wie die folgenden Kapitel zeigen werden – am häufigsten gelesenen und zitierten Bücher, das Entstehung, Charakter und Innenleben der Gruppe beleuchten will. Bedauernswerterweise beruhen viele der Sachverhalte in diesem Buch auf Quellen, die geheim sind und nicht verifiziert oder belegt werden können; das Buch stützt sich außerdem auf Interviews mit Terroristen, die nach Aussagen des Autors im Jemen, Libanon, Ägypten und Saudi-Arabien geführt worden seien – Länder, in denen er, wie er später einräumen musste, nie gewesen ist und deren Sprachen er nicht spricht.16 Als er 2007 als Hauptbelastungszeuge im Prozess Vereinigte Staaten vs. Hassoun Jayyousi und Jose Padilla auftrat und von Strafverteidigern gezielt danach gefragt wurde, bejahte Gunaratna ausdrücklich die Aussage, dass ‚etliche Quellen in Ihrem Buch nur von anderen Behörden überprüft werden können, wenn diese Insider-Informationen von Ihnen erhalten.‘17 Was Gunaratnas Aussage für Prozesse in Zusammenhang mit al-Qaida bedeutet, sollte man auch heute noch im Kopf behalten. Es ist gelinde gesagt überraschend, dass man sich in so hohem Maße auf ihn verließ, wenn man bedenkt, dass seine Sachkenntnis schon 2003 in Frage gestellt wurde. Damals beschrieb ihn der britische Observer als ‚den wahrscheinlich am wenigsten vertrauenswürdigen al-Qaida-Experten‘.18
Insgesamt sind diese Einzelpersonen nur einige Beispiele für die vielen Kommentatoren, deren Sachkenntnis heute als fragwürdig gilt, deren Aussagen aber nichtsdestotrotz kritiklos hingenommen worden sind und die unser Verständnis – beziehungsweise Missverständnis – von al-Qaida geprägt haben. Im großen Ganzen machen sie nur einen Bruchteil der infamsten Behauptungen und nicht stichhaltigen Aussagen aus, doch genau diese Äußerungen werden später zitiert, ja sie gelten oft als wichtigste Beweisquelle in Publikationen über al-Qaida wie dem Untersuchungsbericht zu den Terroranschlägen des 11. September The 9/11 Commission Report: The Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States19 und Marc Sagemans Understanding Terror Networks.20 Kraft Wiederholung haben sich viele der Behauptungen, die von Anfang an von fragwürdigem Wert waren, als Fakten festgeschrieben. In der Literatur zur Terrorismusforschung besteht ein kapitales methodologisches Problem, das Edna Reid 1997 als das ‚zirkulärer Forschungssysteme‘ bezeichnet hat.21 Diese Systeme entstehen in Form eines ‚Feedback-Loops‘, der sich beständig verstärkt, weil Autoren sich unkritisch aufeinander verlassen und ihre Werke gegenseitig zitieren. Der Zirkel hat sich nach dem 11. September zweifelsohne fortgesetzt und verdeutlicht so das fundamentale Problem, das sich in jeder Diskussion über al-Qaida stellt: wie die Fakten von der Fiktion unterscheiden? Wird eine Aussage wahr, nur weil wir sie x Mal gehört haben?
Natürlich leiden die Terrorismusforschung im Allgemeinen und das Gros der Fachliteratur über al-Qaida im Besonderen unter zahlreichen Problemen, was die Beschaffung zuverlässiger Informationen angeht; die Problematik verkompliziert sich noch aufgrund von Schwierigkeiten, die sich bei der Definition des Untersuchungsgegenstands – des Terrorismus als solchen – ergeben. Die Literatur zur regulären (oder, wie Miller und Mills es nennen, ‚orthodoxen‘)22 Terrorismusforschung geht davon aus, dass Terrorismus nicht die Normalität und letztlich zum Scheitern verurteilt ist; diese stillschweigend vorausgesetzte Prämisse ist jedoch aus dem Blickfeld geraten, weil sich die Forschungsliteratur auf scheinbar drängendere Themen konzentriert hat und etwa besonders gewaltsame Zwischenfälle, ihre Ursachen sowie Strategien für die Vorhersage und Reaktion auf künftige Bedrohungen zu erklären sucht. Die Frage, wie dem Terrorismus ein Ende bereitet werden kann, war und ist eine Kernfrage, die ebenso viele Debatten beschäftigt wie die staatliche Finanzierung von Terrorismus. Man könnte einwenden, dass es doch signifikante (wenngleich erfolglose) Bemühungen gegeben hat, eine akzeptable Definition für den Terrorismus zu finden und dass wir uns angesichts fortdauernder Meinungsverschiedenheiten mit einem gewissen Maß an Unschärfe abfinden müssen. Letztlich, so die verbreitete Devise – die jedoch keineswegs unproblematisch ist – wissen wir schon, was Terrorismus ist, wenn wir ihm begegnen: Terrorismus, so heißt es, ist die vorsätzliche – oder drohende – Anwendung von Gewalt gegen Zivilisten durch nicht-staatliche Akteure, die politische Ziele verfolgen; dies ist in der heutigen Welt häufig mit dem Einsatz von Bomben und anderen Waffen verbunden, die sich auf den öffentlichen Raum, Flugzeuge oder andere Verkehrsmittel richten. Diese Definition, die nicht abschließend ist und erweitert werden kann, verdeutlicht, wie sehr die landläufige Auffassung von Terrorismus von den jüngsten Erfahrungen geprägt ist und wie sehr sie Terrorismus außerhalb des historischen Kontinuums verortet.23 Es ist eine Arbeitsdefinition, die ihre Schwächen hat und keineswegs allgemein anerkannt ist; dennoch kann sie dazu beitragen, zumindest einen Diskussionsrahmen für das Phänomen zu schaffen.
Abstrakter gesagt ist allein die Suche nach einer Definition, und sei es nur einer Arbeitsdefinition, von vorneherein Ausdruck eines grundsätzlich liberalen Verständnisses von politischer Ordnung und staatlicher Souveränität, in dessen Rahmen der Staat als legitimer Schiedsrichter gilt, der zwischen den rivalisierenden Interessen einzelner Einwohner vermittelt.24 Diesem Verständnis nach unterliegen die Machtverhältnisse und die Anwendung von Gewalt besonderen Regeln, und ein Akt unbefugter Gewalt durch einen nicht-staatlichen Akteur, der die Rechtmäßigkeit der bestehenden Ordnung in Frage stellt, ist nicht hinnehmbar. Die Legitimität des liberalen Staates kann nicht in Frage gestellt werden, weil sie von einem Sozialvertrag in gegenseitigem Einvernehmen ausgeht. Terroristen und Terrorismus agieren daher außerhalb der bestehenden Spielregeln und müssen um jeden Preis bezwungen werden, sofern der globale Krieg gegen den Terror ein Indikator dafür ist, wie sehr der liberale Staat Terrorismus für nicht hinnehmbar hält. Das Gros der regulären Terrorismusforschung fühlt sich mit anderen Worten nicht nur ideologisch der Macht des westlichen Staates verpflichtet, sondern unterstützt diese auch praktisch. Miller und Mills haben detailliert dargelegt, dass ‚die in der orthodoxen Terrorismusforschung herausragenden Ideen, und häufig sogar die Theoretiker selbst, stark der Doktrin und Praxis der Aufstandsbekämpfung verhaftet sind.‘25 Die Konsequenz daraus hat James Der Derian so formuliert: ‚um offiziellen Zugang zur Terrorismusdebatte zu erhalten, muss man kritische Waffen an der Tür abgeben und sich dem Chor der Verdammung anschließen.26 Nach liberalem Staatsverständnis liegt Terrorismus außerhalb der Normalität und muss verurteilt werden; diese Wahrnehmung verhindert jedoch eine einfachere und wohl bedeutsamere Beobachtung: dass nämlich der Terrorismus – und damit auch die Terrorismusbekämpfung, wonach der Terrorist der unrechtmäßige Kombattant und der Terrorbekämpfer der rechtmäßige Krieger ist – im Kern eine gewaltsame Auseinandersetzung um und über politische Legitimität ist. Der springende Punkt ist mit anderen Worten folgender: Wer hat das Recht, im internationalen System Gewalt anzuwenden?
Im Falle al-Qaidas bedeutete die unmittelbare Verdammung der Terroristen und ihrer Taten – so verständlich diese nach dem tragischen Massaker der Zwillingstürme auch gewesen sein mag – dass es zu keiner ernsthaften Auseinandersetzung mit der breiteren Botschaft von Osama Bin Laden gekommen ist. Bis zur Veröffentlichung seiner zentralen öffentlichen Reden, Briefe und Interviews 2005 lagen nur Teile seiner Äußerungen in englischer Übersetzung vor.27 Ähnlich wie die ehemalige First Lady Laura Bush Eltern mahnte, ihre Kinder vor den entsetzlichen Bildern des 11. September zu schützen,28 wurde das erwachsene westliche Publikum zu großen Teilen von der Stimme Bin Ladens abgeschirmt, fast so, als ob das ungehinderte Hören eine Gefahr für das nationale Wohlergehen darstelle. Anstatt seine Äußerungen detailliert und in Gänze zu zitieren, erschienen in westlichen Medien nur Auszüge, in denen vor allem von seinen kontroversen Aufrufen zur Gewalt gegen westliche Ziele die Rede war und die somit nur einen flüchtigen, einseitigen Einblick in sein Denken gaben. Folglich wurde Bin Laden leicht und allzu schnell als bösartiger Wahnsinniger abgetan, dessen Ideen zu radikal waren, als dass man sie hätte ernst nehmen können. Die Ziele von al-Qaida seien, so die weit verbreitete Meinung, so unrealistisch, dass sie keine nähere Beachtung verdienten. Unabhängig von Inhalt oder Kontext löste das, was von Bin Ladens Verlautbarungen verbreitet wurde, jedoch augenblicklich Angst und Schrecken aus. Verkürzt gesagt strebte Bin Laden eine militante islamistische Gruppe an, die westliche Einflüsse beseitigen und den Ruhm der umma (der Gemeinschaft aller Muslime) durch die Wiederherstellung des Kalifat – des panislamischen Staats, der politische und religiöse Macht in einem einzigen Machthaber (dem Kalifen) vereint – in der gesamten islamischen Welt, auch in Europa und der westlichen Welt einschließlich den USA, wiederherstellen sollte. Diese Agenda wird eng in Verbindung gebracht mit einer strikten Absage an westliche Werte und einen westlichen Lebensstil, mit Zwangskonvertierungen und gewaltsamer Islamisierung und dem Ende von Freiheit und Demokratie. Audrey Cronin, Autorin von How Terrorism Ends, bringt es klar zum Ausdruck: ‚Man kann nicht mit einer Terrorgruppe verhandeln, die nicht weniger anstrebt als die vollständige Zerstörung all dessen, was wir sind.‘29 Ihr Argument ist nicht von der Hand zu weisen. Al-Qaida ist nicht die IRA und Osama Bin Laden war nicht Gerry Adams. Es verlangt selbst dem idealistischsten Diplomaten außerordentlich viel Fantasie ab, sich auch nur annähernd so etwas wie ein in Tora Bora oder in den Bergen Pakistans ausgehandeltes Karfreitags-Abkommen vorzustellen. Doch dies ist nur die eine Seite der Medaille.
Gerne wird übersehen, dass Bin Ladens panislamische Ambitionen nie konkret werden: Wie oder durch wen soll die umma regiert werden? Seine Ambitionen bewegen sich also eindeutig im Bereich des Idealen und stellen keinen klar umrissenen Plan, kein klar definiertes Programm dar. Außerdem sind weder die Art der vermeintlichen Bedrohung (panislamische Ziele in unterschiedlichen Ausprägungen) noch übertriebene westliche Reaktionen auf diese Vorstellung und ihre unterschiedlichen Manifestationen neu oder spezifisch für das Auftreten von al-Qaida. Dennoch werden bislang kaum Anstrengungen unternommen, die Ziele und Ideale von Bin Laden In den größeren Kontext der Geschichte des Panislamismus zu stellen und so einen differenzierteren Blick auf die Kernpunkte zu gewinnen. Stattdessen konzentrieren sich viele Untersuchungen in der Terrorismusforschung darauf, die Ursprünge von al-Qaida auf etliche radikale islamische Denker aus früheren Zeiten zurückzuführen. Man mag den analytischen Wert dieses Ansatzes in Frage stellen, der nach den ideologischen Wurzeln eines höchst aktuellen Phänomens im frühen 13., 18. oder 19. Jahrhundert sucht, ganz zu schweigen davon, dass ein solches Vorgehen nicht einmal minimalen geschichtswissenschaftlichen Standards entspricht; doch die Begriffe ‚salafistischer Dschihad‘ und ‚salafistische Dschihadisten‘ schlossen als eigenständige Kategorien eine Lücke im Diskurs der Terrorismusforschung, denn auf ihrer Basis ließen sich Bin Laden und seine Anhänger nun eindeutig identifizieren. So tröstlich es auch sein mag, ein Etikett und eine Definition für den Feind geschaffen zu haben: Der Nutzen des Wortes ‚salafistisch‘ ist rein praktischer Natur und bedeutet keinerlei Erkenntnisgewinn. Was es bedeutet, ein ‚salafistischer Dschihadist‘ oder ein ‚al-Qaida-Mitglied oder -Anhänger‘ zu sein, bleibt letztlich jedem selbst überlassen und stellt kein verlässliches Profil dar, mit Hilfe dessen potentielle Terroristen identifiziert oder überwacht werden könnten.
Dass man Bin Ladens Taten und Ideen an die Randzonen des Islam verbannt hat, hatte noch eine weitere unerwartete Konsequenz: Dies hat jede eingehendere Beschäftigung mit der Frage verhindert, warum gewöhnliche Muslime sich mit seinen Botschaften auf breiter Basis identifizieren. In einem politischen Klima, das klare Bekenntnisse verlangte – ‚entweder bist du für uns oder du bist für die Terroristen‘ – war es nicht möglich, Denken und Handeln zu trennen. Islamische Rechtsgelehrte sind sich weitgehend einig, dass zum Beispiel Selbstmordattentate, das wahllose Töten von Frauen und Kindern oder die Ausweisung der eigenen Glaubensbrüder als ‚Ungläubige‘ (das Aussprechen des takfir) nach der Scharia nicht vertretbar sind und in der Vergangenheit katastrophale Folgen für Gruppen gehabt haben, die dies praktiziert haben.30 Dennoch stoßen die Beweggründe für derartige Aktionen bei vielen auf Anklang. Um die Gewalt im Namen des globalen Dschihad zu rechtfertigen, verweist Bin Laden auf das Leid von Muslimen im Irak und in Palästina, in Kaschmir und Bosnien, das für ihn eine direkte Folge der amerikanischen beziehungsweise westlichen Aggressionspolitik ist. Auch wenn er die Zahl der wirklichen Opfer offensichtlich übertreibt, und auch wenn diese Opfer nicht so eindeutig zuzuordnen sind, wie er es gerne hätte, ist sein Vorwurf nicht von der Hand zu weisen. Ein häufig angeführtes Beispiel ist der ausführlich dokumentierte Tod von 500.000 irakischen Kindern als Folge der Wirtschaftssanktionen nach dem zweiten Golfkrieg 1991.31 Dass die ehemalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright seinerzeit seelenruhig erklärte, die politischen Ziele der USA seien das Opfer einer halben Million irakischer Kinder wert, ist nicht nur in der arabischen Presse oft wiederholt worden;32 die Bemerkung spielt auch in Osama Bin Ladens Äußerungen eine wichtige Rolle, denn auf Rekrutierungsvideos von al-Qaida sind Bilder von irakischen Babys zu sehen, die aufgrund von Unterernährung und fehlender medizinischer Versorgung dahinsiechen.33
Gegen Bin Ladens Darstellung der Ereignisse ließe sich natürlich sofort einwenden, es bestehe ein Unterschied zwischen einem Kollateralschaden, der aus ‚rechtlichen‘ Schritten wie einem Krieg oder Wirtschaftssanktionen entstehe, und dem vorsätzlichen Zielen auf Zivilisten. Ersterer wird als ‚bedauerlich‘ erachtet, letzteres gilt als unannehmbares Gräuel in der zivilisierten Welt. Um dies ganz klar zu sagen: Es ist nicht meine Intention, ‚Terrorismus‘ oder die Anwendung von Gewalt zur Lösung von ansonsten legitimen Konflikten gutzuheißen. Mein Ziel ist vielmehr, eine andere Sicht aufzuzeigen, die über die instinktive Verurteilung von Terrorakten hinausgeht; denn die Verurteilung entsteht ja aus der Annahme, dass staatlich sanktionierte Gewalt legitim ist, während das, was die bestehende Staatsstruktur anfechtet oder unabhängig von ihr funktioniert, nicht legitim ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Staaten und Terroristen grundsätzlich gleiche Beweggründe haben: Beide sind der Überzeugung, dass der Tod von Tausenden Unschuldiger ein akzeptabler Preis ist, wenn er dem Erreichen politischer Ziele dient. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Ideen von Osama Bin Laden, die al-Qaidas globalem Dschihad zugrunde liegen – eine kritische Analyse von Ursachen und Folgen – setzt voraus, dass man zumindest vorübergehend sein Urteil über die Legitimität einer Form von Gewalt gegenüber einer anderen aussetzt. Anders gesagt: Eine Analyse der terroristischen Beweggründe muss, wenn sie etwas leisten soll, nüchtern und unbefangen sein: Sie setzt voraus, dass man sich von der gerechtfertigten Empörung über die Ereignisse des 11. September und andere Gräuel frei macht und die Perspektive der Gegenseite einnimmt. Nur dann ist es möglich, die Rolle des historischen Gefühls des Leidens und die Opferrolle der umma zu beurteilen, die für die Logik des globalen Dschihad eine zentrale Rolle spielt; und nur auf dieser Grundlage ist es möglich, al-Qaidas Rechtfertigung ihrer Taten zu untersuchen. Praktisch bedeutet dies, dass man sich nun ohne Angst vor ‚Political Incorrectness‘ fragen kann – nicht ob der Tod von 500.000 arabischen Kindern das Töten von 3000 Amerikanern rechtfertigt, sondern warum er zumindest für eine der beiden Parteien diesen Tod gerechtfertigt hat.
Das vorliegende Buch untersucht den Charakter und die Anziehungskraft von al-Qaida vor dem Hintergrund dieser methodologischen und begriffstheoretischen Überlegungen. Anstatt jedoch nur eine weitere Perspektive aus einem anderen Blickwinkel aufzuzeigen, liegt das Augenmerk hier auf den Diskrepanzen zwischen den häufigsten Erklärungen und den Grenzen dessen, was man realistisch wissen kann. Neben der oben angeführten Quellenkritik beinhaltet dies auch eine kritische Herangehensweise an das Material, das von oder im Namen von al-Qaida veröffentlicht wird. Als Gruppierung, die sich in einem grundsätzlich asymmetrischen Konflikt mit den USA und dem Westen befindet, beruht die Stärke von al-Qaida nicht auf physischer Macht im traditionellen Sinne – einer Macht also, die gemessen und quantifiziert werden kann und der man entgegentreten kann. Die Stärke von al-Qaida liegt vielmehr in ihrer Fähigkeit, ihr Publikum zu manipulieren, es in Angst und Schrecken zu versetzen und Reaktionen zu provozieren. Dies bedeutet, dass öffentliche Aufrufe zum globalen Dschihad, sei es in Videos oder Online-Zeitschriften, nicht für bare Münze genommen werden können, sondern in erster Linie als Versuch betrachtet werden müssen, bei einem breiteren Publikum Fakten zu schaffen. Fest steht allerdings, dass die Dschihadisten versuchen, so geschlossen, fähig und mächtig wie möglich zu erscheinen. Inwieweit es sich hierbei allerdings um fromme Wünsche beziehungsweise um reine Lippenbekenntnisse handelt, ist eine andere Frage.
Diese Dynamik stellt zweifellos ein besonderes Problem dar, wenn es darum geht, wer oder was al-Qaida wirklich ist. Ist sie eine Organisation, ein globales Netzwerk, ein zerstreuter und amorpher Gegner, ein wahllos zusammengewürfelter Männerbund? Besteht sie aus Zellen, Agenten, Mitgliedern und einer Führung? Ist sie mehr (manche würden sagen: weniger) als eine Organisation – eine Ideologie und ein Prozess? Kapitel 2 beginnt mit einem Überblick über die wichtigsten Diskurse zur Entstehung und den Erscheinungsformen von al-Qaida; es zeichnet die Entwicklung dessen nach, was angeblich als regionaler Machtkampf gegen die Sowjets in Afghanistan begann und schließlich zur Erklärung des globalen Dschihad und den Anschlägen des 11. September führte.
Nach Fragen nach dem ‚wer?‘ und ‚was?‘ widmen sich die folgenden Kapitel einer näheren Untersuchung des ‚warum?‘ Was ist die Logik des globalen Dschihad? Wie lassen sich wahllose Gewaltangriffe auf zivile Ziele im Namen des Islam erklären? Kapitel 3 beleuchtet kritisch die verschiedenen Erklärungsversuche für al-Qaidas raison d‘être. Kommentatoren haben verschiedentlich versucht, die Anhänger von al-Qaida als Wahnsinnige, religiöse Heuchler, Wahhabiten des 21. Jahrhunderts oder salafistische Dschihadisten hinzustellen; all diesen Ansätzen ist eine Art ‚Outside-In-Perspektive‘ gemein, die eine grundlegende Logik von al-Qaida voraussetzt, ohne jedoch genügend auf primäre Beweisquellen einzugehen; sie schließen außerdem alternative Ansätze aus, die eine andere Realität offenbart hätten. Wie dieses Kapitel zeigt, haben sich gerade jene Erklärungen, die scheinbar zur Amtsweisheit über al-Qaidas Ideologie, den Wahhabismus und die Vorstellung von salafistischen Dschihadisten avanciert sind, nur innerhalb der Terrorismusforschung als eigene Richtungen etabliert; im größeren Fächerrahmen der Nahoststudien und Islamstudien werden sie äußerst kontrovers diskutiert. Auf der bangen Suche nach Erklärungen für al-Qaida ist die Terrorismusforschung von akademischen Standards abgekommen und hat sich stattdessen damit begnügt, alte und grob vereinfachte Versionen des komplexen islamischen Denkens zu recyclen, neue zu postulieren und so jenen Vergröberungen neuen Auftrieb gegeben, den sie nicht verdienen. Doch während das Etikett ‚salafistisch-dschihadistisch‘ al-Qaida weiter anhaftet, liefert es keinerlei Erklärung für die anhaltende Popularität von Bin Ladens Botschaften unter gläubigen Muslimen; ebensowenig erklärt es, warum ihn viele normale Muslime auf der ganzen Welt zu einem muslimischen Helden erklärt haben.
Kapitel 4 versucht zu erklären, warum Ideen, die mit al-Qaida und dem globalen Dschihad in größerem Zusammenhang stehen, eine solche Anziehungskraft ausüben. Ausgehend von Primärquellen, die den Kern der Ideologie von al-Qaidas globalem Dschihad betreffen, setzt sich dieses Kapitel eingehend mit den Schriften und öffentlichen Äußerungen von Osama Bin Laden zwischen 1994 und 2009 auseinander und setzt sie in Bezug zur Entwicklung des islamischen Denkens und sich wandelnden gesellschaftlich-politischen Realitäten im späten 19. und 20. Jahrhundert. Im Gegensatz zu heutigen Vorstellungen vom ‚salafistischen Dschihad‘ steht, wie Kapitel 4 zeigt, eine idealistische, panislamische Gesinnung im Mittelpunkt seiner Botschaften; diese basiert nicht mehr auf den Hauptrichtungen islamischer Theologie, sondern ist vielmehr das Ergebnis der intellektuellen Krise des modernen Islam. Wie die geschichtliche Perspektive zeigt, sollte Bin Ladens Philosophie wohl am besten als zeitgenössischer Ausdruck von Panislamismus – einer Ideologie, die sich Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte – verstanden werden; überzogene Reaktionen des Westens auf diese vermeintliche Bedrohung bestehen ebenfalls bereits seit dieser Zeit.
Kapitel 5 beschäftigt sich konkret mit dem Charakter von al-Qaida und der von ihr ausgehenden Bedrohung. Es untersucht den Stand der Organisation in einer Welt nach 11. September, setzt sich mit der Serie an Terroranschlägen seit dem September 2001 auseinander und prüft Argumente für und gegen die These, al-Qaida sei eine klar strukturierte Organisation, die eine ernsthafte Bedrohung der weltweiten Sicherheit darstelle. Ist sie, wie manche Kommentatoren behaupten, auf einen ‚führerlosen Dschihad‘ reduziert worden, der je nach Situation von radikalisierten Einzelpersonen ausgeführt wird, oder ist al-Qaida ‚auf dem Vormarsch‘? Formiert sich ihre Führung in den abgelegenen Gebieten von Pakistan und Afghanistan neu und kehrt sie durch lokales Franchising im Maghreb, Irak und neuerdings in der Republik Jemen auf die internationale Bühne zurück? Der Fall Jemen wird eingehender beleuchtet, da er interessante Erkenntnisse über den aktuellen Stand der dschihadistischen Bewegung in einer Region liefert, die sich aufgrund zunehmender politischer Instabilität rasant zum Mittelpunkt des internationalen Interesses entwickelt (so der Stand zur Drucklegung dieses Buches).
Kapitel 6 befasst sich mit der Zukunft des globalen Dschihad – einer Zukunft, die von Einzelanschlägen geprägt ist, welche von der Ideologie des Dschihad motiviert sind, jedoch keinerlei Verbindung zu einer größeren Organisation haben; es wirft einen kritischen Blick auf die Art und Weise, wie al-Qaida in Vergangenheit und Gegenwart von der internationalen Gemeinschaft verstanden worden ist und wie die internationale Gemeinschaft auf die Organisation reagiert hat. Ist al-Qaidas Aufruf zur gewaltsamen Verteidigung der Gemeinschaft der Gläubigen überschattet worden durch friedlichere – oder zumindest demokratischere – Aktionen in Nordafrika und in Nahost? Der Tod von Bin Laden wird von manchen als Ende einer Ära betrachtet. Wird al-Qaida bald mehr denn je marginalisiert und isoliert vom islamischen politischen Mainstream dastehen?