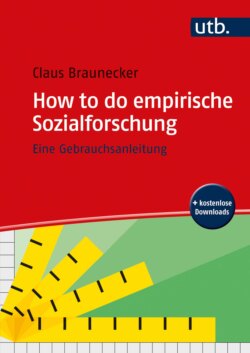Читать книгу How to do empirische Sozialforschung - Claus Braunecker - Страница 6
ОглавлениеVORWORT
2016 erschien das „Vorgänger“-Buch zu diesem: How to do Empirie, how to do SPSS. Eine Gebrauchsanleitung. Sein Ziel war es, doppelt Hilfe zu bieten – bei der Konzeption einer Erhebung UND bzw. ODER bei der Datenanalyse. Der große Erfolg dieses Werks – vom Autor liebevoll How to do genannt – legte eine Fortführung sehr nahe.
Eine zweite (überarbeitete) Auflage wäre leicht, aber nicht besonders herausfordernd gewesen. Viel spannender war es, How to do weiterzuentwickeln – mit allen Erfahrungen und Rückmeldungen, die seit dem Erscheinen gesammelt werden konnten. Bald stand das neue Konzept fest: Wir teilen das „Doppel-Buch“ der Erstauflage und lassen daraus zwei eigenständige Publikationen entstehen, eine für Empirie und eine für Statistik und Datenanalyse (mit SPSS). Also das hier vorliegende Druckwerk und das zeitgleich erscheinende mit dem Titel How to do Statistik und SPSS. Eine Gebrauchsanleitung.
Warum das? Wir haben beobachtet, wie How to do verwendet wurde: Die Nutzung des Buchs hat sich oft auf einen der beiden Teile konzentriert. Viele müssen empirische Sozialforschung zunächst KONZIPIEREN. Datenanalyse liegt dabei noch in der Ferne. Erst dann, wenn die AUSWERTUNG ansteht, rücken Statistik und Tools wie SPSS näher.
Deshalb versorgen wir unsere Zielgruppe(n) jetzt „phasengerecht‟, denn:
– Zwei Bücher erlauben es, die Inhalte noch mehr zu schärfen und zu präzisieren.
– Halb so viele Seiten vermitteln weniger „Oh, da muss ich aber viel lesen ...‟.
Das verbindende Element bleibt natürlich bestehen! Beide Bücher sind nach wie vor so gestaltet, dass sie ein großes Ganzes ergeben – einzeln oder kombiniert verwendbar.
Hier liegt nun also das „Empirie-Buch‟ vor. Es will rasch und effizient sozial- oder wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse der empirischen Sozialforschung vermitteln. Viele suchen Orientierung, wie sie eine bevorstehende Bachelorarbeit, Master-Thesis oder Dissertation anlegen sollen. Andere wollen freiwillig oder unfreiwillig ihre Empirie-Kenntnisse vertiefen oder auffrischen. Sie alle werden mit diesem Werk „abgeholt‟.
Niemand soll alles lesen müssen! Viele Verweise verknüpfen deshalb thematisch verwandte Passagen. Somit ist an jeder Stelle ein individuell motivierter Einstieg möglich.
40 Abbildungen, weiterführende Literaturhinweise (mit Seitenangaben) und ein schlagwortoptimiertes Stichwortverzeichnis ergänzen die leicht lesbare, verständliche Gebrauchsanleitung. Frei zugängliche Downloads (Beispiel-Fragebogen, Best-Practice-Beispiele, Vorlagen für tabellarische und grafische Ergebnisdarstellungen, weitergestaltbare Empirie-Slides als Präsentationsvorlage usw.) unter howtodo.at bzw. www.utb-shop.de/9783825255954 runden das „empirische Gesamtpaket‟ ab.
[8]
Warum ist dieses Buch entstanden? ‒ Persönliche Worte des Autors:
Empirie und SPSS begleiteten mein Ausbildungs- und gesamtes bisheriges Berufsleben. Seit meinem Studium der Kommunikationswissenschaft in den 1980ern arbeite ich als Instituts- und Betriebsmarktforscher in österreich. Seit vielen Jahren unterrichte ich an Unis und FHs, berate Studierende unterschiedlicher Jahrgänge, Semester und Studienrichtungen im Umgang mit der empirischen Sozialforschung, Statistik und Datenanalyse. Planung, Auswertung und Interpretation von Erhebungen zählen zu meiner alltäglichen Berufs- und Vermittlungs-Routine. Immer wieder neue Fragen und Problemstellungen führten mich dazu, mein erstes Buch zu schärfen und neu entstehen zu lassen.
Die Gliederung und Aufbereitung orientieren sich an meinen Erfahrungen in Wirtschaft und Wissenschaft. Die Darstellung der Themen hat bei sehr vielen Menschen – unterschiedlichen Alters, mit mannigfaltigen Zugängen, mit und ohne Vorwissen – für wiederholt positives Feedback gesorgt. Fortgeschrittenere Lesende mögen manche Ausführung vielleicht als zu „vereinfacht‟ empfinden. Sie seien um Verständnis gebeten: Es ging mir um das verständliche Vermitteln der Inhalte an nicht (mehr) oder wenig(er) Involvierte.
GANZ besonderer Dank (in alphabetischer Reihenfolge) an • Mag. Jennifer Braunecker, Tochter und Juristin und • Mag. Dr. Rosemarie Nowak, Donau-Universität Krems, Lehrgangsleiterin am Department für Wissens- und Kommunikationsmanagement! Ihr beider „Intensiv-Lektorat‟ des fast finalen Werks hat für unermessliche Inputs gesorgt!
WIRKLICH großer Dank gebührt auch der Verlagslektorin dieses Buchs • Mag. Sandra Illibauer-Aichinger. Sie begleitet die How to do's (und mich) von Anbeginn an. Wirklich viel vom Erfolg der Erstauflage und von der Gestaltung dieses Werks ist ihr persönlich zuzuschreiben!
Vielen herzlichen Dank für ihre wertvollen und spezifischen Inputs richte ich auch an
• Mag. Bernhard Burger, Arbeitskollege in Wirtschaft und Wissenschaft • PD Mag. Dr. Petra Herczeg, Universität Wien, Vizestudienprogrammleiterin Publizistik- und Kommunikationswissenschaft • Mag. Ursula Illibauer, Juristin und Datenschutzexpertin in Wirtschaft und Wissenschaft • Prof. (FH) Mag. (FH) Claudia Kummer, MSc, Hochschullehrerin, Department Wirtschaft der FH Burgenland • Ass.-Prof. Ing. Mag. Dr. Klaus Lojka, Universität Wien, Studienprogrammleiter Publizistik- und Kommunikationswissenschaft • PD Dr. Dr. Julia Wippersberg, Vizestudienpräses der Universität Wien • Mag. (FH) Markus Zimmer, Inhaber und Geschäftsführer von BuzzValue – New Media Research.
Alle genannten Personen aus Wissenschaft und Praxis haben mich über die Jahre immer wieder mit ihren Tipps, Ratschlägen und Kontakten unterstützt und dabei geholfen, How to do weiterzuentwickeln. Danke dafür!
| Wien, im März 2021 | Mag. Dr. Claus Braunecker [9] |
Der rote Faden der Empirie ‒ die Inhalte dieses Buchs
Abbildung 1: Jedes empirische Vorhaben benötigt einen roten Faden
Jedes empirische Forschungsvorhaben – ob in Wirtschaft oder Wissenschaft – benötigt einen roten Faden. Abbildung 1 veranschaulicht die einzelnen Schritte jeder empirischen Sozialforschung: Jedes Detail – von der ersten Forschungsidee bis zur Ergebnispräsentation – MUSS dem roten Faden folgen! Jeder einzelne Puzzlestein leistet seinen Beitrag und kann die anderen Phasen mehr oder weniger stark beeinflussen.
So können z.B. nachträgliche änderungen an den Erkenntnisinteressen die gesamte bisher geplante Methodik ad absurdum führen.
Eine (nur kleine) änderung im Fragebogen (nach Erhebungsstart) macht die ursprünglich beabsichtigte Auswertung unmöglich. Dadurch kann in weiterer Folge eine Forschungsfrage nicht mehr beantwortet werden.
Eine fehlerhafte Stichprobenziehung führt dazu, Ergebnisse völlig falsch zu interpretieren.
Aus allen diesen Gründen folgt auch der Aufbau dieses Buchs einem roten Faden. Im Detail geht es dabei um die folgenden Prozessschritte:
Jedes Forschungsvorhaben besitzt 1. ein Thema mit Erkenntnisinteresse (ab Seite 13).
Aus diesem Erkenntnisinteresse werden 2. Forschungsfrage(n) und/oder Hypothese(n) abgeleitet (ab Seite 14). Das erfolgt in der Wirtschaft aus sachlichen Zusammenhängen, in der [10] Wissenschaft im Zuge eingehender Literaturrecherchen. Forschungsfragen bzw. Hypothesen weisen der späteren Datenanalyse den Weg (ab Seite 142).
Parallel dazu, manchmal vor, manchmal nach dem 2. Schritt, lässt sich 3. eine passende Forschungsmethodik, ein sinnvolles qualitatives oder quantitatives Forschungsdesign (ab Seite 22) festmachen. Dieses wird auch Setting genannt und soll die Forschungsfragen möglichst effizient beantworten bzw. die Hypothesen möglichst zielgerichtet einer Prüfung zuführen.
In Wechselwirkung mit dem Setting steht 4. die genaue Definition der Grundgesamtheit (ab Seite 41). Damit zusammenhängend erfolgt die Entscheidung über eine Vollerhebung (ab Seite 43) oder eine bei qualitativen Verfahren meist willkürliche Auswahl (ab Seite 68). Bei quantitativen Designs sind Stichproben im Idealfall zufällig (ab Seite 63) oder Quotenstichproben (ab Seite 68).
Sind Methodik und Stichprobenverfahren festgelegt, ist auch der Weg für 5. das Erhebungsinstrument – Fragebogen, Leitfaden, Codierschema oder Protokollbogen – vorgezeichnet. Damit das Erhebungsinstrument mit den Forschungsfragen und/oder Hypothesen korrespondiert, müssen die Fragen oder Erhebungsdimensionen „Passgenauigkeit‟ besitzen. Hier ist neben der exakten inhaltlichen Abdeckung der Erkenntnisinteressen (ab Seite 110) auch die Skalenform der Erhebungsinhalte (ab Seite 97 und ab Seite 142) von hoher Bedeutung.
Beim 6. Pretest wird das Erhebungsinstrument auf Praxistauglichkeit überprüft (Seite 133). Funktioniert es nicht zufriedenstellend, muss es noch einmal überarbeitet werden. Gibt der Pretest das Erhebungsinstrument „frei‟, kann die Datenerhebung (Feldarbeit) starten.
In der Phase der 7. Datenerfassung muss die Kontrolle erfolgen, ob die Vollerhebung wirklich „voll‟ erhoben hat bzw. ob die Stichprobe zufriedenstellenden Rücklauf verzeichnet (Braunecker 20211: 25ff.). Vor allem quantitative Daten müssen vor der Auswertung sehr oft repräsentativ sein (ab Seite 55).
Liegen (dann) Daten vor, folgt deren 8. technische Auswertung (ab Seite 134 und im Detail Braunecker 2021).
Im Zuge der Auswertung finden 9. Ergebnisinterpretation (ab Seite 145), Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesenprüfung (ab Seite 142 und im Detail Braunecker 2021) statt.
Erst dann werden 10. die Ergebnisse möglichst plakativ aufbereitet und derart präsentiert, dass sie möglichst alle Erkenntnisinteressen abdecken und die erforderlichen Antworten auf die Forschungsfragen und Hypothesen geben (ab Seite 145).
Alle Phasen einer Erhebung müssen wie ein Puzzle ineinandergreifen und aufeinander abgestimmt sein. Veränderungen nur einer Phase können – manchmal sogar auch rückwirkend – andere Phasen beeinflussen.
[11]
Empirische Erhebungen sind meist speziell und individuell. Sie folgen in ihrem grundsätzlichen Setting aber immer festlegbaren Kriterien: Die Erläuterungen in allen weiteren Abschnitten dieses Buchs zur Planung, Durchführung, Auswertung und Ergebnisinterpretation von Erhebungen können deshalb sinngemäß auf alle – in Kapitel 2 vorgestellten – Forschungsmethoden umgelegt werden.
Die im Buch angeführten Beispiele zeigen meist nur EINE von vielen Möglichkeiten der Umsetzung. Jedes empirische Vorhaben ist eine „Maßanfertigung‟. Immer stehen individuelle Erkenntnisinteressen, Forschungsfragen und Hypothesen im Vordergrund! Es gibt (fast) immer mehrere Umsetzungsmöglichkeiten.
1 Parallel zu diesem Werk erscheint das Buch Braunecker, Claus (2021): How to do Statistik und SPSS. Eine Gebrauchsanleitung. Wien: facultas. Beide Bände haben das Ziel, den gesamten roten Faden der empirischen Sozialforschung zu spannen – von der ersten Forschungsidee bis zur statistischen Datenanalyse mit der Datenanalysesoftware SPSS. [12]