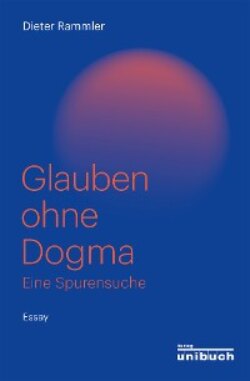Читать книгу Glauben ohne Dogma - Dieter Rammler - Страница 9
Jesus von Nazareth
ОглавлениеJesus stammte aus Nazareth, einem kleinen Ort in Galiläa. Maria und Josef waren seine Eltern. Er hatte Geschwister, von denen ihm Jakobus besonders nahestand. Er wurde ein charismatischer Wanderprediger, der eine religiöse Gruppe von Frauen und Männern anführte und als deren Kopf sowohl der Gotteslästerung als auch des Hochverrats angeklagt, verurteilt und hingerichtet wurde.
Als junger Mann war er mit Johannes dem Täufer am Rande der judäischen Wüste in Kontakt getreten, teilte dessen Idee der Gotteswirklichkeit und ließ sich von ihm zum Zeichen der Buße und Umkehr taufen. Schließlich trennte er sich von Johannes, um seiner eigenen Berufung zur Verkündigung des Reiches Gottes zu folgen. Damit begann er in seiner Heimat Nazareth im galiläischen Bergland und in Kapernaum am See Genezareth, wo er allerdings bis in seine Familie hinein auf Unverständnis und Ablehnung stieß. Jesus forderte von seiner kleinen Anhängerschaft, dass sie sich ebenfalls von ihren Herkunftsfamilien trennte und ausschließlich der Verbreitung der messianischen Botschaft verschrieb. Besonders umstritten war er bei einem Teil der pharisäischen Reformbewegung, an deren aus seiner Sicht rechthaberischer und selbstgerechter Frömmigkeit sich wiederholt Konflikte entzündeten. Teile der Rabbinen und Pharisäer lehnten seinen Auslegungsanspruch ab und attackierten öffentlich seinen Umgang mit fragwürdigen Leuten als anmaßend und gotteslästerlich. Tatsächlich scheute er nicht den Kontakt in soziale Milieus, um die man einen großen Bogen machte: Prostituierte und Zöllner zum Beispiel, die man als römische Kollaborateure verachtete. Wohin Jesus von Nazareth kam, sammelten sich kranke Menschen um ihn in der Erwartung einer heilsamen Berührung und Ermutigung zum Leben. Von seinem Glauben an die alles erfüllende Gotteswirklichkeit erzählte er sehr lebensnah vor allem in seinen Gleichnissen. Er nahm die Menschen mit. So wuchs die Bewunderung, und wohin er kam, zog er viele an. Manche sahen in ihm einen zweiten Johannes (der Täufer Johannes war hingerichtet worden), obwohl er nicht taufte, andere sogar den wiedererstandenen Propheten Elia. In seiner Auslegung der Tora suchte er, zu ihren Wurzeln zurückzukehren und den Sinn und Zweck der Gebote herauszustellen. Bloßen Ritualismus nahm er nicht ernst, und eine zur Schau gestellte Frömmigkeit verabscheute er. Er vertrat eine pazifistische Ethik und setzte sich mit dem Tempelkultus sehr kritisch auseinander. Diese Haltung weckte Widerspruch und führte zu Nachstellungen. Als er die Geschäftetreiberei im Tempelbezirk angriff und Jerusalems Schicksal prophetisch ankündigte, geriet er mit den Jerusalemer Autoritäten der Priesteraristokratie in Konflikt. Sie ließen ihn am Abend des Passahfestes festnehmen, der Gotteslästerung anklagen und den römischen Besatzern zur Verurteilung übergeben. Es folgte ein politisches Urteil, weil er angeblich von sich behauptet hatte, König der Juden zu sein, also einen messianisch-politischen Anspruch erhoben hätte. Jesus von Nazareth wird gefoltert, öffentlich gedemütigt und gekreuzigt und stirbt auf der Richtstätte Golgatha in Jerusalem. Seine Anhänger dürfen ihn begraben. Die Frauen unter ihnen suchen nach seinem Tod das Grab auf und erzählen erschüttert, dass sie ihn nicht unter den Toten gefunden hätten. Sie wären einem Engel begegnet, der seine Auferweckung verkündigt hätte.
Ein jüdischer Mann fühlte sich berufen, seinen Glauben an Gott, wie er in der Tora bezeugt ist, eigenständig auszulegen. Im Glauben, dass Gottes Eingreifen sich sogar schon andeutet, wollte er Menschen aufwecken und überzeugen, dass etwas Umwälzendes geschieht und sie im Hochgefühl einer Zeitenwende, eines Kairos, zu einem Sinnes- und neuen Lebenswandel anhalten. Seine Anhänger bildeten mit ihm eine Nachfolgegemeinschaft, die ihn bei seinem Vorhaben unterstützte. Er fühlte sich seinem Gott auf innigste Weise nahe und schöpfte daraus Kraft und Entschlossenheit, sah sich als Werkzeug Gottes, als Bote seiner Gerechtigkeit. Gebildet und mit den religiösen Überlieferungen seines Volkes vertraut, zitierte er nach altem Brauch die Tora in der Synagoge und legte sie aus, wurde dort aber mit seiner eigenwilligen Lesart und Interpretation abgelehnt und vollzog dann selbst den Bruch mit seinem bisherigen Leben.
Ich denke, dass er sich als messianischen Propheten und Friedensboten betrachtete. Er war sich seiner Berufung gewiss. Es scheint andererseits aber so gewesen zu sein, dass er immer wieder hinter seiner Botschaft und hinter seinem Wirken zurücktrat und weder sich selbst noch einen seiner Anhänger hervorheben wollte, und er wollte, dass das in seinem Umfeld auch kein anderer tat.
Ich glaube nicht, dass die Gottessohnschaft zu seinem Selbstverständnis gehörte, wie es die Evangelien retrospektiv darstellen. Dass Jesus Christus der Sohn Gottes sei, ist Ausdruck des Glaubens seiner Nachfolger und Nachfolgerinnen. Wohl aber glaube ich, dass er, wie schon der Täufer, nur wesentlich hoffnungsvoller als dieser, sich als ein Bote einer großen Zeitenwende gesehen hat. Dass er sich berufen glaubte, den Menschen Augen und Herzen für die Wirklichkeit Gottes zu öffnen, mit der Vision von einer Welt, in der das Böse entmachtet ist (Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, Lukas 10), wo Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sich küssen, Lahme gehen, Blinde sehen und den Armen das Reich Gottes verkündigt wird, wie es bei den Propheten immer wieder angeklungen ist. Und das in einer Zeit, die alles andere als friedlich war. In jedem Dorf und jeder Stadt lehrten römische Garnisonen das Fürchten. Die politische Führung war korrupt und konnte sich nur als Vasall Roms behaupten. Großgrundbesitzer hatten weite Teile des Landes in ihren Besitz gebracht und nahmen die Landlosen aus. Neben großer Armut wuchsen römische Villen und Latifundien für die Schönen und Reichen am See Genezareth und an der Levante. Und im Untergrund sammelten sich jüdische Aufständische.
Jesus von Nazareth hat das Risiko gekannt, das er mit seinem öffentlichen Auftreten und seiner Botschaft einging. Der Konflikt mit den herrschenden Theologen und schließlich in der hoch angespannten Situation im Land auch mit der politischen Führung ließ nicht auf sich warten. Ein Funke genügte, um die Situation eskalieren zu lassen, was sein Jünger Judas und vielleicht auch andere aus seinem Umfeld kaum erwarten konnten. Er schien zu schwanken, ob er sich dem aussetzen und die Konsequenzen auf sich nehmen sollte. Der Überlieferung nach entschied er sich im Garten Gethsemane dazu, seiner Sache treu zu bleiben. Als man ihn verhaftet, überlässt er sich dem Prozess in einer merkwürdigen Passivität. An keiner einzigen Stelle sagte der Rabbi aus Nazareth seinen Weg selbst voraus oder deutete ihn als notwendig an – das sind spätere Glaubenszeugnisse, die ihn als den Gottessohn und Christus/Messias darstellen, dieses Glaubensbekenntnis biografisch zurückprojizieren – und damit zweifellos eine ungeheure Anziehungskraft über die Jahrhunderte hinweg entwickeln.
Es sind die in den Evangelien und Briefen des Neuen Testaments und im Glaubensbekenntnis der Alten Kirche entfalteten Dogmen der Christologie, die heute vielen den Zugang zum Glauben erschweren und auch mir teilweise formelhaft und wie aus der Zeit gefallen vorkommen. Man bekommt das einfach nicht zusammen mit einem Weltverständnis, das eine metaphysische Wirklichkeit schlechterdings nicht mehr denken kann. Ich halte es daher für legitim, zunächst einmal den Spuren des historischen Jesus zu folgen. Ich verbinde mit dem Blick auf den historischen Jesus die Hoffnung auf eine Spurensuche, die den eigenen Glauben inspiriert. Also: Wie kann ich mit Jesus glauben? Statt gleich zu fragen: Wie kann ich an Jesus Christus glauben? Natürlich weiß ich, dass die Jesuszeit uns in den Schriften des Neuen Testaments als die von den ersten Zeugen und Zeuginnen gedeutete und erinnerte Christuszeit begegnet. Ich möchte diese Jesuszeit aber, wie er selbst es tat, zunächst einmal als Vertrauen auf die Gotteszeit und Gotteswirklichkeit verstehen.
Für mich ist Jesus aus Nazareth ein Mensch mit großem Gottvertrauen gewesen und dem Bewusstsein, ein Werkzeug des Friedens an der Schwelle zu einem Zeitenumbruch zu sein. Für diese Berufung suchte und fand er Gleichgesinnte zunächst unter den einfachen Leuten am See in Galiläa. Aus der Kraft dieser inneren Berufung verletzte er Konventionen und Regeln und wandte sich Menschen zu, die er in die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen (zurück)führen wollte. Im Mittelpunkt seines Glaubens stand das Bild eines barmherzigen Gottes. Daher richtete sich sein Blick zuerst auf Menschen, die unter die Räder gekommen waren, oder die man als gescheitert ansah. Indem Jesus aus Nazareth seine jüdischen Glaubensangehörigen in der Tradition der Prophetie und Visionen Israels aufzurütteln versuchte, hat er etwas hinterlassen, was Menschen aus allen Völkern noch heute bewegt.
Eine Schlüsselrolle nahmen dabei die Menschen ein, die ihn begleiten und als Erste davon erzählen, dass er auf unbeschreibliche Weise lebendig ist. Sie nannten es Auferweckung oder Auferstehung von den Toten, wie es insbesondere in der pharisäischen Frömmigkeit schon vor Jesus üblich war. Sie malten die Ereignisse mit den religiösen Bildern ihrer Zeit aus und ließen die Auferstehung durch Engel bezeugen. Sie kleideten ihre neue Hoffnung in die Erzählungen vom weggewälzten Stein und leeren Grab, von den Begegnungen mit seinen Jüngern und dem ungläubigen Thomas und schließlich am See Genezareth, wohin sie zurückgekehrt waren. Oder sie erzählten, wie er ihnen unerkannt auf dem Weg nach Emmaus, einem kleinen Ort in der Nähe Jerusalems, begegnete und ihnen erst abends beim Brotbrechen aufging, wen sie vor sich hatten. Das alles sind Glaubenserzählungen und keine Tatsachenberichte. Sie wollen die Lebendigkeit Jesu vermitteln und bezeugen, dass Jesus weiter unter ihnen ist. Hunderte waren es, die in unmittelbarer Nähe zu den Ereignissen am Passahfest und auch später noch auf dem Weg des einstigen Christenverfolgers Paulus nach Damaskus seine Kraft zu spüren glaubten, sich von der Botschaft des Sieges über den Tod mitreißen ließen, diese Hoffnung mit allem verknüpften, was sie über ihn gehört hatten, anfingen, nachzuerzählen und zu sammeln, aufzuschreiben und in ihren Versammlungen vorzulesen, was sie über ihn in Erfahrung bringen konnten. Für sie deutete im Rückblick auf sein Leben alles darauf hin, dass er der leidende Gottesknecht war, den der Prophet Jesaja angekündigt hatte, der, unerkannt und von der Welt verworfen, die Schuld seines Volkes trägt und mit Gott versöhnt. Oder dass er, der so stark an die Gottesnähe glaubte und zu ihm als Vater betete, selbst der Sohn eben dieses Vaters im Himmel wäre, mit dem er nun bis ans Ende der Zeit über seine Nachfolger wachen und dereinst über ihre Treue richten würde – eine Vorstellung, die wir aus den König-Jahwe-Psalmen kennen. Wie anders sollten sie es auch ausdrücken als mit den Sprachbildern ihrer Tradition?
Dabei vollzog sich ein Fokuswechsel. Je mehr sich der Glaube, den Jesus zu Lebzeiten selbst vertreten und verkündet hatte, nach seinem Tod in den Glauben an ihn als Sohn Gottes und Messias verwandelte, desto überzeugter war die junge Jesusbewegung, dass sich die alten Verheißungen Israels nun für alle Menschen erfüllten. Sie knüpften damit an die großen Erzählungen des Tanach an, sahen in Jesus Christus den zweiten Moses, der sein Volk aufs Neue aus der Gefangenschaft ins gelobte Land führt und als Messias und Friedefürst die alte Wurzel Jesse zum Leben erweckt – aber diesmal in einem neuen Bund mit allen Menschen. Jesus hat das Reich Gottes verkündigt, was kam, war die Kirche, heißt es spöttisch bei einem Kritiker aus dem 19. Jahrhundert – eine Kirche, die sich selbst als das neue Volk Gottes dazu berufen fühlte, die ganze Welt in Jesu Auftrag und Namen zu missionieren und zu taufen. Sicher war das eine bemerkenswerte Umdeutung: Jesus, der zwar getauft war, aber selbst nicht taufte, gibt vor seiner Himmelfahrt die Losung aus: Gehet hin in alle Welt, machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe (Matthäus). Ein Text, der in dieser Weise erst entstanden ist, als sich die christliche Gemeinde schon auszubreiten begann und mit dem sie ihre Mission begründete.
Als sich der Jesusbewegung Leute anschlossen, die keine Juden waren, aber mit dem jüdischen Glauben sympathisierten, und Juden aus der Diaspora, die hellenistisch geprägt waren, entstand das Bedürfnis, die Geschichte von Jesus Christus auch in deren Vorstellungswelt zu übertragen und Bilder und Symbole zu verwenden, die ihrem religiösen Weltbild und ihrer Kultur entsprachen. Fast hätte es der jüdischen Herkunft und der alten Geschichte Gottes mit seinem Volk nicht mehr bedurft, so unabhängig und universal wurde Jesus Christus im Johannesevangelium gedeutet: Im Anfang war das Wort (Logos), und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit (Prolog). Später fanden weitere Metamorphosen statt, die aus der Jesuserinnerung ein mystisches Drama, einen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, Gut und Böse machten (Gnosis). Daraus entwickelten sich heftige Richtungsstreitigkeiten innerhalb der alten Kirche, bis das apostolische Glaubensbekenntnis in den ökumenischen Konzilien des vierten und fünften Jahrhunderts verbindlich wurde. Bis dahin wurden, in der Sorge, das Christusbekenntnis könnte verfälscht werden, (apokryphe) Evangelien verworfen, der biblische Kanon abgegrenzt, Glaubensregeln aufgestellt und Bischöfe (Aufseher) eingesetzt. Der christliche Festkreis von Ostern und Pfingsten wurde um Weihnachten erweitert. Und die Kalender folgten allmählich einer neuen Zeitrechnung: post Christum natum – nach Christi Geburt.
Diese Transformationen einer ursprünglich jüdischen Bewegung in eine neue Weltreligion liegen wie Schichten auf den im Neuen Testament bezeugten Ereignissen und sind als Interpretamente wirksam. Und sie prägten sich umso mehr ein, als man die Schriften des Neuen Testaments fortan als historische Tatsachenberichte las. Für mich ist es spannend, dass man diesen Transformationsprozess, wenn auch nur in Ansätzen, rekonstruieren kann, weil sich damit einerseits das Prozesshafte des Glaubens darstellen und andererseits bestimmte dogmatische Geltungsansprüche relativieren lassen. Man hat diesen Ansatz beim historischen Jesus bereits in der neutestamentlichen Leben-Jesu-Forschung im 19. Jahrhundert verfolgt, aber auch bald wieder verworfen, weil man meinte, man könne keine Grundierung hinter all den Übermalungen ausfindig machen. Entweder das Bild, wie es ist, oder kein Bild. Das sehe ich anders. Ich finde, dass das Abheben der eindeutigen Schichten christlicher Bekenntnisbildung zu einem jüdischen Menschen führt, der mit seinem Glauben, seinem Wirken und seinem Sterben eine Bewegung ausgelöst hat, die bis heute Zulauf findet. Man kann sich an den Rabbi aus Nazareth erinnern, wie er in seinen Gleichnissen, Seligpreisungen, seinem Gebet, in der Tischgemeinschaft mit „Sündern und Zöllnern“ und durch seine heilende Zuwendung zu Kranken und Armen seinen Glauben lebt und verkündigt – einen Glauben, der durch die Erinnerungsgeschichte des Christentums hindurch bis heute für viele Menschen ein Schlüssel zur Sinngebung im eigenen Leben geworden ist.
Inzwischen hat sich die neutestamentliche Forschung zum dritten Mal der Frage nach dem historischen Jesus (Third Quest) gestellt. Ein wesentlicher Ertrag ist diesmal die Erkenntnis des jüdischen Kontextes, in dem Jesus und die frühe Nachfolgegemeinschaft sich bewegen. Ein zweites Ergebnis besteht darin, dass jede Form der Erinnerung, auch die an den historischen Jesus, von den Vorstellungen und Interessen dessen geleitet wird, der sich erinnern will. Auch der geschichtliche Jesus bleibt dem hermeneutischen Zirkel der Interpretation verhaftet. Liegt in dieser Einsicht nicht auch ein gutes Stück Freiheit beschlossen, den eigenen Formen des Erinnerns zu vertrauen? Wer ist Jesus Christus für uns heute? Mit dieser Frage begann Dietrich Bonhoeffer 1933 in Berlin seine Vorlesung über Christologie, der Lehre von Christus. Wir können dabei auf das Erinnerungsgeflecht der ersten Christen nicht verzichten und quasi einen Standpunkt außerhalb einnehmen. Aber man hat den Glauben auch nicht vorliegen wie einen Keks in der Schachtel. Vielmehr lässt sich die Erinnerung nur zusammen mit ihren Ausdrucksund Überlieferungsformen öffnen, indem wir diese geschichtlich ergründen, sie übersetzen und interpretieren – und damit allererst verstehen und so für uns entscheiden, welcher der Spuren wir folgen, die der Mann aus Nazareth in den biblischen Zeugnissen hinterlassen hat. So ist christliche Existenz im besten Sinne eine Spurensuche. Das ist für mich aufgeklärter Glaube, ob man dabei die Botschaft des Rabbis aus Nazareth oder das Bekenntnis zu Jesus Christus in den Mittelpunkt stellt, oder beides zusammen. Die erinnerte Geschichte ist nicht die quasi objektive Voraussetzung für den Glauben, so als müsste man nur noch Ja und Amen sagen, sondern der Glaube tritt aktiv in die Geschichte der Erinnerung ein. Das wiederum kann Menschen helfen, die im Glauben auf der Suche sind. Denn die Offenheit befreit vom Druck der Vollständigkeit. Dogmen sind hermetisch, Glauben nicht. Man muss nicht alles glauben, um ein gläubiger Mensch zu sein. Die Evangelien selbst erzählen, wie die Menschen, die mit Jesus auf dem Weg sind, zwischen Gewissheit und Zweifel schwanken. Das gehört zum Glauben.
Es wird immer wieder gefragt, worin der christliche Glaube bestehe, wenn man Jesus so entschieden in die Kontinuität der Hoffnungen Israels stellt. Die Gegenfrage lautet: Geht es um das Christentum, oder nicht doch eher darum, mit dem Judentum und dem Juden Jesus an Gott zu glauben? Es wird auch gefragt, ob das Christentum nicht mehr sei als Humanismus. Die Gegenfrage: Was wäre falsch daran, wenn ein Mensch durch seinen Glauben zu einem humanen Leben fände? Schließlich wird moniert, dass man dafür kein Christ zu sein bräuchte. Dem ist nichts entgegenzusetzen. Jesus Christus war auch kein Christ, sondern ein gläubiger Mensch, dem es mit allen Fasern seines Lebens darum ging, Gott als liebendem Grund zu vertrauen und seinem Nächsten beizustehen. Das kann man als Jude, Muslim, Buddhist, Humanist oder Christ. Wer sich in der Weltgeschichte umsieht, entdeckt, dass es leuchtende Vorbilder des Glaubens überall auf der Welt und auch in anderen Religionen gab und gibt. Gott sei Dank auch im Christentum. Als Christen glauben wir in der Erinnerung und Nachfolge Jesu an Gott als den Daseinsgrund der Liebe und an seine Barmherzigkeit. Die Trennlinie verläuft also nicht zwischen Christentum und anderen Religionen, sondern quer durch alle Religionen und Kulturen hindurch. Wo Macht und Geld vergöttert werden und Menschen sich über andere erheben einerseits, und wo sie ihrer Bestimmung folgen, in Ehrfurcht vor dem Leben, das Gott geschaffen hat, andererseits.