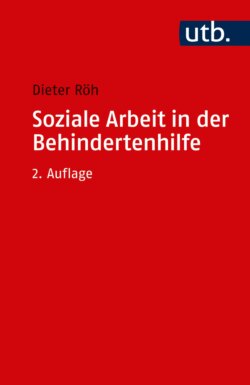Читать книгу Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe - Dieter Röh - Страница 8
Оглавление2 Grundlagen der Sozialen Arbeit
2.1 Geschichte der Behindertenhilfe
Dieser Abschnitt informiert über die gesellschaftliche Entwicklung der Behindertenhilfe von der Armenfürsorge, über die Anstaltsversorgung und die Entstehung erster medizinischer und pädagogischer Ansätze der Rehabilitation, die sich konstituierende Wohlfahrtspflege bis hin zur modernen Sozialpolitik und deren jeweiligen Praxis im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen.
Dem Problem einer klaren begrifflichen Bestimmung, was Behinderung ist, kann an dieser Stelle noch nicht entsprochen werden (Kap.3.1). Allerdings sei darauf hingewiesen, dass die folgenden Ausführungen sich auf ein Gesamt aus „fürsorglichen Bemühungen“, ordnungs- und sozialstaatlichen Programmen und ersten Versuchen der Professionalisierung von Behandlung und Versorgung derjenigen Personen mit verschiedensten Beeinträchtigungen konzentrieren werden, seien es geistige, körperliche oder psychische. Auch die später thematisierte Modernisierung des Verständnisses von Behinderung ist dahingehend zu berücksichtigen, dass es sich bis in das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts hinein um eine eher defizitäre, individualistische Auffassung von „Behinderung“ handelte. Gesellschaftlich wie auch vornehmlich medizinisch wurde „Behinderung“ eher individuell ausgedeutet und als Störung oder Problem klassifiziert, was erst heute mittels einer reflektierten ethischen Grundhaltung und der sozialen Perspektive relativiert werden kann.
So hat sich beispielsweise das Verständnis von geistiger und psychischer Beeinträchtigung im 19. und 20. Jahrhundert verändert. Insbesondere wurde die geistige Beeinträchtigung erst spät von der psychischen Erkrankung abgegrenzt, weshalb damals geläufige und zunächst nicht stigmatisierend genutzte Diagnosen wie „Schwachsinn“, „Blödheit“, „Irrsinn“ oder „Idiotie“ häufig als Synonyme für psychische Abweichungen insgesamt gesehen wurden, einerlei ob es sich um aus heutiger Sicht zu differenzierende Diagnosen von geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen handelte (Hauss 1989; Blasius 1994; Häßler / Häßler 2005).
Im Allgemeinen kann man festhalten, dass der Gegenstand einer vom „Typischen“ abweichenden Wesensart von Menschen mit Beeinträchtigungen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts als eine Domäne der Psychiatrie angesehen wurde, ohne dass die einzelnen Erscheinungsformen differenziert oder andere Verständnisse, etwa psychologische, pädagogische oder sozial- und kulturwissenschaftliche, integriert wurden. Auf institutioneller Seite hielt sich diese Gleichförmigkeit länger als in der medizinischen Wissenschaft, da die Psychiatrie mit ihren kustodialen, institutionellen Strukturen der Heilanstalten, Landeskrankenhäuser, Stadtasyle und Pflegeheime lange Zeit in der Versorgung und „Verwahrung“ dominierte und allerhöchstens innerhalb dieser Anstalten eine Differenzierung vorgenommen wurde.
Eine vollständige Geschichte der Hilfen für Menschen mit Beeinträchtigungen, gerade aus Sicht der Sozialen Arbeit, muss noch geschrieben werden, wobei gute sozialgeschichtliche Arbeiten, u. a. von Dörner (1995) und Blasius (1980, 1994), vorliegen. Eine Übersicht zur geschichtlichen Entwicklung der Fürsorge für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen bis hin zur heutigen Rehabilitation bietet Hausdörfer-Reinert (2005) und für die Gruppe der Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen Häßler und Häßler (2005) sowie Fornefeld (2013, 28 ff.).
Ganz entscheidend vorangebracht wurde die kulturwissenschaftliche und historische Forschung durch die disability studies, einer interdisziplinären Wissenschaft, die – vereinfacht gesagt – in ihren Forschungen ein soziokulturelles Modell von „Behinderung“ favorisiert (Bösl et al. 2010).
In der Literatur zur Geschichte der Sozialen Arbeit wird, aufgrund der Dominanz anderer Disziplinen und Professionen in diesem Feld, die Behindertenhilfe eher randständig behandelt. Trotzdem ist diese hinsichtlich ihres in den verschiedenen Zeiten gesellschaftlich unterschiedlich definierten Auftrages zur Bearbeitung von sozialen Problemen bzw. Armutsphänomenen immer auch mit Menschen mit Beeinträchtigungen befasst gewesen. Armenfürsorge und Behindertenfürsorge waren daher lange Zeit miteinander verschränkt, da Menschen mit Beeinträchtigungen per se als Arme angesehen und behandelt wurden und erst mit der Ausdifferenzierung der Versorgung ab der Mitte des 20. Jahrhunderts der eigenständige Beitrag der Sozialen Arbeit ersichtlich wird.
Da weitgehend Analysen prähistorischer Funde und antiker Überlieferungen fehlen (siehe als Ausnahme Rathmayr 2014, 45 ff.), kann ein erstes Mal etwas fundierter auf die besondere Berücksichtigung und Erwähnung von Menschen mit Beeinträchtigungen im ausgehenden Mittelalter hingewiesen werden: Sie lebten zu dieser Zeit in der Regel bei ihren Familien oder ihren Verwandten und wurden von diesen versorgt. Allerdings ist belegt, dass sie im Falle der Gefährdung anderer, bei Auffälligkeiten, z. B. großer Unruhe oder „Raserei“, in Narrenhäusern, Spitälern und Armenhäusern, vereinzelt auch in die seit dem 16. / 17. Jahrhundert entstehenden Zucht- und Arbeitshäusern, interniert wurden. Daher sollte auch vor einer allzu romantischen Vorstellung von Integration in die Familie bzw. das Dorf gewarnt werden. Vielmehr waren Stigmatisierung und Kontaktvermeidung eher die Regel als die Ausnahme – und sind es mit Blick auf die Lage in anderen Ländern (WHO 2011) und in gewisser, wenn auch abgeschwächter Form auch in Deutschland noch immer. So berichtet Thoma (2004, 84) davon, dass bis ins 19. Jahrhundert schwangere Frauen davor gewarnt wurden, behinderte Menschen anzusehen, da sich dies schlecht auf ihr Kind auswirken würde. Und in der Republik Südafrika müssen noch heute weite Teile der Bevölkerung darüber aufgeklärt werden, dass Epilepsie nicht ansteckend oder gefährlich ist und auch kein böser Geist die Betroffenen beherrscht (vgl. die Arbeit von epilepsy.org.za).
Beginnend mit den ersten Bemühungen europäischer Städte, im ausgehenden Mittelalter Armen- und Bettelordnungen zu erlassen, die im Zusammenhang mit ihrem neuen Selbstbewusstsein als Handwerks- und Handelszentren und der wirtschaftlichen Entwicklung stehen, wird der Umgang mit bestimmten Bevölkerungsgruppen zunehmend davon bestimmt, sie aus der Gesellschaftsordnung auszugliedern und ihre Fürsorge, Kontrolle bzw. Verwahrung den o.g. Institutionen zu überlassen (Fornefeld 2013, 32 ff.). Verbunden mit einem sich langsam etablierenden städtischen Verhaltenskodex, der zunehmenden Verwertungslogik menschlicher Arbeitskraft, aber auch der wachsenden philanthropischen Einstellung des Bürgertums, gerät Schwäche und Abweichung zu einem Makel, der in dieser neuen Ordnung als zunehmend störend empfunden und damit unsichtbar gemacht, aber gleichzeitig auch „fürsorgerisch“ behandelt werden sollte. Waren bis dato vornehmlich Kirchen und Klöster sowie Lehnsherren für die Almosenvergabe zuständig, so übernehmen nun zunehmend die sich emanzipierenden Städte und das Bürgertum die Fürsorge von Kranken und Schwachen. Bereits die ersten städtischen Armenordnungen, so z. B. die Nürnberger Armenordnung von 1522, kennen spezielle Bestimmungen, wie mit Kranken umgegangen werden soll (Sachße/Tennstedt 1980, 63 ff.). Zudem waren Menschen mit Beeinträchtigungen wie fast keine andere Gruppe dermaßen zentral auf das Betteln angewiesen, dass sie auch bald besondere Berücksichtigung erfuhren: So bestimmt die eben genannte Ordnung, dass wenn bei
„Bettlern und hausarmen Leuten, die mit dem Fieber oder anderen Krankheiten behaftet sind, […], irgendwelche Medizin benötigt würde, diese solches einem der eingesetzten Knechte bekannt geben. Wenn dann dieser Knecht nach Augenschein das Bedürfnis anerkennt, soll er dem Kranken oder Bedürftigen das Nötige auf Kosten des Almosens aus den Nürnberger Apotheken verschaffen“ (Sachße/Tennstedt 1980, 71).
Auch wenn nicht ganz sicher ist, ob auch Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen unter diese Regelung fielen, ist doch anzunehmen, dass diese schon aus Gründen der christlichen Nächstenliebe mit Almosen unterstützt wurden.
Daneben wird jedoch jede Art von Schwäche als störender Kontrast zum zunehmend sich etablierenden, gesellschaftlichen Typus des ‚homo faber‘ gesehen und immer stärker missbilligt. Die neue gesellschaftliche Anforderung, wie sie von den sich entwickelnden Produktionsverhältnissen geschaffen wurde, wird von Sachße / Tennstedt (1980, 37) wie folgt treffend beschrieben:
„Wenn der Lebenszusammenhang und damit die Persönlichkeitsstruktur des mittelalterlichen Menschen in einer vorwiegend agrarisch produzierenden, traditionalen Gesellschaft von dem natürlichen Rhythmus des Jahres- und Tagesverlaufes, von dem Ablauf und der Dauer konkreter Verrichtungen und der Art und Weise konkret-sinnlicher Bedürfnisse bestimmt war, dann produzieren die Gesetzmäßigkeiten des Marktes einen vollständig neuen Lebensrhythmus. Dieser erfordert Disziplin, Zeitökonomie und Abstraktionsvermögen; das Vermögen, kurzfristige Bedürfnisse zugunsten längerfristig zu erreichender Ziele zurückzustellen, im voraus zu planen; abstrakte Tüchtigkeit und Erwerbsstreben. “
Es ist verständlich, dass insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen dieser gleichförmigen Anforderung nicht entsprechen konnten und deshalb auch ausgeschlossen wurden.
Die Neuformierung der Armenpflege durchzieht auch die Reformbemühungen im Absolutismus und der Aufklärung, allerdings mit einem entscheidenden Zusatz, nämlich der zunehmenden Nutzung von sogenannten Armen- und Arbeitshäusern, mit denen, neben der gewünschten ordnungs- und polizeirechtlichen Intention, auch arbeitspädagogische Motive verfolgt wurden.
So verknüpfte sich spätestens mit dem calvinistisch-lutherischen Arbeitsideal die Vorstellung von Armut und Arbeit immer stärker mit dem Ziel der „Erziehung der Armen durch Arbeit“. Die Fürsorge wurde damit gleichzeitig zu einer moralischen und funktional gedachten Sanktions- und Interventionsform, die wiederum Menschen mit Beeinträchtigungen auf besondere Weise ausschloss. Sind schon die erzieherischen Motive (und deren Erfolg) für „normale“ Arme mehr als zweifelhaft und als menschenunwürdig zu betrachten, so schlugen sie hinsichtlich der in diesem Sinne nicht zur Arbeit „erziehbaren“ Menschen völlig fehl.
Lebten in dem 1656 in Paris ins Leben gerufenen „hôpital général“, das als Prototyp der später von Goffman (1973) beschriebenen „totalen Institutionen“ gelten kann, noch die unterschiedlichsten Insassen (Bettler, Waisen, Kinder, Alte, Straffällige, Kranke, „Behinderte“), so differenzieren sich diese Häuser im Laufe des 19. Jahrhunderts in Krankenheil- und Pflegeanstalten, Gefängnisse und vergleichbare Einrichtungen aus (Fornefeld 2013, 28 ff.; Häßler/Häßler 2005, 50 ff.). Dies hatte auch Konsequenzen für die medizinische, pflegerische, fürsorgerische und letztlich auch pädagogische Tätigkeit:
„Bis in die zweite Hälfte des 18. Jhs. schenkte man – von Ausnahmen abgesehen – behinderten Menschen in ihrer sozialen, gesundheitlichen und auch erzieherischen Not keine besondere Aufmerksamkeit. Nur sehr langsam entwickelte sich, angestoßen durch das Gedankengut der Aufklärung, ein spezifisches Interesse für behinderte Menschen, die sie aus der großen Masse der Armen und Kranken heraustreten ließ. Nicht nur die verstärkte Suche nach naturwissenschaftlich-medizinischen Erklärungen von Krankheiten führte zu einer intensiveren Erforschung der Ursachen von Behinderungen; auch die Pädagogik wandte sich – wenn auch nur am Rande – den zunächst für bildungsunfähig gehaltenen Blinden, Taubstummen und Schwachsinnigen zu“ (Thoma 2004, 85).
Andererseits geht mit der Pädagogik und der Entstehung der modernen Medizin, vor allem in der Psychiatrie, eine neue Form des Umgangs mit Menschen mit Beeinträchtigungen einher, da deren Krankheiten und Behinderungen nicht länger als „Gottesstrafe“ oder „Besessenheit“, sondern vielmehr als Ausdruck medizinisch zu verstehender Ursachen gesehen wurden. So etablierte etwa Wilhelm Griesinger (1817–1868) das Verständnis von Geistes- als Gehirnkrankheiten und öffnete damit das Feld für das medizinische Verständnis von geistigen Beeinträchtigungen und psychischen Krankheiten. Obwohl das medizinische Menschenbild der damaligen wie der heutigen Zeit dem sozialen in vielem konträr entgegensteht, gehen die beiden Disziplinen doch einige „Kooperationen“ ein und entwickeln dadurch auch Gemeinsamkeiten, wie sie etwa später in der bis heute von einer medizinischen Sichtweise geprägten Professionalität der Heilerziehung zum Ausdruck kommt (Buchkremer 1990, 59). Mit der Ausdifferenzierung und Entstehung der psychiatrischen Anstalten des 19. Jahrhunderts geht dann auch langsam die Erkenntnis einher, dass diagnostische und „therapeutische“ Unterscheidungen notwendig seien. So kategorisiert der schweizerische Arzt Johann Guggenbühl (1816–1862) „Kretine und Blödsinnige“ anders als „Idioten“, denn bei Ersten sei ein – seiner Ansicht nach letztlich behandelbares –„unbekanntes Agens“ am Werke, das „entweder schon vor der Geburt oder später die Ernährung von Gehirn und Rückenmark“ stört, und bei Letzteren sei „die Seele in ihrer irdischen Erscheinung erloschen“ (Hauss 1989, 30).
Der Arzt Alexander Haindorf (1782–1862) teilte in seinem „Versuch einer Pathologie und Therapie der Geistes- und Gemütskrankheiten“ aus dem Jahr 1811 die von ihm vorgefundenen klinischen Bilder der Betroffenen in drei Stufen ein, wovon die leichteste von ihm bereits als „schwerfälliges Lernen“ beschrieben wird und damit eine Nähe zur im Jahr 2017 gebräuchlichen Definition von Lernbeeinträchtigung in Abgrenzung zur stärkeren geistigen Beeinträchtigung aufweist (Hauss 1989). Er kommt damit Wilhelm Griesinger zuvor, der erst 1845 sein Lehrbuch „Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten“ herausbrachte und auch dort erst in der dritten Auflage bzw. durch eine post mortem erfolgte Erweiterung die geistige Beeinträchtigung als „Idiotismus und Blödsinn“ aufnimmt.
Allerdings stellt Haindorf Kindern mit geistigen Beeinträchtigungen das Urteil aus, sie stünden noch „unter dem Thiere“. Ganz anders betrachtet ein Zeitgenosse Haindorfs, der Arzt Julius Disselhoff (1827– 1896), die „Blödsinnigen“, da er in ihnen vor allem bemitleidenswerte Geschöpfe Gottes sah, denen man sich anzunehmen habe. Mit seinem 1857 erschienenen „Noth- und Hülferuf für die Verlassensten unter den Elenden an die deutsche Nation“ sorgte er für großes Aufsehen und in der Folge entstehen Anstalten, die sich speziell der Fürsorge für geistig beeinträchtige Menschen widmeten. In seiner öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung mit Vertretern der defizitären und moralisierenden Sichtweise kommt es u. a. auch zum Disput mit Alexander Haindorf und Heinrich Damerow (1798–1866). Letzterer bezeichnete „Blödsinnige“ als „seelenlose Geschöpfe“ und ordnete sie damit zwar nicht den „Thieren“ unter, trug so aber doch zur Vorstellung von Untherapierbarkeit bei (Thoma 2004, 91 f.).
Diesem Gedanken widersprachen dann nicht zuletzt einige der auch als Anstaltsgründer aktiven Personen, so u. a. Heinrich Matthias Sengelmann (1821–1899), der die Alsterdorfer Anstalten in Hamburg gründete, oder auch Friedrich von Bodelschwingh (1831–1910) mit seiner Anstalt für Epileptiker in Bethel. Überhaupt wuchs das Interesse an den „Blöd- und Schwachsinnigen“ vor allem, weil politisch aktive und pädagogisch interessierte Personen sich für diese Personengruppe einsetzten, ihr eine spezielle Fürsorge zukommen lassen wollten und weil sich, wie Blasius (1980, 22 ff.) herausstellt, die entstehende bürgerliche Gesellschaft ihrer Prinzipien von Freiheit und Menschenwürde bewusster wurde und diese auch den Menschen mit Beeinträchtigungen nicht länger vorenthalten wollte.
Aus den Armen- und Arbeitshäusern wurden daher nach und nach Krankenheilanstalten, Heil- und Pflegeanstalten bzw. Irrenanstalten. Allerdings lässt sich bis in die 1990er Jahre eine gemeinsame Unterbringung von psychisch kranken Menschen und Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen in deutschen Landeskrankenhäusern feststellen.
Die Pädagogik wird erst im 18. Jahrhundert als eigenständige Disziplin entdeckt, so widmet sich z. B. der Philosoph Immanuel Kant 1777 in seinen Vorlesungen zur Pädagogik das erste Mal dem erzieherischen Wirken. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts differenzieren sich die Sozialpädagogik (Johann Heinrich Pestalozzis (1764–1827) Umgang mit geistig beeinträchtigten Kindern: Fornefeld 2013, 33 f.) sowie die Heilpädagogik aus. Johann Georgens (1823–1886) und Heinrich Deinhart (1821–1880) legten mit ihrem Lehrbuch von 1861 „Die Heilpädagogik mit besonderer Berücksichtigung der Idiotie und der Idiotenanstalten“ den Grundstein einer Heilpädagogik, die sich der bislang vernachlässigten und erst durch die diversen Anstaltsgründungen zunehmend berücksichtigten Kindern mit geistigen Beeinträchtigungen, Jugendlichen und Erwachsenen annahm. Sie selbst gründeten 1856 die „Heilpflege- und Erziehungsanstalt Levana für Geistes- und Körperschwache Kinder“ in der Nähe von Wien. Allerdings gelangen auch Georgens und Deinhardt in ihrem moralischen Urteil zu dem Ergebnis, dass „Idiotismus […] eine tiefere Entartung […] mit dem Verlust der Menschlichkeit, d. h. dessen, was den Menschen zum Menschen macht“ (Hauss 1989, 62), sei, obwohl sie andererseits gerade eine Zuwendung zu den Betroffenen propagierten.
Besonders die schulische Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen wurde in der Folge von der Sonderpädagogik übernommen. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden dazu in Deutschland Erziehungs- und Bildungseinrichtungen mit einem besonderen, auf Kinder mit Lernschwierigkeiten zugeschnittenen Programm und z. T. auch eine Aussonderung aus den Heilanstalten mit Schulen in Pflegeabteilungen und sogenannte Bewahr-Anstalten (Störmer 2006).
Die entstandenen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen unternahmen erste pädagogische Versuche der Erziehung und Bildung von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung oder einer Beeinträchtigung der Sinne. Der Arzt und Leiter der Pariser „Idiotenschule“, Edouard Séguin (1812–1880), entwickelte zum Beispiel das „Konzept der ‚physiologischen Erziehung‘, als Sinnes- und Funktionsschulung, weiter“ (Fornefeld 2013, 34) und begründete damit in gewisser Weise heutige heilpädagogische Förderkonzepte, wie z. B. das der sensorischen Integration. Auch wuchs das Interesse, betroffene Kinder aus den Heilanstalten zu nehmen und ihnen ein gewisses Maß an Bildung zukommen zu lassen (Störmer 2006).
Obwohl durchaus ein reformerischer Bildungsoptimismus vorherrschte, wurden bereits hier durch das Differenzkriterium „bildungsunfähig/bildungsfähig“ die später arbeitsfähigen von den auf Dauer nicht arbeitsfähigen Kindern und Jugendlichen getrennt. Für Letztere blieb in der Folge meist nur die Arbeit in der Anstalt übrig, die zwar zu keiner Verselbstständigung, aber doch zu einer Beschäftigung führte, was dann seit Ende des 19. Jahrhunderts zu arbeitspädagogischen Abteilungen und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Entwicklung der Ergotherapie und den Werkstätten für behinderte Menschen führte.
Opp (2005a) stellt für die Geschichte der Heil- und Sonderpädagogik ein weiteres Differenzkriterium heraus, indem er die „Sprachfähigkeit“ des Menschen als einen Unterscheidungspunkt zu den Tieren insbesondere im Zuge der Aufklärung betont und zeigt, dass dies auch den Erziehungsoptimismus einiger Pioniere der Erziehung von damals sogenannten „schwachsinnigen Kindern“ prägte. Wo Kinder noch über ein Restvermögen verfügten, sich über Sprache zu verständigen, wurden sie auch schulisch gefördert, wie es etwa der Erzieher des Wolfskindes „Viktor“, Jean Itard (1774–1838), und sein Schüler Eduard Séguin (1812–1880) in ihrem Erziehungs- und Bildungsprogramm vorsahen.
Interessant ist an dieser Stelle, dass zunächst Sprachfähigkeit als Ausdruck von Bildungsfähigkeit angesehen wird und sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts langsam ein Verständnis herausbildet, dass auch bei nonverbaler Kommunikation eine Bildungsmöglichkeit gegeben ist bzw. grundsätzlich eine Bildsamkeit, auch bei schwereren Beeinträchtigungen mit z. T. sehr eingeschränkter Mitteilungsmöglichkeit, vorhanden ist.
In der Weimarer Republik haben die medizinisch geprägten Anstalten und die pädagogisch geprägten Schulen weiter Bestand, lediglich für den Bereich der körperlich beeinträchtigten Menschen entwickelt sich mit dem rehabilitativen Ansatz eine neue Versorgungsstruktur (Hausdörfer-Reinert 2005). Bereits 1906 hatte der Arzt Konrad Biesalski (1868–1930) erstmals Erhebungen über die Zahl der verkrüppelten Kinder in Preußen durchgeführt, was zu einer Diskussion über die Notwendigkeit der öffentlichen Fürsorge für diesen Personenkreis und zur Gründung der „Deutsche Vereinigung für Krüppelfürsorge“ (heute: Deutsche Vereinigung für Rehabilitation) führte. Durch die „Kriegsbeschädigtenfürsorge“ wurde dann, letztlich durch die große Zahl der im Ersten Weltkrieg verwundeten Soldaten, die Körperbehindertenrehabilitation befördert und schließlich durch den Erlass des „Preußischen Gesetzes betreffend die öffentliche Krüppelfürsorge“ vom 6. 5. 1920, für die „unbemittelten“ Krüppel unter 18 Jahren als öffentliche Fürsorge anerkannt. In Deutschland gab es 1906 schon 27 Anstalten und 1927 bereits 78 Anstalten.
In den 1920er Jahren begannen sich dann eugenische Vorstellungen durchzusetzen, von denen die wohl bekannteste und erschreckendste die Arbeit des Strafrechtlers Karl Binding und des Psychiaters Alfred Hoche ist. Sie prägten in ihrer Schrift „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form“ von 1920 den Begriff der „Ballastexistenzen“ und bereiteten die Euthanasie der Nationalsozialisten ideell vor. Diese setzen sie unter anderem mithilfe des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ von 1933 und dem beispiellosen Verbrechen gegen Menschen mit Beeinträchtigungen um, durch das 300. 000 bis 400. 000 von ihnen zwangssterilisiert, ca. 5. 000 Kinder und weitere 70. 000 Erwachsene ermordet wurden (Dörner 2006, 26; Klee 1983).
Die Nachkriegsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland ist dann vom (Wieder-)Aufbau einer humaneren Behandlung, Pädagogik und Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen geprägt (zur Entwicklung in der DDR siehe Häßler/Häßler 2005, 84 ff. und Theunissen 2006b).
Lindmeier/Lindmeier (2006) beschreiben für die Sonderpädagogik drei Phasen: In den 1950er Jahren dominierte vor allem der Aufbau von Schulen für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Beeinträchtigung, die zunächst Hilfsschulen und später Sonderschulen genannt wurden. Auch die Reformulierung des Familienbegriffs und ihre Entlastung vom ideologischen Ballast des NS-Regimes schaffte ein neues Klima der Förderung von Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung, wenn auch zunächst sehr verhalten. 1958 kam es dann jedoch auf Initiative des Beauftragten für „Displaced Persons“ der Vereinten Nationen, des Niederländers Tom Mutters, zur Gründung des Vereins „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“, dem sich zunächst 15 Eltern und Fachleute anschlossen und der in der weiteren Zeit als „Lebenshilfe“ zu einem der bedeutendsten Akteure in der Behindertenhilfe und schließlich auch zu einem bundesweit aktiven Träger von Einrichtungen werden wird.
In den 1970er Jahren entwickelten sich zunehmend integrative Ansätze, zunächst im Schulbereich und später auch bezogen auf Wohneinrichtungen und Arbeitsbereiche. Mit der Eingliederungshilfe im BSHG (1961), dem Schwerbehindertengesetz (1974), dem Rehabilitationsangleichungsgesetz (1974), der Werkstättenverordnung (1980) und dem Neunten Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) von 2001 entstehen wichtige Gesetze, die diese Entwicklung befördern. Innerhalb der allgemeinen Selbsthilfebewegung der 1980er entsteht die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Seit den 1990ern werden dann zunehmend Modelle der Integration und der Inklusion diskutiert und praktiziert (Kap. 3).
Übungen zu Kap. 2
1. Zu welcher Zeit und warum wurden die früher gemeinsam internierten Personengruppen der psychisch kranken bzw. der Menschen mit einer Beeinträchtigung von anderen Personengruppen in den Armen- und Arbeitshäusern getrennt?
2. Diskussions-/ Reflexionsfrage: Wie stark war der Einfluss der veränderten Produktionsweise des Kapitalismus auf den professionellen Umgang mit Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung und psychisch kranken Menschen?
3. Diskussions-/Reflexionsfrage: Beschäftigen Sie sich mit der Euthanasie der NS-Zeit, insb. mit der sog. T4-Aktion und finden Sie Details über die Verbrechen an Menschen mit einer körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigung heraus. Gibt es Kontinuitäten zur heutigen Zeit und dem Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen und wenn ja, welche?
2.2 Wissenschaftstheoretisches Verständnis: Soziale Arbeit zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften
In diesem Abschnitt wird die Soziale Arbeit wissenschaftstheoretisch als eine Querschnittswissenschaft verstanden, die zwischen einer reinen sozial- oder einer reinen geisteswissenschaftlichen Orientierung verortet werden kann. Sozialarbeitswissenschaft ist eine eigenständige Fachwissenschaft des Sozialen. Man spricht jedoch besser von einer Wissenschaft der Sozialen Arbeit, da dies sozialarbeiterische und sozialpädagogische Herkünfte und Ansätze vereint.
Für die Frage nach einer professionellen wie disziplinären Verortung Sozialer Arbeit in der Behindertenhilfe scheint zunächst der Rückgriff auf wissenschaftstheoretische Erörterungen nachrangig.
Jedoch kommt keine Wissenschaft ohne eine solche Klärung des Vorverständnisses allen forschenden und praktischen Handelns aus, will sie sich ihrer Stellung und ihres Wissensbereiches innerhalb der Wissenschaftslandschaft bewusst werden. Spätestens seit der Ausdifferenzierung der Wissenschaften im 19. Jahrhundert stellt sich für jede Fachwissenschaft, und somit auch für die Sozialarbeitswissenschaft bzw. Wissenschaft der Sozialen Arbeit (vgl. zur Unterscheidung Erath/Balkow 2016, 157 ff.), die Frage nach ihren metatheoretischen Grundlagen.
Die Soziale Arbeit als noch junge Fachwissenschaft, deren Existenz erst 2001 in Deutschland durch die Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz anerkannt wurde, benötigt noch viel mehr ein solches Vorverständnis, um den daraus abzuleitenden Gegenstand zu bestimmen.
Die Fragen, die dabei gestellt werden müssen, sind ebenso Fragen des Erkennens selbst als auch der Organisation dieser Erkenntnis innerhalb einer Wissensgesellschaft. Erkennen als Fähigkeit, sich der Wahrnehmung der Welt bewusst zu werden, stellt allerdings für die Soziale Arbeit nur einen Zugang zur Wirklichkeit dar. Zugleich ist sie eine Handlungswissenschaft, deren Professionalität darin besteht, sich auf gesellschaftlich und professionell deklarierte Aufträge zu konzentrieren, die sie dann mit einer möglichst hohen Fachlichkeit ausführt. Gleichzeitig überschneidet sich das berufliche Helfen als „inszenierte Solidarität“ (Rauschenbach 1994, 231 ff.) mit der ontologischen Eigenart des Menschen, anderen Menschen zu helfen. Inszenierte Solidarität ergänzt somit in der Moderne die natürliche Solidarität der kleinen Sozialverbünde von Familie, Dorf oder Zunft, wie sie in der Vormoderne beherrschend waren. Heute würden wir sagen, dass Soziale Arbeit als professionelles Tun von sozialer Arbeit als (auch ehrenamtliches) Helfen unterschieden werden muss. Über den Gegenstand und die Funktion wird in Kapitel 2.3 ausführlicher zu sprechen sein.
Wissenschaftstheoretisch spricht vieles dafür, Soziale Arbeit als interdisziplinäre Wissenschaft (Erath / Balkow 2016, 164) zu verorten. Ordnet man sie den Sozialwissenschaften zu (Engelke et al. 2016, 45), so gehört sie zur angewandten Sozialwissenschaft und wird damit als Handlungswissenschaft verstanden (Birgmeier 2014; Röh 2013; Birgmeier / Mührel 2011; Staub-Bernasconi 2007). Die sozialwissenschaftliche Seite der Sozialen Arbeit wird später die Grundlage für die Darstellung der Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen (Kap. 3.3) sein und die handlungswissenschaftliche Seite die Grundlage für die professionelle Bestimmung der Sozialen Arbeit in der Behindertenhilfe (Kap. 4). In der Tat spricht einiges dafür, diesen Handlungsbezug als eine Variante der wissenschaftslogischen Verortung Sozialer Arbeit zu begreifen, wenngleich gegen die „Angewandtheit“ auch Vorbehalte bestehen (Erath/Balkow 2016, 163). Eine andere mögliche Variante besteht darin, sie (wieder) näher an geisteswissenschaftliche Denklinien heranzuführen und damit dem „Verstehen“ eine ebenso gewichtige Bedeutung beizumessen wie dem „Handeln“ (Röh 2008). Handlungstheoretisch ausformuliert finden wir hierzu gute Ansätze bei Mührel (2005), der „Verstehen“ als etwas Ontologisches, ein stetiges „Erleiden und eine Widerfahrnis“ (84) begreift und gleichzeitig „Verstehen“ als eine notwendige Form des Zugangs zum anderen und damit auch zum Hilfesuchenden konzipiert – ohne indessen in eine reine Methodik, sprich Sozialtechnologie, zu verfallen. Gerade in der Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, bei denen mitunter Veränderungen durch pädagogische Einflussnahme seltener herbeigeführt werden können, weil Lernprozesse viel langsamer verlaufen, bedarf es einer gekonnten verstehenden Haltung, wie sie sich beispielsweise mithilfe der Syndromanalyse erreichen lässt (Zimpel 1994, 2010).
Mit Marquard (2003) könnte man folgende Geschichtentypen für die geisteswissenschaftliche Funktion der Sozialen Arbeit heranziehen: Sensibilisierungs-, Orientierungs- und Bewahrungsgeschichten liefern uns ein handlungstheoretisches Programm, entlang dessen wir Soziale Arbeit sowohl in ihrer sensibilisierenden, orientierenden als auch bewahrenden Funktion verstehen können. Für die Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe ließe sich diese in analoger Form wie folgt beschreiben:
■ Sensibilisierungsgeschichten stünden hier für Strategien und Wege, die versuchen, die besondere Lebenssituation, die besondere Verletzlichkeit und den Anspruch auf eine menschenwürdige Begleitung und Assistenz von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu verdeutlichen, sie zu benennen, der Öffentlichkeit zu präsentieren, und daraus Ansprüche auf einen humanen Umgang mit ihnen abzuleiten.
■ Orientierungsgeschichten würden uns weiterhin dabei helfen, die richtigen ethischen Entscheidungen in der Behindertenhilfe zu treffen, indem die Orientierungen offengelegt, diskutiert und damit fundiert werden, an denen wir alltäglich, professionell, aber auch politisch Handlungen bemessen können.
■ Bewahrungsgeschichten würden schließlich dazu dienen können, die moderne, vor allem im kapitalistischen Produktionssystem zu verzeichnende Dynamisierung des Alltagslebens durch die quasi kompensatorische Rückbesinnung auf weitere Werte (Muße, Rücksicht, Solidarität) abzufedern bzw. zu bremsen.
Wie man also sieht, kann durch das Marquard’sche Geschichtenerzählen, aber auch Geschichtenerleben, also die biografische wie alltägliche Rekonstruktion der lebensweltlichen Geschehnisse, eine Orientierung erreicht werden, die weit über die wissenschaftliche und professionelle Expertise hinausgeht.
Soziale Arbeit in der Tradition von Sozialpädagogik hat sich dabei schon immer einer gewissen Nähe zu geisteswissenschaftlichen Positionsbestimmungen erfreut, die sie fruchtbar vom naturwissenschaftlichen Weltverständnis abzugrenzen half (Winkler 1997).
Meines Erachtens sollte sowohl der sozialpädagogische, in diesem Sinne hermeneutisch-geisteswissenschaftliche Zugang mit seinen Implikationen bzgl. der Erziehung und Bildung, als auch der sozialarbeiterische, in diesem Sinne als angewandter sozialwissenschaftlicher Zugang im Sinne der Existenzsicherung zu einem modernen Bild als „Soziale Arbeit“ vereint werden.
Die bisherigen Ausführungen zusammenfassend, könnte man sagen, dass
„Soziale Arbeit […] als eine Wissenschaft und Profession definiert [werden kann], die sich – in Abgrenzung zu sozial- oder geisteswissenschaftlichen Disziplinen – mit der konkreten Handlung von Menschen beschäftigt. Sie wird damit selbst zu einer Handlungswissenschaft vom Handeln in sozialen Strukturen und damit zu einer praxeologischen Wissenschaft“ (Röh 2013, 267).
Übungen zu Kap. 2.2
4. Verständnisfrage: Wofür steht die Formel von einer „inszenierten Solidarität“?
5. Diskussions-/ Reflexionsfrage: Welche Gründe sprechen dafür, Soziale Arbeit den Sozialwissenschaften und welche dafür, sie den Geisteswissenschaften zuzuordnen? Was bedeutet es, sie als transdisziplinäre Wissenschaft zu konzipieren?
2.3 Gegenstand und Funktion Sozialer Arbeit
Eine genaue Gegenstands- und Funktionsbestimmung hilft, den professionellen Rahmen für eine Soziale Arbeit festzulegen. Sie wird hier anhand einer integrativen Fassung Sozialer Arbeit als komplementärem Gebilde aus Sozialarbeit und Sozialpädagogik vorgenommen, u. a. untermauert von der IFSW-Definition und einem ersten Blick auf soziale Probleme bzw. Lebensführung als Gegenstand der Sozialen Arbeit.
Die Relevanz der Sozialen Arbeit in der Rehabilitation stellte bereits Mühlum heraus:
„Sonderpädagogik und Soziale Arbeit können als gesellschaftlich organisierte Hilfe für Menschen mit besonderen Schwierigkeiten verstanden werden. Ihre Bedeutung für die Rehabilitation steht somit außer Frage. Tatsächlich stellen sie, neben Medizin und Pflege, den größten Bereich personenbezogener Dienste dieses Sektors dar. Ihre Abgrenzung (und Zusammenarbeit) ist jedoch nach wie vor schwierig, weil sich die Aufgaben überschneiden und das Selbstverständnis nicht hinreichend geklärt ist. Sozialarbeit/Sozialpädagogik hier, Sonderpädagogik / Behindertenpädagogik/Heilpädagogik dort stellen mehr als ein Begriffsdilemma dar. Sie drücken auch inhaltliche Unterschiede und berufliche Grundüberzeugungen aus“ (Mühlum 1999, 49).
Diese von Mühlum formulierte Idee einer professionellen Differenzierung bei gleichzeitiger Forderung einer „ganzheitlichen Perspektive“ soll hier aufgenommen und das Spezifikum Sozialer Arbeit als „ganzheitliche“ Profession zum Ausgangspunkt der Überlegungen zum Gegenstand und der Funktion Sozialer Arbeit genommen werden. Es wird darum gehen, die Soziale Arbeit als Profession bzw. als professionelles Handeln zu bestimmen und diesen Standort für die Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe zu erschließen.
Doch was ist der Gegenstand der Sozialen Arbeit? Mit der 2014 verabschiedeten Definition der International Federation of Social Workers (IFSW) beginnend, kann dieser zunächst wie folgt verstanden werden:
„Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing“ (IFSW 2014).
Man sieht, dass die vor allem in Deutschland vorzufindende Trennung von Sozialarbeit und Sozialpädagogik im internationalen Rahmen unbekannt ist. Anders als in der Definition von 2000, in der gleichermaßen die persönliche Befähigung und die Sicherung der Existenzgrundlagen sowie die Umweltveränderung erwähnt wurden, fokussiert die im 21. Jahrhundert geltende Definition zwar auch die Arbeit an bzw. mit Menschen („people“) und Umwelt („structures“), damit den Herausforderungen des Lebens („life challenges“) begegnet werden kann, verstärkt jedoch den strukturellen Anspruch („promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people“). Diese Dualität von Person und Umwelt ist zwar weit mehr als die reine Addition von Sozialarbeit und Sozialpädagogik, da eher im Sinne von Mühlum (2001) von einer Subsumtion unter den neuen Titel„Soziale Arbeit“ ausgegangen werden kann, jedoch ließe sich das Verhältnis beider wie in Abbildung 1 eher als Konversion darstellen, aus dem ein emergentes Produkt entsteht.
Abb. 1: Gegenstand und Funktion Sozialer Arbeit
Ein solchermaßen integratives Modell von Sozialer Arbeit, welches sowohl individuelle als auch Einflüsse aus der Umwelt auf die Entstehung von Sozialen Problemen bzw. die Lebensführung berücksichtigt, kombiniert damit auch den klassisch sozialpädagogischen Zugang zur Lebenswelt der Menschen vor dem Hintergrund ihrer Lebensführung mit dem klassisch sozialarbeiterischen Zugang zur Lebenswelt der Menschen vor dem Hintergrund sozialer Gerechtigkeit.
Soziale Arbeit hat es in der beruflichen Realität potenziell mit einer Vielfalt von verschiedenen menschlichen Problemen zu tun und konkret jeweils mit bestimmten menschlichen Lebenslagen, in denen häufig vielfältige Probleme auftreten.
Die Probleme sind dabei in ihrer Wirkung im doppelten Sinne als soziale Probleme zu bezeichnen, und zwar zunächst im gesellschaftlichen Rahmen als verbreitete Phänomene (Armut, Obdachlosigkeit, Gewalt, Sucht, Beeinträchtigung, Kindeswohlgefährdung usw.) und gleichzeitig als Probleme von Individuen in ihrer Umwelt und damit Probleme der Lebensführung.
Ich betrachte Soziale Arbeit daher als „jene Humanprofession und -disziplin […], die sich als Expertise für die Zusammenhänge von Subjekt und Gesellschaft verstehend, erklärend und bei Bedarf intervenierend (beratend, vermittelnd, unterstützend, empowernd etc.) mit deren Wechselwirkungen beschäftigt“ (Röh 2016a, 218 f.). Mithilfe des Capabilities Approach und des Kritischen Realismus habe ich (Röh 2013) eine allgemeine Handlungstheorie formuliert, die Soziale Arbeit als Unterstützung einer „daseinsmächtigen Lebensführung“ definiert. Ohne das an dieser Stelle ausführlich darstellen zu können (Kap. 4.2.5), sollen bzgl. der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen vorab folgende Ableitungen getroffen werden:
■ Das Leben mit Beeinträchtigung ist wie alles menschliche Leben von der Notwendigkeit geprägt, das eigene Leben über die gesamte Lebensspanne führen zu müssen.
■ Neben individuellen Beeinträchtigungen (in der ICF-Terminologie als Störungen der Körperstrukturen oder Körperfunktionen bezeichnet), die ich in meiner an den Capabilities Approach angelehnten Terminologie als Einschränkungen des „persönlichen Möglichkeitsraums“ verstehe (Röh 2013 und Röh 2016b), stehen dabei vor allem die Aktivitäts- und Teilhabeeinschränkungen im Mittelpunkt der Bewältigung. Diese verstehe ich als Probleme des „gesellschaftlichen Möglichkeitsraums“, wobei sich in den Aktivitätseinschränkungen auch Probleme des „persönlichen Möglichkeitsraums“ zeigen.
■ Ein daseinsmächtiges oder gutes Leben ist von dem sinnvollen „Ins-Verhältnis-Bringen“ des persönlichen und gesellschaftlichen Möglichkeitsraums geprägt. Eine vollständige Übereinstimmung könnte Inklusion oder Teilhabe bedeuten, ist aber angesichts bei allen Menschen und Gesellschaften vorfindlichen Restriktionen eher als unwahrscheinlich anzusehen. Das Ziel eines in dieser Hinsicht besseren Passungsverhältnisses ist jedoch das Ziel Sozialer Arbeit.
■ Behinderung als solches (anders als die Beeinträchtigung) selbst ist ein sowohl individuelles wie auch soziales Problem, insofern sich Umweltgestalt und Umweltbedingungen sowie individuelle und soziale Ressourcen und Probleme zu einer für den Einzelnen wie für die Gesellschaft zu bewältigenden Einheit verbinden.
■ Das im engeren Sinne sozialpädagogische Ziel in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen besteht daher in der größtmöglichen Förderung von Autonomie, Selbstbestimmung und soweit es geht auch Selbstständigkeit in der alltäglichen Lebensführung.
■ Das im engeren Sinne sozialarbeiterische Ziel liegt in der Verbesserung der Person-Umwelt-Transaktionen, d. h. in der Befriedigung der biopsychosozialen Bedürfnisse eines Menschen (mit Beeinträchtigungen).
■ Beiden gemeinsam ist in der konvergenten Fassung als Soziale Arbeit, dass die Entwicklung von Lebensperspektiven und somit die Lebensführungskompetenz zu fördern und zu erhalten ist.
In einer Sozialen Arbeit in der Behindertenhilfe kommen also zwei Zugänge zusammen und bilden erst gemeinsam die spezielle Expertise: Der Einzelne mit seiner Beeinträchtigung erlebt sich selbst und andere in einer gegebenen Umwelt, die ihm entweder Möglichkeiten oder Begrenzungen bietet (Röh 2013 und 2016b). Er selbst ist durch seine Beeinträchtigung, Sozialisationserfahrungen und Persönlichkeit hinsichtlich seiner Bewältigungskompetenz in einem gewissen Maße befähigt, sich diese Umwelt für ein daseinsmächtiges Leben (auch) mit Beeinträchtigung anzueignen. Wo immer diese Aneignung nicht dazu ausreicht, die Bedürfnisse des Einzelnen zu befriedigen, da entweder die individuellen oder die sozialen Ressourcen nicht genügen oder aber die Gesellschaft ihrerseits mit Restriktionen auf den Menschen mit Beeinträchtigung reagiert, kann die Soziale Arbeit mit ihrer Professionalität auf diese „Transaktionsstörungen“ reagieren und versuchen, sie mittels professioneller Interaktionen zu beheben. Ihr vorderstes Ziel ist es dabei, ihre Klientel kurz-, mittel- oder langfristig zu einem selbstständigen und selbstbestimmten Leben zu befähigen.
Übungen zu Kap. 2.3
6. Verständnisfrage: Wie lautet die Definition Sozialer Arbeit der IFSW?
7. Diskussions-/Reflexionsfrage: Wie stehen Sozialarbeit und Sozialpädagogik in einem integrativen Modell Sozialer Arbeit zueinander?
8. Diskussions-/ Reflexionsfrage: Was bedeutet Daseinsmächtigkeit im Zusammenhang mit „Behinderung“?
2.4 Ethisch-moralische Grundlagen
Neben allgemeinen ethischen Überlegungen zur Sozialen Arbeit werden in diesem Abschnitt der Berufskodex und die Formel von der „Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession“ vorgestellt. Des Weiteren erfolgen Ausführungen zu relevanten gerechtigkeitstheoretischen Erwägungen im Zusammenhang mit dem Capabilities Approach.
Vor allem die grausamen Erfahrungen während der NS-Diktatur in Deutschland haben eine erhöhte Wachsamkeit in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch bei anderen vulnerablen und von Ausgrenzung bedrohten Gruppen zur Folge gehabt.
Die Debatten um eine Bio-Ethik sowie um die utilitaristische Begründungen von Sterbehilfe und Forschung an nicht einwilligungsfähigen Menschen mit Beeinträchtigungen stellen zudem eine fortwährende Bedrohung des erreichten ethischen Niveaus einer akzeptierenden und fördernden Gesellschaft dar (Hedderich et al. 2016).
Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe bedarf daher einer grundlegenden Klärung ihrer ethisch-moralischen Grundlagen, die im Sinne einer praktischen Ethik auch normative Hinweise gibt für eine gute Kultur im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen und auf berufsethische Dilemmata sowie auf gesellschaftliche Mechanismen hinweist. Dabei sind Werte und Werturteile immanenter Teil professioneller Praxis und diese Praxis benötigt neben klaren handlungsleitenden Vorgaben auch eine reflexive Kompetenz zur situativen Klärung von Dilemmata.
Eine Ethik der Sozialen Arbeit ist dabei immer eine plurale Ethik, die jedoch vereint wird in der Anerkennung und Wertschätzung der menschlichen Würde, die spätestens seit Kant auch säkular begründet werden kann. Im religiösen Verständnis wurde und wird die Würde des Menschen durch die Gottesähnlichkeit des Menschen definiert:
„Die Gottebenbildlichkeit (lat. : imago dei) ist die Voraussetzung dafür, dass der Mensch im verschiedenen Maße und nie absolut Gottähnlichkeit (lat. : similtudo dei) erreichen kann. Als Ebenbild Gottes ist damit der Mensch in Freiheit gesetzt, sein Leben zu realisieren und schöpferisch zu gestalten; jedoch gemäß den Vorstellungen eines der Offenbarung Gottes gemäßen Lebens“ (Mührel/Röh 2008, 52).
Baumgartner (2004, 268) fasst die Menschenwürde deshalb wie folgt zusammen:
„Menschenwürde heißt nach christlichem Verständnis, dass jedem, der Menschenantlitz trägt, in jeder Phase seines individuellen Entwicklungsstands und unabhängig, von seinen Eigenschaften und Leistungen ein unbedingter Wert zukommt, der – negativ – jede instrumentalisierende Verrechnung verbietet. “
Daneben existiert spätestens seit Immanuel Kant eine philosophische Auffassung der menschlichen Würde durch das sogenannte Instrumentalisierungsverbot, das bei Kant wie folgt definiert wird:
„Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. “
Diese, auch als praktischer Imperativ bekannt gewordene Definition von Menschenwürde, erweitert den kategorischen Imperativ, der besagt: „Handle stets so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zur allgemeinen Gesetzgebung reiche“ (Kant, zitiert nach Eisenmann 2006, 84).
2.4.1 IFSW-Kodex
Die Soziale Arbeit verfügt darüber hinaus über einen berufsspezifischen Kodex, der gemeinsam von der International Association of Schools of Social Work (IASSW) und der International Federation of Social Workers verfasst wurde und sich auch in der Definition Sozialer Arbeit durch die IFSW (2014) wiederfindet. Dort werden die Prinzipien der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit als Grundlage der Sozialen Arbeit festgehalten. Zudem bestimmt der Ethik-Kodex von 2012 die besondere Aufgabe der SozialarbeiterInnen darin, das Selbstbestimmungsrecht, die menschliche Vielfalt und das Recht auf Teilhabe („participation“) zu achten und zu befördern, die Menschen ganzheitlich zu betrachten, ihre Stärken zu identifizieren und zu fördern, für eine gerechte Ressourcenverteilung einzustehen und Diskriminierung entgegen zu wirken (IFSW 2012).
Im Einzelnen bedeutet dies für den Bereich der Menschenrechte bzw. Menschenwürde:
„1. Das Recht auf Selbstbestimmung achten: Sozialarbeiter/innen sollten das Recht der Menschen achten und fördern, eigene Entscheidungen zu treffen, ungeachtet ihrer Werte und sonstigen Lebensentscheidungen, vorausgesetzt, dass dadurch nicht die Rechte und legitimen Interessen eines anderen gefährdet werden.
2. Das Recht auf Beteiligung fördern: Sozialarbeiter/innen sollten die Teilhabe der Menschen, die ihre Dienste nutzen, fördern, sodass sie gestärkt werden können, in allen Aspekten von Entscheidungen und Handlungen, die ihr Leben betreffen, mitzubestimmen.
3. Jede Person ganzheitlich behandeln: Sozialarbeiter/innen sollten sich mit der Person als Ganzes innerhalb der Familie, der Gemeinschaft, sowie der sozialen und natürlichen Umwelt beschäftigen, und sollten darauf bedacht sein, alle Aspekte des Lebens einer Person wahrzunehmen.
4. Stärken erkennen und entwickeln: Sozialarbeiter/innen sollten den Schwerpunkt auf die Stärken des Einzelnen, der Gruppen und der Gemeinschaften richten um dadurch ihre Stärkung weiter zu fördern. “
Die Soziale Gerechtigkeit ist konkret wie folgt zu erreichen:
„1. Negativer Diskriminierung entgegentreten: Sozialarbeiter/innen haben die Pflicht, negativer Diskriminierung aufgrund von Merkmalen wie Fähigkeiten, Alter, Kultur, Geschlecht, Familienstand, sozioökonomischem Status, politischer Überzeugung, Hautfarbe, Rasse oder anderer körperlicher Gegebenheiten, sexueller Orientierung, oder spiritueller Überzeugung entgegenzutreten.
2. Verschiedenheit anerkennen: Sozialarbeiter / innen sollten die ethnischen und kulturellen Unterschiede von Gesellschaften in denen sie arbeiten anerkennen und respektieren und die Unterschiede von Einzelnen, Gruppen und Gemeinschaften beachten.
3. Gerechte Verteilung der Mittel: Sozialarbeiter/innen sollten sicherstellen, dass die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel gerecht – gemäß den Bedürfnissen – verteilt werden.
4. Ungerechte Politische Entscheidungen und Praktiken zurückweisen: Sozialarbeiter/innen haben die Pflicht, ihre Arbeitgeber, Gesetzgeber, Politiker und die Allgemeinheit darauf aufmerksam zu machen, wo Mittel unzulänglich sind oder wo die Verteilung von Mitteln durch Verordnungen und Praxis unterdrückerisch, ungerecht oder schädlich ist.
5. Solidarisch arbeiten: Sozialarbeiter/innen haben die Pflicht, sozialen Bedingungen entgegenzutreten, die zu sozialem Ausschluss, Stigmatisierung oder Unterdrückung führen. Sie sollen auf eine einbeziehende Gesellschaft hinarbeiten. “
Diese ethischen Prinzipien, die darüber hinaus in nationale Konkretisierungen gefasst wurden (u. a. durch den Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit e. V. 2014), sollen der Sozialen Arbeit als Leitlinie für ein angemessenes ethisches Handeln dienen.
2.4.2 Menschenrechtsprofession
Die bereits in den Definitions- und Ethikdokumenten der IFSW und der IASSW enthaltenen Implikationen hinsichtlich einer besonderen Berücksichtigung der Menschenrechtsperspektive haben dazu geführt, dass bereits 1992 vom „Center of Human Rights“ der Vereinten Nationen, von der IFSW und von der IASSW die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession ausgerufen wurde. Die auf Grundlage einer bedürfnistheoretischen Begründung erfolgende Verortung Sozialer Arbeit bestimmt daher ihren ethischen Auftrag in der Wahrung der Menschenrechte als der menschlichen Natur eigene Rechte, ohne die
„wir als menschliche Wesen nicht existieren können. Die Menschenrechte und die grundlegenden Freiheiten erlauben uns, unsere menschlichen Fähigkeiten, unsere Intelligenz, unsere Begabungen und unser moralisches Bewusstsein voll zu entwickeln und zu gebrauchen und unsere geistigen und sonstigen Bedürfnisse zu befriedigen. Sie gründen im zunehmenden Verlangen der Menschheit nach einem Leben, in dem die unveräußerliche Würde und der Wert jedes einzelnen Menschen Anerkennung und Schutz findet“ (Vereinte Nationen 1987, zitiert nach UN-Manual 2002, 5).
Seitdem wurde die Bestimmung Sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession immer wieder diskutiert (Mührel/Birgmeier 2013). Insbesondere Silvia Staub-Bernasconi hat diesen Ansatz aufgenommen und in verschiedenen Publikationen (2016) expliziert. Dabei kommt deutlich zum Ausdruck, dass sich das damit verbundene normativ-ethische Grundverständnis mittels einer Gegenstandsbestimmung Sozialer Arbeit entlang von Bedürfniskategorien für das professionelle Handeln von SozialarbeiterInnen erschließen lässt (Kap. 4.2.2).
Innerhalb dieses Konzepts werden Menschen als wissens- und handlungsfähige Biosysteme erfasst, die durch biopsychosozial zu verstehende Bedürfnisse bestimmbar sind. Damit steht die Systemtheorie der Zürcher Schule in der Tradition früherer Überlegungen innerhalb der Sozialen Arbeit, von denen die Bedürfnistheorie Ilse Arlts die bekannteste sein dürfte. Arlt verstand Bedürfnisse ebenfalls als eine conditio humana und schuf für sie den Begriff „Gedeihenserfordernisse“, deren Befriedigung die notwendige Bedingung für ein Leben bedeutet, welches sich durch die Fähigkeit zu einem ‚schöpferischen Konsum‘ auszeichnet (Arlt 1958, 60, 74).
Wo diese Bedürfnisse, deren normative Ausformung in den Menschenrechten zu sehen ist, nicht befriedigt werden, entstehen soziale Probleme. Im Zuge der Anwendung der Formel „Soziale Arbeit als eine Menschenrechtsprofession“, von Staub-Bernasconi (2003), gewinnt Soziale Arbeit zusätzlich zum doppelten Mandat (Böhnisch/Lösch 1973) ein weiteres Mandat, das als eigenständiger, von der Gesellschaft und der Klientel unabhängiger Auftrag der Sozialen Arbeit aufgefasst wird (Tripelmandat). Diese Selbstmandatierung beruht im Wesentlichen auf der Verteidigung und Wahrung der Menschenrechte in den je spezifischen Handlungskontexten der Sozialen Arbeit und einer wissenschaftlichen Basis (Ife 2012).
Tab. 1: ausgewählte Artikel der Behindertenrechtskonvention im Überblick
| Artikel | Überschrift |
| 9 | Zugänglichkeit |
| 10 | Recht auf Leben |
| 11 | Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen |
| 12 | Gleiche Anerkennung vor dem Recht |
| 13 | Zugang zur Justiz |
| 14 | Freiheit und Sicherheit der Person |
| 15 | Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe |
| 16 | Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch |
| 17 | Schutz der Unversehrtheit der Person |
| 18 | Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit |
| 19 | Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft |
| 20 | Persönliche Mobilität |
| 21 | Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen |
| 22 | Achtung der Privatsphäre |
| 23 | Achtung der Wohnung und der Familie |
| 24 | Bildung |
| 25 | Gesundheit |
| 26 | Habilitation und Rehabilitation |
| 27 | Arbeit und Beschäftigung |
| 28 | Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz |
| 29 | Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben |
| 30 | Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport |
Zuletzt haben die Vereinten Nationen mit dem „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“, das 2006 von der Generalversammlung verabschiedet und von der Bundesrepublik Deutschland 2008 ratifiziert wurde, ein menschenrechtliches Dokument und Instrument in die Welt gesetzt, das den Menschenrechtsgedanken für die spezifischen Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen durchdekliniert (Tab. 1). Es handelt sich nicht um ein Dokument „anderer Menschenrechte“, sondern nur um eine Spezifizierung. Sie nennt Menschenrechte in verschiedensten Lebensbereichen.
In der Präambel wird daher festgehalten, dass dies in der Überzeugung geschieht,
„dass ein umfassendes und in sich geschlossenes internationales Übereinkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinderungen sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den entwickelten Ländern einen maßgeblichen Beitrag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen leisten und ihre Teilhabe am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage der Chancengleichheit fördern wird“ (Deutscher Bundestag 2009).
Die Behindertenrechtskonvention hat u. a. zu einer neuen Legaldefinition von „Behinderung“ geführt (Kap. 3.1.4).
2.4.3 Soziale Gerechtigkeit
Wie bereits anhand der Betrachtung der Definition Sozialer Arbeit durch die IFSW deutlich wurde, fußt diese u. a. auch auf der Idee der sozialen Gerechtigkeit. Doch was ist gerecht und wer bestimmt darüber?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns der Gerechtigkeitstheorie als einer Abteilung der praktischen Philosophie zuwenden. Die amerikanische Ethikerin Martha Nussbaum beschreibt in ihrer Theorie des guten Lebens solch einen Gerechtigkeitsansatz. Nussbaum baut ihre Ethik auf der aristotelischen Philosophie des guten Lebens auf und gelangt damit zu einer Konzeption der Lebensführung, der Ähnlichkeiten zum Menschenrechtsdiskurs aufweist (Nussbaum 2010, 115 ff. und Röh 2013, 157). Neben der darin enthaltenen Bedürfnistheorie entfaltet sie einen „Fähigkeitenansatz“, der sich gleichzeitig als bildungsund sozialpolitisches Programm verstehen lässt. Dies geschieht bei Nussbaum in Abgrenzung zu anderen Gerechtigkeitsvorstellungen, wie etwa dem Utilitarismus oder auch der Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls, der mithilfe eines hypothetischen Gedankenexperimentes zu beweisen versuchte, dass Ungleichheit in dem Maße erträglich sei, wie alle Mitglieder einer Gesellschaft dieser durch freie Wahl zustimmen würden, auch wenn sie für einige von ihnen Nachteile mit sich bringe. Aufgewogen sollten diese Nachteile laut Rawls (1975, 336; 2006, 78) durch zwei Bedingungen:
a) Die Prinzipien müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes den am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bieten, und
b) sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen.
Für Rawls stellte eine konstitutionelle „Ur-Gemeinschaft“, an der diejenigen beteiligt sind, die zu dieser Gemeinschaft gehören und die Merkmale „frei“ und „gleich“ aufweisen, eine Grundbedingung dar. In der Situation der „Ur-Wahl“ von Gerechtigkeitsprinzipien sollen sie jedoch hinter einem „Schleier des Nichtwissens“ quasi ihre jetzige soziale Position (inkl. ihrer eigenen körperlichen und geistigen Fähigkeiten) vergessen. Nussbaum bezieht hier eine andere Position als Rawls, wenn sie gerade denjenigen, die mehr brauchen (weil sie qua Natur oder gesellschaftlichem Status weniger mitbringen), auch mehr geben will. Explizit erwähnt sie hier körperlich oder geistig / psychisch beeinträchtigte Menschen (Nussbaum 2010, 138 ff.), die ein „Mehr“ oder ein „Anderes“ an Gütern benötigen, um das gleiche Maß an Teilhabe zu erreichen. Dieses „Mehr an Abhängigkeit“ hat etwa Hahn (1999) als wesentlich zur Beschreibung der Situation von Menschen mit Beeinträchtigungen bezeichnet.
Nach Nussbaum steht am Beginn der ethischen Reflexion daher auch nicht der „gleiche Mensch“, der sich ausgehend von gleichen Startbedingungen unterschiedlich entwickelt und damit auch Ungerechtigkeit bis zu einem gewissen Maß zulässt, sondern einer, dessen Fähigkeiten (im Sinne von Verwirklichungs- oder Teilhabechancen) sich erst durch jene günstige Umweltbedingungen entwickeln, die einerseits die Herausbildung individueller Fähigkeiten (Kompetenzen) fördern und andererseits deren Anwendung auch tatsächlich ermöglichen oder zumindest nicht verhindern. Das einfachste Beispiel wäre hier sicherlich ein Mensch, der aufgrund einer Bewegungseinschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen ist: Er braucht einen solchen Rollstuhl, den er über sozialpolitische Programme finanziert bekommt, jemanden, der ihm bei der Beherrschung des Rollstuhls initial unterstützt und eine daran angepasste Umwelt ohne diskriminierende Einstellungen oder materielle Barrieren.
Interessanterweise kommt Nussbaum also zu dem Schluss, dass neben einer Güter-Theorie auch ein Fähigkeiten-Ansatz zu einem guten Leben führen kann. Fähigkeiten sind hier jedoch nicht als individuelle Kompetenzen zu verstehen, sondern vielmehr als Verwirklichungschancen, die vor allem Ziel politischer Bestrebungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit sein sollten, wobei sie von einer „partiellen und minimalen Gerechtigkeit“ ausgeht, die sich u. a. in der Erreichung von Schwellenwerten zeigt: „Das gesellschaftliche Ziel sollte deshalb darin bestehen, die Bürgerinnen und Bürger über diesen Schwellenwert zu heben” (Nussbaum 2010, 105).
Um dies zu erreichen, bedarf es nach Nussbaum eines Gerechtigkeitskonzepts, das die Fähigkeiten des Einzelnen, Güter zu nutzen und soziale Positionen zu erreichen, mit der Aufgabe der Gesellschaft verknüpft, für Jede/n eine chancengerechte Erreichbarkeit zu gewährleisten. Nussbaum sieht die Aufgabe des Staates darin, eine ausreichende Güterausstattung und gleichzeitig die Förderung der Fähigkeiten eines jeden Einzelnen zu gewährleisten. Erreicht würde so im besten Fall die Möglichkeit aller Bürger, vorhandene, tatsächliche Chancen zu nutzen. Bezüglich dieses Doppelfokus ergeben sich für Menschen mit Beeinträchtigungen wichtige Impulse, wobei auch die Limitationen dieses Gerechtigkeitsansatzes betrachtet werden müssen.
Am besten versteht man dies, wenn man sich die verschiedenen Fähigkeitstypen einmal genauer anschaut. Dabei unterschied Nussbaum ursprünglich zwischen internen (I-), externen (E-) und (G-)rund-Fähigkeiten (Nussbaum 1999, 102 ff.), wobei diese Unterscheidung neuerdings von ihr aufgehoben wird (Nussbaum 2015, 26 ff.):
■ I-Fähigkeit wird wie folgt definiert: „Ein Mensch hat zum Zeitpunkt t dann und nur dann die I-Fähigkeit, die Tätigkeit A auszuüben, wenn dieser Mensch zum Zeitpunkt t so ausgestattet ist, dass er unter den geeigneten Umständen eine Handlung A wählen kann. “
■ Die I-Fähigkeit(en) sind für Nussbaum Resultat von Erziehung und insbesondere bedeuten sie die Fähigkeit zum Urteilen, d. h. bei Nussbaum: zum guten Wählen.
■ E-Fähigkeit bedeutet: „Ein Mensch hat zum Zeitpunkt t dann und nur dann die E-Fähigkeit, die Tätigkeit A auszuüben, wenn der Mensch zum Zeitpunkt t die E-Fähigkeit zu A hat und keine äußeren Umstände ihn daran hindern, A auszuüben. “
■ E-Fähigkeiten sind damit eher als günstige Umstände aufzufassen, unter denen die I-Fähigkeit entwickelt werden kann.
■ G-Fähigkeit heißt: „Ein Mensch besitzt die G-Fähigkeit, die Tätigkeit A auszuüben, dann und nur dann, wenn dieser Mensch eine individuelle Konstitution hat, die so beschaffen ist, dass er nach der angemessenen Ausbildung, dem angemessenen Zeitraum und anderen notwendigen instrumentellen Bedingungen die Tätigkeit A ausüben kann. “
Die G-Fähigkeiten stellen somit die natürliche Grundlage dar, auf der nach Nussbaum die I-Fähigkeiten unter Berücksichtigung der E-Fähigkeiten entwickelt werden können. Sprich, wenn jemand die G-Fähigkeit, also die grundsätzliche Entwicklungsfähigkeit zu I-Fähigkeiten nicht besitzt – wie etwa Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen –, wird diese Person von politischen Angeboten weiterhin nicht profitieren können, es sei denn sie bekommt eine Unterstützung, die die fehlende Grundfähigkeit und die daraufhin unterentwickelten internen Fähigkeiten kompensiert (Nussbaum 2010, 259). So sind viele der von Nussbaum aufgeführten Grundfähigkeiten nur eingeschränkt für Menschen mit schweren geistigen Beeinträchtigungen zu entwickeln bzw. die auf der Ebene von Schwellenwerten vorhandenen Fähigkeiten nicht nutzbar. Neben dieser doch recht kleinen Gruppe von Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen wird der weitaus größere Teil der geistig, körperlich und psychisch Beeinträchtigten von einem solchen Gerechtigkeitsverständnis profitieren. Denn mithilfe einer derart konzipierten Bildungsund Sozialpolitik können teilhabefördernde Umwelten geschaffen und Menschen mit Unterstützungs- und Assistenzprogrammen zur Teilhabe „befähigt werden“ oder besser: dazu in die Lage versetzt werden zu entscheiden, ob, woran und in welchem Ausmaß sie teilhaben wollen.
Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Theorie Nussbaums eine problematische semantische und evtl. auch praktische Annahme innewohnt. Ein semantisches und damit auch moralisches Problem kann in der, allerdings abwägenden, Formulierung gesehen werden, dass das von ihr als Beispiel für eine schwere geistige Beeinträchtigung genannte Mädchen „Sesha einer ganz anderen Lebensform angehört“ (Nussbaum 2010, 260). Etwas später bezieht sie auch andere Formen der geistigen Beeinträchtigungen ein, nämlich Anenzephalie oder Wachkoma, die aber aus medizinischer Sicht nicht vergleichbar sind. Schlussendlich kommt Nussbaum (2010, 261) zwar zum Ergebnis, dass Seshas Leben als menschliches Leben gesehen werden sollte und verteidigt die „Spezieszugehörigkeit“ damit, dass diese von moralischer und politischer Bedeutung ist (Nussbaum 2010, 493), jedoch kann kritisiert werden, dass sie ihre begrüßenswerte Position, Menschen mit Beeinträchtigungen mehr soziale Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, mit dieser Formulierung schwächt. Meines Erachtens zieht Nussbaum zudem die Grenzen der Gerechtigkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen zu eng, was jedoch eher an ihrem fehlenden oder mangelhaften Wissen über die Ausprägung und Entwicklung von Fähigkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen liegt. Gleichwohl sind die von ihr dargestellten Beispiele dreier Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen (Jamie, Sesha und Arthur) insofern instruktiv als sie die Grenzen der Gerechtigkeit verdeutlichen und zwar sowohl jene ihres eigenen als auch objektiven Verständnisses dieser Grenzen (Nussbaum 2010).
Übungen zu Kap. 2.4
9. Verständnisfrage: Weshalb kann man Soziale Arbeit als eine Menschenrechtsprofession bezeichnen?
10. Verständnisfrage: Wie versteht Nussbaum soziale Gerechtigkeit und wie kann diese ihrer Ansicht nach erreicht werden?
11. Diskussions-/ Reflexionsfrage: Warum verspricht der Ansatz von Nussbaum für Menschen mit Beeinträchtigungen mehr Gerechtigkeit als der von Rawls?
2.5 Methodisches Handeln
Neben ethischen braucht die Soziale Arbeit auch methodische Grundlagen zur Ausübung ihrer professionellen Rolle. Daher werden in diesem Abschnitt allgemeine handlungstheoretische Begründungen skizziert und dafür plädiert, nur methodisch geleitetes Handeln als professionelles sozialarbeiterisch-sozialpädagogisches Handeln zu bezeichnen.
Soziale Arbeit als berufliches Handeln, im Sinne sozialprofessionellen, erlernten Handelns, besteht seit ca. 120 Jahren in Deutschland im Anschluss an die frühe Tradition der Ausbildung verschiedenster fürsorglicher und pädagogischer Berufe (Kindergärtnerinnen durch F. Froebel, Heimbetreuern durch J. H. Wichern und der Fürsorgerinnen durch A. Salomon) und kann daher auf eine beachtliche Berufstradition zurückgreifen. Diese wurde allerdings durch den Nationalsozialismus ebenso wie durch die verschiedenen, z. T. gegensätzlichen methodischen Ausrichtungen der Nachkriegszeit in ihrer weiteren Entwicklung hin zu einer Profession erheblich verlangsamt. Ebenso war die disziplinäre, wissenschaftliche Entwicklung durch die unterschiedlichen Ausbildungsniveaus der universitären Sozialpädagogik und der zunächst auf höherem Fachschulniveau, dann seit den 1970er Jahren auf Fachhochschulniveau stattfindenden Ausbildung von Sozialarbeiter-Innen und SozialpädagogInnen in ihrer vollen Entfaltung behindert. Erst die seit Mitte der 1990er Jahre erfolgenden Bemühungen um die Etablierung und Entwicklung einer Sozialarbeitswissenschaft haben zu einer immer klareren Konturierung eines Professionalisierungs- und Verwissenschaftlichungsprozesses beigetragen, sodass heute durchaus von der Sozialen Arbeit als einer Wissenschaft und von Sozialarbeiter-Innen und SozialpädagogInnen als wissenschaftlich ausgebildeten PraktikerInnen (Lüders 1989) gesprochen werden kann.
Heute kann man folgende Formaldefinitionen Sozialer Arbeit vornehmen, wobei die jeweiligen inhaltlichen Gegenstands- und Funktionsdefinitionen je nach Theorie (Kap. 4.2) variieren:
■ Soziale Arbeit ist als Profession die wissenschaftlich gesicherte, methodisch geleitete, ethisch sensible und damit professionelle Praxis des/der […Gegenstands- und Funktionsdefinition]
■ Soziale Arbeit ist als Wissenschaft die Lehre und Erforschung der historischen, theoretischen, methodischen und ethischen Grundlagen der/des […Gegenstands- und Funktionsdefinition]
Zudem ist seit den 1990er Jahren der durch neue Steuerungsmodelle, Ökonomisierung und neue Fachlichkeit ausgelöste Druck auf die Soziale Arbeit, ihre Wirkung (Effizienz, Effektivität) und Handlungsweise (Konzepte, Methoden) unter Beweis zu stellen (Sommerfeld/Hüttemann 2007; Albus et al. 2011; Borrmann / Thiessen 2016), zwar ebenfalls in Richtung einer Professionalisierung wirksam, jedoch auf seine tatsächlich förderlichen Aspekte weiterhin kritisch zu betrachten.
Der von einzelnen Vertretern verfolgten These, Soziale Arbeit sei nicht in der Lage, eine eigenständige Profession zu werden (Schütze 1992; Bommes / Scherr 2000; Baecker 2000), sondern allerhöchstens fähig, professionell zu handeln, sei hier weiter keine Aufmerksamkeit geschenkt (zur Gegenthese siehe Merten 2000; Staub-Bernasconi 2007).
Grundsätzlich ist der von Heiner (2004a, 15 f.; 2010, 160 ff.) eingeführten Unterscheidung strukturbezogener und kompetenzbezogener Modelle zu folgen, da diese die Professionalisierung unabhängig von den klassischen Merkmalen alter Professionen charakterisiert. Klassische Merkmale wie abgegrenzte Kompetenzdomäne, weitgehende Autonomie und autonome Entscheidungsräume sind zwar noch nicht oder nur in Teilen umgesetzt, jedoch sind auch bereits die strukturbezogenen Professionsmerkmale für die Soziale Arbeit zu verzeichnen: akademische Ausbildung, Betreuung mit Aufgaben grundlegender Bedeutung, kodifizierter beruflicher Ethos und spezielle Expertise.
Als Teil dieser speziellen Expertise kann das methodische Handeln gelten. Es soll deshalb an dieser Stelle in seinen Grundzügen erläutert werden. Die einzelnen methodischen Konzepte einer professionellen Sozialen Arbeit werden später in Kapitel 4.3 bezogen auf das Handlungsfeld der Behindertenhilfe erläutert. Hier sind lediglich einige methodologische bzw. handlungstheoretische Erörterungen im Nachvollzug der aktuellen Literatur angebracht.
Als Grundlage ihrer Handlungstheorie stellt Staub-Bernasconi das systemtheoretische Paradigma der Sozialen Arbeit theoretisch begründet dar und leitet daraus konkrete Handlungspfade im Sinne eines „transformativen Dreischritts“ (Staub-Bernasconi 2007, 252 ff.) ab (Kap. 4.2.2).
Von Spiegel versteht methodisches Handeln etwas anders:
„Methodisches Handeln bedeutet in diesem Sinne, die spezifischen Aufgaben und Probleme der Sozialen Arbeit situativ und eklektisch wie auch strukturiert und kriteriengeleitet zu bearbeiten, wobei man sich an Charakteristika des beruflichen Handlungsfeldes sowie an der wissenschaftlichen Arbeitsweise orientieren sollte“ (von Spiegel 2013, 104).
Von Spiegel beschreibt hier ein allgemeines Methodenkonzept der Sozialen Arbeit, welches sich explizit als Rahmenmodell versteht, dabei weniger konkrete Methoden, als vielmehr Analyse- und Planungs-Raster zur Verfügung stellt. Dieses folgt einer von ihr beschriebenen Abfolge von Handlungen, die jedes methodische Handeln (an-) leiten: Analyse der Rahmenbedingungen, Situations- und Problemanalyse, Zielentwicklung, Planung und Evaluation. Sie werden ergänzt durch „Planungstypen“ (Situationsgestaltung, Hilfeplanung, Konzeptionsentwicklung, Projektplanung und Selbstevaluation) (von Spiegel 2013, 105 f.) und können mit einem Werkzeugkasten kombiniert werden (von Spiegel 2013, 139 ff.).
Heiner (2004a) entwickelte auf der Basis einer empirischen Untersuchung bei Fachkräften aus diversen Praxisfeldern der Sozialen Arbeit ein handlungstheoretisches Modell mit den Merkmalen: Auftrag, Handlungstypus, Tätigkeitsfeld, Aufgabenspektrum und Interventionsformen.
Sie beschreibt den Auftrag der Sozialen Arbeit darin, „zwischen Individuum und Gesellschaft, System und Lebenswelt zu vermitteln“, wobei die intermediäre Funktion der Sozialen Arbeit sich im Handeln innerhalb eines Spannungsgefüges von „gesellschaftlichen Anforderungen und individuellen Bedürfnissen bzw. Fähigkeiten“ zeigt und die besondere Kompetenz im „Austarieren von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung, Hilfe und Kontrolle, Disziplinierung und Akzeptanz, Hilfegewährung und Hilfeverweigerung“ besteht (Heiner 2004a, 155). Als Handlungstypus finden wir bei ihr die „Verschränkung von strategischem und verständigungsorientiertem Handeln“, dieser Handlungstypus findet Anwendung in den verschiedensten Handlungsfeldern.
Interessant ist, dass Heiner (2004a, 157) dabei nicht die typische Doppelmandatierung benennt, sondern eine „trifokale“ Perspektive vorschlägt: Soziale Arbeit ist „(1) die fallbezogene Unterstützung der Klienten zur Optimierung ihrer Lebensweise, (2) die fallbezogene Veränderung ihrer Lebensbedingungen und (3) die fallunabhängige und fallübergreifende Optimierung der sozialen Infrastruktur“. Sie entwirft damit ein Modell, welches die sozialpolitische Nachrangigkeit des Berufes, also seine Stellung als Zweitsicherung, dadurch kompensiert, dass neben der fallabhängigen auf das Verhalten der Individuen einwirkenden Kraft gleichzeitig ein die Verhältnisse, in denen die Individuen leben, veränderndes Potenzial gesehen wird.
Schließlich sei der Vollständigkeit halber mit Geißler / Hege (2001, 24) darauf hingewiesen, dass Methoden ein „konstitutiver Teilaspekt von Konzepten“ sind und Verfahren (oder Techniken) wiederum „Einzelelemente von Methoden“). Zum Konzept eines sozialraumorientierten Handelns in der Behindertenhilfe gehört beispielsweise die Methode der Sozialraumanalyse und zu dieser wiederum beispielsweise die Sozialraumbegehung als Technik (Kap. 4.3.8).
Übungen zu Kap. 2.5
12. Verständnisfrage: Wie definiert von Spiegel „methodisches Handeln“?
13. Diskussions-/ Reflexionsfrage: Warum ist das methodische Handeln konstitutiv für die Soziale Arbeit als Profession?