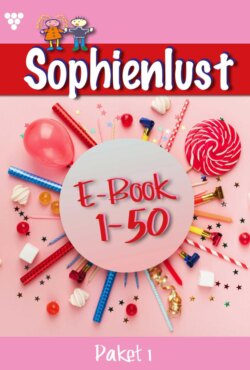Читать книгу Sophienlust Paket 1 – Familienroman - Diverse Autoren - Страница 15
ОглавлениеStaunend versammelten sich die Kinder um den roten Kleinbus, der eben in den Gutshof von Sophienlust eingefahren war.
»Kinderheim Sophienlust«, buchstabierte Dominik von Wellentin langsam.
Dann rief er: »Mutti, der gehört ja uns.«
Denise von Wellentin nickte. »Ja, der gehört jetzt uns. Kannst du mir sagen, wie wir sonst die vielen Kinder befördern sollen? Übermorgen kommen sie, und neun von ihnen gehen bereits zur Schule.«
»Da wird die Schule bald wieder zu klein werden«, meinte Robby Trenk. »Wie viel sind wir eigentlich schon? Zählen wir mal!«
Das übernahm Carola Dahm, die Älteste von ihnen, nun bereits fünfzehn Jahre, und von allen Roli genannt. Sie hatte sich während der letzten Wochen zu einem hübschen jungen Mädchen entwickelt.
»Nick, Marion, Robby …« Sie zögerte.
»Du natürlich«, fuhr Dominik fort. »Und Petra dürfen wir auch nicht vergessen. Sascha und Andrea aber auch nicht«, fügte sie hinzu. »Ihre Zimmer müssen immer frei bleiben, damit sie auch bei uns schlafen können.«
»Natürlich bleiben ihre Zimmer frei«, versprach Denise.
Dominik zählte rasch noch mal an seinen Fingern nach. »Dann sind wir neunzehn, wenn von Madame Merlinde jetzt zwölf Kinder kommen. Aber wenn Susi noch da wäre, dann wären wir zwanzig.«
So ganz hatte er es noch nicht verschmerzt, dass seine kleine Freundin Susi nun bei ihrem Vater in Südafrika weilte, der wieder geheiratet hatte.
»Nun langt es aber, Mutti«, erklärte Dominik energisch.
»Wenn du meinst«, lächelte sie. »Ja, ich glaube auch, dass wir vorerst genug sind. Was meinst du, Claudia?«, wandte sie sich an ihre Freundin.
»Manchmal denke ich, dass du dir zu viel zumutest«, warnte Claudia. »Als du das Haus der fröhlichen Kinder plantest, waren die Voraussetzungen andere. Jetzt gibt es aber Alexander! Auch dass ich dir so schnell untreu werden würde, war nicht eingeplant.«
»Ganz untreu wirst du uns wohl nie werden«, lächelte Denise. »Damals haben wir ja auch nicht für möglich gehalten, dass wir einen Opa und eine Omi zur Unterstützung bekommen würden. Mein Gott, wie schnell ist dieses Jahr vergangen. Und in vierzehn Tagen ist schon die Hochzeit.«
»Und es gibt einen, der es kaum noch erwarten kann«, entgegnete Claudia, und ihre Augen strahlten.
»Opa und Omi kommen mit Kati«, verkündete Dominik.
Vor einigen Wochen war Kati ebenfalls Gast in Sophienlust gewesen. Aber eines Tages hatte Irene von Wellentin das Kind in ihr Haus geholt.
Aus dem armseligen kleinen Mädchen, das völlig vereinsamt und verstört auf Sophienlust Einzug gehalten hatte, war ein reizendes Kind geworden, das hübsche Kleider trug. Man merkte Kati an, dass es ihr an nichts mangelte. Aber man sah es auch Hubert und Irene von Wellentin an, dass sie durch das Kind innere Ruhe und Zufriedenheit gefunden hatten.
Denise begrüßte die Schwiegereltern herzlich. Kein Groll stand mehr zwischen ihnen. Alles, was so dramatisch begonnen, hatte sich zum Guten gewendet.
»Wieder eine neue Errungenschaft«, meinte Hubert von Wellentin, den Kleinbus anerkennend betrachtend.
»Bevor der Trubel hier so richtig losgeht, wollten wir noch einmal kommen. Während der nächsten Wochen wirst du wohl kaum für deine alten Schwiegereltern Zeit haben«, sagte er bedauernd.
»Willst du ein Kompliment hören?«, fragte sie heiter. »Gut schaust du aus.«
Er küsste ihr galant die Hand. »Ich höre es gern aus so bezauberndem Mund.«
Dass Hubert von Wellentin eine sehr schwere Krankheit hinter sich hatte, sah man ihm nicht mehr an. Und nichts in seinem Benehmen erinnerte mehr daran, wie feindselig er der jungen Frau einmal gesinnt gewesen war. Er war ein anderer Mensch geworden seit seiner Krankheit.
»Ich möchte dich gern ein paar Minuten allein sprechen, Denise«, raunte er ihr zu.
»Es wird sich einrichten lassen«, nickte sie. »Die Kinder werden Omi schon beschäftigen.«
Darauf brauchten sie nicht lange zu warten. So konnte sich Denise ungestört mit ihrem Schwiegervater in ihr gemütliches kleines Wohnzimmer zurückziehen.
»Nun, Papa«, begann sie, »du schaust ja plötzlich so sorgenvoll drein.«
»Irene soll es noch nicht wissen«, sagte er leise. »Ich hatte Hanna Ebert doch vor einiger Zeit geschrieben und ihr Geld für die Heimreise geschickt. Damals hatten wir aber Kati noch nicht bei uns. Da die Mutter so lange auf Antwort warten ließ, hoffte ich schon, dass sie auf diese Reise verzichten würde. Aber nun will sie doch kommen, und ich weiß nicht, wie ich es Irene beibringen soll.«
Denise überlegte. Es würde ein harter Schlag für ihre Schwiegermutter sein, wenn sie Kati verlieren würde, denn das Kind hatte wieder Leben in ihr Haus gebracht.
»Das bedeutet doch nicht unbedingt, dass ihr Kati hergeben müsst«, bemerkte Denise. »Hanna Ebert muss arbeiten. Sie wird froh sein, wenn sie ihr Kind gut untergebracht weiß. Außerdem wird es auch für Kati nicht einfach sein, sich daran zu gewöhnen, dass sie eine Mutter besitzt. Sie hat doch gar keine Erinnerung mehr an sie.« Sie machte eine kleine Pause. »Ich weiß zwar nicht, welchen Beruf Hanna Ebert ausübt, aber vielleicht könnte sie Mama im Haushalt zur Hand gehen. Platz habt ihr doch genug, und dann habt ihr sie und Kati unter einem Dach.«
»Du weißt doch für alles einen Rat, Denise«, antwortete er dankbar. »Ich habe mich auch sehr an das Kind gewöhnt, aber gerade an ihm habe ich so viel gutzumachen. Aber wenn Hanna nun ganz anders ist, als wir es uns vorstellen. Ich möchte Kati so gern einen Schock ersparen. Sie ist ein liebes Kind.«
Manchmal musste Denise über ihren Schwiegervater immer noch staunen. Er, der große Egoist, der immer nur an sich selbst gedacht hatte, zeigte jetzt menschliche Züge, die niemand von ihm erwartet hatte.
»Aber ich will nicht nur von mir und meinen Sorgen sprechen, Denise«, fuhr er fort. »Ich denke auch an dich. Es will mir nicht gefallen, dass du so überlastet bist. Ich denke auch an Alexander von Schoenecker.«
Denise errötete heftig. Dass nun auch ihr Schwiegervater davon anfing, versetzte sie in Bestürzung.
»Ich habe mit Irene darüber gesprochen. Ihr passt gut zueinander. Du bedeutest ihm viel – und er dir doch auch, nicht wahr? Ich möchte dir sagen, dass wir volles Verständnis dafür haben.«
»Danke, Papa«, sagte sie leise. »Wir brauchen nichts zu überstürzen. Wir sind uns darüber klar geworden.«
»Die Jahre vergehen so schnell, Denise. Die Kinder hängen an dir, und Nick hängt an ihm. Um eines möchte ich dich allerdings bitten, und ich hoffe, dass du mich verstehen wirst. Lass Dominik den Namen Wellentin, wenn du Alexander einmal heiratest.«
»Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen, Papa. Er bleibt ein Wellentin. Aber noch ist von Heirat gar nicht die Rede.«
»Die Straße zwischen Sophienlust und Schoeneich wird noch diesen Monat in Angriff genommen. Es ist alles geregelt. Der Weg wird dann kürzer für euch. Ich habe so viel gutzumachen, Denise, und ich kann mir nicht mehr viel Zeit dafür lassen. Ich hoffe, dass ihr bald sehr glücklich werdet«, sagte er herzlich.
*
Erfreut blickte Dr. Lutz Brachmann auf, als Claudia ihren Kopf durch die Tür steckte.
»Meine Gedanken haben dich wohl herbeigeholt, Liebling«, sagte er zärtlich. »Wir können gleich zu unserem Haus fahren. Die Möbel sind gekommen. Jetzt kann es ans Einrichten gehen. Meinst du, dass wir es in vierzehn Tagen schaffen werden?«
»Na, ich denke doch. Aber kannst du hier alles stehen und liegen lassen?«
»Ich habe tüchtig vorgearbeitet, und außerdem hast du ja auch noch einen recht vitalen Schwiegervater.« Er gab ihr einen zärtlichen Kuss.
»Aber jetzt komm. Die Mittagspause wollen wir ausnützen.«
Sie fuhren zu ihrem reizenden Haus, das gerade noch zur rechten Zeit fertig geworden war. Es roch noch nach Leim und Farbe, aber für Claudia waren das Wohlgerüche. Ihr Haus! Hier würde sie mit ihrem Lutz leben! Ihre Entscheidung, nach Sophienlust zu gehen, war für sie zu einem so persönlichen Glück geworden, dass sie es manchmal noch gar nicht fassen konnte.
Der Dekorateur war schon dabei, die Vorhänge aufzuhängen.
»Das hätte ich doch auch allein machen können«, meinte Claudia.
»Das fehlte mir gerade noch«, brummte Lutz. »Wenn du von der Leiter fällst, müssten wir womöglich noch die Hochzeit verschieben. Das kannst du mir nicht antun, Liebes. Ich habe jetzt lange genug gewartet. Ein Jahr kann ewig lang sein, mein Schatz. Was ist mit deinem Hochzeitskleid? Alles in Ordnung?«
»Darum brauchst du dich nicht auch noch zu kümmern. Du tust so viel für mich, Lutz.«
»Und wie geht’s in Sophienlust? Hat sich Denise damit abgefunden, dass sie dich loswird?«
»Schon lange. Ich bin nur froh, dass sie Frau Trenk und Edith hat. Jetzt, wo die Arbeit erst so richtig anfängt, werde ich Frau Brachmann.«
»Reut es dich?«, spottete er gutmütig.
»Wie kannst du nur so etwas sagen«, flüsterte sie und umarmte ihn stürmisch.
Als sie gehen wollten, kam Frau Nickel. Sie hatte ihre kleine Marlies bei sich, die sie jetzt dank der Unterstützung, die sie nun von Hubert von Wellentin bekam, daheim behalten konnte. Um ihre Dankbarkeit zu beweisen, sprang sie überall ein, wo man ihre Hilfe brauchen konnte.
»Na, Marlies, willst du nicht mit nach Sophienlust kommen?«, fragte Claudia, als sie stürmisch von der Kleinen begrüßt wurde.
»Darf ich denn? Mama sagt, dass jetzt so viel Kinder da sind, dass ich nur im Wege bin.«
»Du bist nie im Wege. Du kannst immer kommen. Außerdem kommen die vielen Kinder erst übermorgen.«
»Ich möchte schon gern«, sagte die Kleine.
»Ich darf Ihre Güte doch jetzt nicht auch noch in Anspruch nehmen«, warf Frau Nickel bescheiden ein. »Ich bin ja so dankbar für alles, was Sie für uns getan haben.«
»Ich doch nicht«, wehrte Claudia ab. »Komm nur mit, Marlies. Die Kinder freuen sich und Habakuk auch. Was meinst du, was er inzwischen alles dazugelernt hat.« Sie wandte sich an Frau Nickel. »Ich bringe Marlies heute Abend wieder heim.«
»Ihr könnt es doch nicht lassen«, raunte Lutz Claudia zu. Aber die strahlenden Kinderaugen verrieten ihm, welches Glück es bedeutete, in Sophienlust zu sein.
*
»Weißt du, Tante Claudia«, sagte Marlies. »Mama ist ja lieb und es ist jetzt auch ganz schön bei uns, aber in Sophienlust ist es doch am allerschönsten.«
Ja, es war ein Paradies für die Kinder. Froh und unbeschwert konnten sie hier heranwachsen. Kinder, die keine Familie, keine Liebe kennengelernt hatten, fanden hier, auf diesem himmlischen Stückchen Erde, eine Heimat.
Freudig wurde die kleine Marlies empfangen, und gleich musste sie dem Papagei Habakuk, der ihr besonderer Liebling war, einen Besuch abstatten.
Vor Hubert von Wellentin hatte Marlies immer noch Respekt. Sie begrüßte ihn mit einem Knicks und einem schüchternen Lächeln. Aber dann konnte sie mit den Kindern spielen.
Als Pferdegetrappel aufklang, hob Denise ihren Kopf. Ihr feines Gesicht überzog sich mit einer leichten Röte. Hubert und Irene von Wellentin tauschten einen verständnisinnigen Blick.
Auf ihren Ponys kamen Sascha und Andrea quer durch den Wald geritten. Alexander von Schoenecker folgte ihnen.
Nachdem Sascha und Andrea abgestiegen waren, kamen sie sogleich auf Denise zugestürmt und begrüßten sie zärtlich.
»Jetzt wird bald die Straße gebaut«, raunte Sascha ihr zu. »Es ist schon alles vermessen. Papi hatte heute wieder Besprechungen, sonst wären wir schon längst da. Gibt’s Schokoladenkuchen, Tante Isi?«
»Freilich. Magda hat euch welchen aufgehoben.«
Dann entdeckten die beiden den Kleinbus, und Dominik eilte herbei, um ihnen alles genau zu erklären.
Denise ging Alexander entgegen. Ihre Blicke versanken ineinander und hielten sich fest.
»Großer Besuchstag«, murmelte er, »da komme ich wohl ungelegen?«
»Nie«, erwiderte sie leise.
»Ich wollte dich eigentlich zu einem Ausritt verführen.«
»Ich habe nichts dagegen einzuwenden«, lächelte sie.
»Und die andern?«
»Die passen auf die Kinder auf.«
Während Denise sich rasch umkleidete, unterhielt sich Alexander mit den Wellentins.
Sascha, obgleich von dem Bus überaus beeindruckt, hatte schon dafür gesorgt, dass Denises Pferd gesattelt wurde. Er schien genau zu wissen, dass sein Vater mit ihr allein sein wollte, und er schien es auch zu billigen, während Nick und Andrea lieber mitgeritten wären.
Schmollend blickte Nick hinter den beiden her.
Sascha zog ihn mit sich. »Weißt du, sie können doch sonst nie allein miteinander sprechen«, meinte er. »Immer sind wir dabei.«
»Ach so«, antwortete Nick verständnisinnig. »Na, dann gehen wir eben wieder spielen.«
*
Denise und Alexander ritten nur bis zu ihrem Lieblingsplatz, dann banden sie ihre Pferde an einen Baum und stiegen die leichte Anhöhe empor, von der aus sie nach Sophienlust und Schoeneich blicken konnten.
Ganz fest nahm Alexander Denise in seine Arme.
»Liebstes, du mein Liebstes«, flüsterte er. »Du weißt ja nicht, wie sehr ich mich nach dir sehne. Ich darf gar nicht daran denken, wie lange ich noch auf dich warten soll.«
Ihr wurde es auch schwer. Alle ihre guten Vorsätze waren über den Haufen geworfen worden durch Alexander von Schoenecker.
Was hatte ihnen dieses eine kurze Jahr alles gebracht!
Damals, als sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte, hatte sie nicht geglaubt, dass sich durch ihn ihr ganzes Leben verändern würde – durch ihn noch viel mehr als durch das Erbe Sophie von Wellentins. Freudigen Herzens hatte sie die große Aufgabe begonnen, die ihr Dominiks Großmama auferlegt hatte, und nun gab es diesen Mann, der sie ebenso brauchte wie die fremden Kinder, denen sie Liebe und Geborgenheit geben wollte. Und sie brauchte ihn. Darüber täuschte sich Denise nicht mehr hinweg. Das Leid, das jeder von ihnen erlitten hatte, hatte sie einander nähergebracht. Die Liebe, die sie füreinander fühlten, verband sie nun unlöslich.
Aber noch konnte Denise nicht alles hinwerfen und das Kinderheim Sophienlust fremden Händen überlassen. Und so mussten sie auf ihr gemeinsames Leben noch warten.
»Warum heiraten wir nicht?«, fragte er drängend. »Du kannst dich doch auch weiterhin um Sophienlust kümmern, und ich werde dir gern dabei helfen. Aber ich möchte, dass du meine Frau wirst. Vor Gott und aller Welt.«
»Und ich möchte deine Frau sein, Liebster. Aber wir müssen Geduld haben.«
Mit einem Aufstöhnen presste er seine Lippen auf ihren Mund und küsste sie leidenschaftlich. Weich umschlossen ihre Hände sein geliebtes Gesicht.
Nur wenige kostbare Stunden durften sie sich so nahe sein, und Denise hatte das Verlangen, die Zeit festzuhalten. Würde das, was die Huber-Mutter prophezeit hatte, eintreffen? Würden in diesem Jahr in Sophienlust zweimal die Hochzeitsglocken läuten?
Die Huber-Mutter hatte recht behalten, als sie gesagt hatte, dass Barbara Baumgarten eine Tochter haben würde. Und in vierzehn Tagen würden die Hochzeitsglocken für Claudia und Lutz läuten. Drei Monate dieses Jahres waren bereits vergangen. Würden die Hochzeitsglocken später noch einmal läuten?
»Ich weiß, was du denkst«, raunte ihr Alexander ins Ohr. »Und ich wünsche es so sehr, Liebste. Es liegt nur an dir.«
*
Kati war eingeschlafen. Irene von Wellentin hatte an ihrem Bett gesessen und ihr zwei Geschichten vorgelesen. Dann hatten sie miteinander gebetet, und schließlich hatte Kati ihre Arme um Irene geschlungen und ihre Lippen an ihre Wange gelegt. »Für die anderen bist du die Omi, für mich bist du meine Mutti«, hatte sie gesagt. »Meine liebe Mutti.«
Der Abglanz des Glückes, das ihr diese Worte gab, lag noch auf ihren Zügen, als sich Irene von Wellentin zu ihrem Mann setzte.
»Kati hat Mutti zu mir gesagt«, flüsterte sie. »Das Kind macht mich so glücklich, Hubert.«
Es gab ihm einen Stich. Einmal im Leben hatte er von sich aus die Initiative ergriffen, um einer Mutter zu ihrem Kind zu verhelfen. Er hatte eine große Summe dafür bereitgestellt, und nun brachte dieser Entschluss Schmerz und Kummer über seine Frau, die seinetwegen sowieso schon so viel hatte erdulden müssen.
»Hubert, ich weiß, dass ich ein Ansinnen an dich stelle, das zu verstehen dir schwerfallen wird«, fuhr Irene von Wellentin fort. »Ich möchte so gern, dass wir Kati adoptieren.«
Ihm schnürte es die Brust zusammen und die Kehle. Er brachte kein Wort über die Lippen.
»Schau, wir haben Dietmar verloren. Dominik hat seine Mutter, und er wird in Alexander einen guten Vater bekommen. Wir können glücklich sein, dass wir seine Großeltern sein dürfen und dass er uns liebt. Aber Kati hat doch niemanden, und ich liebe dieses Kind. Kati braucht mich viel mehr als Nick. Ich habe mir nie etwas gewünscht. Erfülle mir diesen einen Wunsch, Hubert.«
»Ich würde ihn dir so gern erfüllen, Irene«, sagte er endlich stockend, »aber Kati hat noch eine Mutter.«
»Sie ist fern. Welten trennen sie und das Kind. Sie war ihr nie eine Mutter. Kati kannte nur ihren Großvater.«
Er stand auf und ging mit schweren Schritten im Zimmer umher.
»Schau, Irene … Damals, als Kati nach Sophienlust kam, schrieb Denise doch an Hanna Ebert …« Schon wusste er nicht weiter.
»Aber sie schrieb uns zurück, dass sie nicht in der Lage sei, Kati zu sich zu nehmen und dass sie dankbar wäre, wenn Kati in Sophienlust bleiben könnte, weil es ihr dort besser gehen würde als bei ihr. Sie erwähnte auch, dass sie auf das Kind verzichten wolle.«
»Und ich glaubte, ihr dazu verhelfen zu müssen, dass sie ihr Kind wiedersehe«, murmelte er. »Ich habe nicht viel Gutes in meinem Leben getan, Irene, ich wollte alles nachholen.«
Sie sah ihn bestürzt an. »Was meinst du damit, Hubert?«, fragte sie stockend.
»Ich schrieb an Hanna Ebert, dass sie kommen solle, und schickte ihr das Geld für den Flug. Inzwischen aber hattest du Kati zu uns geholt, und ich hörte lange nichts von ihrer Mutter. Nun bekam ich die Nachricht, dass sie kommen will. Irene, es tut mir so entsetzlich leid, dir diesen Kummer bereiten zu müssen. Ich wollte das Beste – glaube es mir. Ich wusste nicht, dass es für uns zum Schlimmen werden würde.«
Sie schlug die Hände vor ihr Gesicht. »Sie wird kommen. Sie wird mir das Kind wegnehmen«, schluchzte sie auf. »Aber Kati hat mich doch lieb und dich auch. Ich kann sie nicht mehr hergeben.«
Er trat auf sie zu und ergriff ihre Hände. »Ich kann es nicht mehr rückgängig machen, Irene«, murmelte er. »Sie ist bereits unterwegs.«
Mit trüben, glanzlosen Augen blickte sie ihn an.
»Liebe, glaube mir, mir ist ganz elend zumute, weil ich dir diesen Schmerz zufügen muss. Gerade dir! Du hast mir so viel Verständnis entgegengebracht, hast so viel Geduld mit mir gehabt, und ich habe dich schon so oft enttäuscht.«
»Ich weiß, dass du es gut gemeint hast, Hubert«, seufzte sie. »Du konntest nicht ahnen, dass es so kommen würde. Aber ich gebe Kati nicht mehr her. Ich werde um dieses Kind kämpfen. Die Mutter kann es mir nicht nehmen.«
Behutsam streichelte er ihre Wangen. So lange waren sie nun schon verheiratet, und nie waren sie sich so nahe gewesen wie in dieser Stunde. Viele Schicksalsschläge waren nötig gewesen, um ihrem Leben Sinn und Inhalt zu geben.
»Ich werde alles tun«, sagte er mit belegter Stimme, »alles, meine Liebe, damit wir Kati behalten können.«
Das Kind, um das es ging, lag währenddessen in einem bezaubernd eingerichteten Zimmer im Bett und schlief tief und selig in dem Bewusstsein, ein Zuhause zu haben und Menschen, die sie liebten. Ihr armes kleines Leben hatte eine so wunderbare Wendung erfahren, dass Kati nicht auf den Gedanken kam, es könnte noch einmal anders werden.
*
Denise hatte ein schlechtes Gewissen, als sie sich heimlich aus dem Hause stahl. Nur Claudia wusste Bescheid, dass sie sich mit Alexander treffen wollte.
Praktisch, wie Claudia veranlagt war, hatte sie den Vorschlag gemacht, die Kinder vor die vollendete Tatsache zu stellen.
»Himmel noch mal«, hatte sie energisch gesagt, »denk doch mal einen Tag an dich. Es wird in Zukunft sowieso genug auf dich einstürmen. Der arme Alexander kann einem wirklich leidtun. Die Kinder sind doch hier in guter Obhut, und wir werden uns einen vergnügten Tag machen.«
»Hoffentlich«, dachte Denise, als sie mit ihrem Wagen durch den taufrischen Morgen fuhr. Der Wettergott zeigte sich von seiner allerbesten Seite. Die Wiesen begannen zu grünen, es duftete nach Frühling.
Ein neuer Frühling! Im vorigen Jahr hatte es noch keinen Alexander gegeben.
Er stand schon an der Kreuzung und hielt nach ihr Ausschau. »Du kommst«, sagte er, als könnte er es nicht fassen.
»Ich habe es dir doch versprochen«, lächelte sie.
»Und was haben unsere Sprösslinge gesagt?«
»Gar nichts. Sie wissen es nicht. Claudia meinte, es sei der einfachste Weg, allen neugierigen Fragen aus dem Weg zu gehen.«
»Kluge Claudia. Aber die Hauptsache ist, dass du da bist. Wir werden diesen Tag richtig genießen, du wundervollste aller Frauen. Du einzige Frau«, fügte er leise hinzu.
War es etwa verwerflich, wenn sie einmal für einen Tag alles vergessen und nur an den geliebten Mann denken wollte? Sie überließ ihm das Steuer und lehnte ihren Kopf an seine Schulter.
Es war gar nicht so einfach, sich plötzlich von all den Problemen loszulösen, die ihren Tagesablauf bestimmten. Aber dann genossen sie doch diesen zauberhaften Tag, der nur ihnen allein gehörte.
*
Edith Gerlach hatte ihre kleine Tochter angezogen und in den Kinderwagen gesetzt. Petra krähte vergnügt. Sie war ein lebhaftes fröhliches Kind mit großen Augen und rötlichblonden Haaren.
Auch Edith Gerlach dachte an diesem Frühlingsmorgen ein Jahr zurück. Damals hatte sie nicht geglaubt, dass das Leben noch einmal so schön werden, dass sie sich so über ihr Kind würde freuen können. Ohne jede Hoffnung hatte sie es eines Abends vor die Tür des Gutshauses gelegt, doch eines Tages war sie hierher zurückgekehrt und ebenso wie die kleine Petra in diese harmonische Gemeinschaft aufgenommen worden.
Lächelnd blickte sie jetzt Andrea nach, die stolz den Kinderwagen schob.
»Petra wird von Tag zu Tag goldiger«, sagte Claudia neben ihr.
»Und sie sagt Mama zu mir«, seufzte Edith glücklich. »Können Sie ermessen, was das für mich bedeutet, Claudia?«
»Ich meine schon«, erwiderte diese, als ein Wagen knatternd die Auffahrt heraufkam.
»Nanu, wir bekommen Besuch?«, rief Claudia überrascht. Dann weiteten sich ihre Augen. »Dr. Wolfram! Das ist aber eine Überraschung!« Unbefangen streckte sie dem Besucher die Hand entgegen, als er auf sie zukam. Aber dann dachte sie an Lutz und daran, dass Bert Wolfram einmal ziemlich viel für sie übrig gehabt hatte. »Wenn Sie Denise besuchen wollen, muss ich Sie enttäuschen«, sagte sie rasch. »Ausgerechnet heute ist sie nicht da.«
Da war Sascha schon zur Stelle. »Dr. Wolfram«, rief er erfreut aus. »Nun kommen Sie doch mal.«
»Woher kennst du ihn?«, fragte Nick.
»Er war doch mein Doktor, als ich am Blinddarm operiert worden bin«, erklärte Sascha wichtig. Dann machte es ihn auch noch stutzig, dass der junge Arzt Claudia mehr Aufmerksamkeit schenkte als ihm.
»Blendend schauen Sie aus, Claudia«, versicherte Dr. Wolfram.
»Darf er Claudia zu dir sagen?«, fragte Dominik. »Lutz mag das sicher nicht.«
Dunkle Glut schoss in Claudias Wangen. »Ich heirate in vierzehn Tagen«, sagte sie leise.
»Sie heiratet Dr. Brachmann«, ergänzte Dominik.
»Ich hörte es. Aber ich dachte, Sie wären schon verheiratet«, bemerkte er verlegen. »Der eigentliche Grund meines Besuches ist, dass Dr. Baumgarten mir geschrieben hat.«
»Onkel Werner?«, erkundigte sich Sascha sichtlich erstaunt. »Kennen Sie den auch?«
»Noch nicht persönlich, aber ich bin auf dem Wege zu ihm. Das hat dein Vater vermittelt, Sascha. Und weil mein Weg mich an Sophienlust vorbeiführte, wollte ich Frau von Wellentin einmal guten Tag sagen.«
»Papi freut sich bestimmt auch, wenn Sie ihn besuchen«, erwiderte Sascha.
»Aber heute ist er mit Mutti unterwegs«, gab Dominik seinen Kommentar.
»Und ich möchte zu gern wissen, was Onkel Werner von Ihnen will«, fuhr Sascha neugierig fort.
»Es handelt sich um eine Praxis«, erklärte der junge Arzt.
»Ach so.« Das interessierte Sascha herzlich wenig. So fragte er: »Gehen wir spielen, Nick?«
Dominik warf Claudia einen schrägen Blick zu. »Wenn Lutz kommt, ist er bestimmt böse, wenn du mit einem anderen Mann redest.«
»Da mach dir nur keine Sorgen«, lächelte sie. »Dr. Wolfram und ich sind alte Bekannte. Wir waren früher mal in der gleichen Klinik.«
»Aber Lutz wird wild, wenn du einen anderen Mann anguckst«, gab Dominik nochmals zu bedenken. Dann verschwand er endlich mit Sascha.
»Das sind Rangen!«, seufzte Claudia verlegen.
»Ist Ihr zukünftiger Mann wirklich so eifersüchtig, Claudia?«, erkundigte sich Dr. Wolfram.
»Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, es festzustellen. Aber Nick hört das Gras wachsen.« Sie lächelte. »So sehen wir uns also wieder. Wollen Sie wirklich eine Landpraxis übernehmen?«
»Ich habe eine kleine Erbschaft gemacht«, berichtete er. »Nicht viel, aber gerade genug, um mich selbstständig zu machen. Die Stadt lockt mich nicht, und Dr. Baumgartens Brief kam gerade zu dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie es verstehen, Claudia, aber hier gab es ein paar Menschen, die ich kenne. Herrn von Schoenecker, Frau von Wellentin, Sascha – und auch Sie.«
Sie sah ihn gedankenvoll an. Und ob sie ihn verstand. Sie wusste, wie es war, wenn man ganz allein war. Sie hatte das Alleinsein selbst auch kennengelernt, bis sie in Denise eine Freundin gefunden hatte, die zuvor ebenfalls einsam gewesen war, nur mit dem Unterschied, dass Denise ihren Sohn hatte, der aber damals noch viel zu klein gewesen war, um diese Einsamkeit zu verstehen.
»Es ist schön hier«, sagte sie sinnend. »Ich habe mein Glück hier gefunden. Vielleicht finden Sie auch das Ihre hier, Dr. Wolfram?«
Ein ganz klein wenig schmerzte es immer noch, wenn er sie ansah, aber er hatte sich damit abgefunden, dass sie unerreichbar für ihn war.
Da kam Edith Gerlach näher. »Entschuldigen Sie bitte, Claudia, wenn ich störe«, machte sie sich taktvoll bemerkbar. »Magda möchte gern wissen, ob Dr. Brachmann und seine Eltern zum Essen kommen.«
»Sie kommen«, nickte Claudia. »Darf ich bekannt machen: Dr. Wolfram – Frau Gerlach.«
Edith reagierte seltsam. »Fräulein Gerlach«, verbesserte sie. »Sie brauchen nicht so rücksichtsvoll zu sein, Claudia.« Ganz blass war sie geworden, und überstürzt verschwand sie wieder.
»Was hat sie denn?«, fragte Bert Wolfram verblüfft.
»Sie ist eine komische kleine Person«, antwortete Claudia kopfschüttelnd. »Tatsächlich ist sie nicht verheiratet, hat aber ein Kind. Ich weiß nicht, warum sie das Fräulein so betonen musste.«
Edith wusste es. Da war ihr plötzlich ein Mann begegnet, der auf den ersten Blick Gefühle in ihr weckte, die sie nicht wahrhaben wollte. So war sie voller Abwehr.
»Na«, erkundigte sich Magda. »Kommen sie nun, oder kommen sie nicht, die Brachmanns?«
»Ja, sie kommen«, erwiderte Edith tonlos.
»Und der Herr, der gekommen ist? Was will er denn?«, fragte Magda.
»Ich weiß nicht.« Und damit lief Edith schnell ins Haus.
*
Lutz hatte den Wagen daheim gelassen. Ein Morgenspaziergang würde ihm guttun, dachte er. Während der letzten Tage war er ohnehin kaum an die frische Luft gekommen.
Er ging den schmalen Weg an der Landstraße entlang und sah den grauen Wagen in Richtung Sophienlust einbiegen. Ein Mann saß am Steuer. Und diesen Mann sah er eine Viertelstunde später mit Claudia im Gutshof stehen. Wie vertraut sie sich unterhielten! Glühende Eifersucht erfasste ihn. Unverwandt blickte er zu den beiden hinüber, ohne sich bemerkbar zu machen.
Hinter den Büschen wisperte es. Lutz wandte sich um und blickte in Dominiks dunkle Augen.
»Ich habe gleich gesagt, dass du wütend sein wirst, wenn Claudia mit ihm redet«, sagte der Junge. »Jetzt bist du wütend.« Es klang triumphierend.
»Das ist doch bloß Dr. Wolfram«, mischte sich Sascha vermittelnd ein. »Er kommt doch gar nicht wegen Claudia. Er will doch zu Onkel Werner.«
»Aber er kennt sie«, widersprach Dominik. »Ich mag es gar nicht, wenn fremde Männer kommen.«
»Ich auch nicht«, knurrte Lutz.
»Dann sag ihm doch, dass er verschwinden soll.« Dominik machte aus seinem Herzen keine Mördergrube.
»Man muss doch höflich sein, wenn Besuch kommt«, lenkte Sascha vernünftig ein. »Papi kennt ihn doch auch. Er war mein Arzt.«
Lutz kombinierte rasch. Arzt – Krankenschwester! Beiläufig hatte Claudia ihm einmal von Dr. Wolfram erzählt. Er hatte es vergessen. Jetzt raubten ihm eifersüchtige Gedanken alle Vernunft. In seinen Augen funkelte Zorn, als er rasch über den Gutshof ging. Warum wurde Claudia rot? Warum lächelte sie so verlegen?
Besitzergreifend stellte er sich neben sie und legte seinen Arm um ihre Schultern.
»Dr. Wolfram – Dr. Brachmann, mein Verlobter«, stammelte Claudia verwirrt. »Ich habe deinen Wagen gar nicht gehört, Lutz.«
»Ich bin zu Fuß gekommen«, knurrte er.
»Ich wollte mich gerade verabschieden«, sagte Bert Wolfram entschuldigend. »Würden Sie Frau von Wellentin bitte herzlich grüßen, Claudia? Und Ihnen alles erdenklich Gute für die Zukunft.«
Lutz presste die Lippen zusammen. Er brachte kein verbindliches Wort hervor.
»Der arme Kerl«, meinte Claudia, als der graue Wagen sich entfernte. »Wenn Blicke töten könnten, wäre er umgefallen. Was hat er dir getan, Lutz?«
»Wie kommt er dazu, dich Claudia zu nennen?«, fragte er aufgebracht.
»Dummer Lutz«, sagte sie zärtlich. »Hast du Grund zur Eifersucht?«
»Angeschaut hat er dich – und wie. Sogar Nick ist es aufgefallen.«
»Hat er dich aufgehetzt? Ich hab’ mir doch gedacht, dass er auf der Lauer liegt. Ich liebe dich, Lutz, nur dich!«
»Das möchte ich dir auch geraten haben. Was wollte er hier?«
»Er will Dr. Baumgarten aufsuchen wegen der Praxis.«
»Er will sich hier niederlassen?«, fragte Lutz aufgebracht.
»Warum sollte er sich nicht hier niederlassen?«, gab sie zurück. »Landärzte sind rar, und er ist dafür geeignet. Er ist ein guter Arzt, Lutz.«
»Ich kann ihn nicht ausstehen«, erwiderte er erregt.
»Weil du Gespenster siehst, die es nicht gibt.«
»Soll ich meinen Nebenbuhler willkommen heißen?«, fragte er empört.
»Er war nie dein Nebenbuhler«, erwiderte sie ernst.
»Er ist verliebt in dich«, sagte er.
»Vielleicht war er das einmal. Aber er ist ein feiner Kerl. Selbst wenn du mir böse bist, muss ich das feststellen. Aber es ist besser, wir sprechen jetzt darüber, als dass wir darum gleich einen Ehestreit vom Zaune brechen. Ich denke auch an Werner Baumgarten und Barbara. Er braucht Entlastung, und allem Anschein nach ist dieses Stückchen Erde, das wir so lieben, für die meisten nicht attraktiv genug, um hier eine Existenz zu gründen. Es gehört Idealismus dazu, Lutz. Dr. Wolfram ist ein Idealist. Wenn er jetzt mit dem Gefühl davongefahren ist, dass er mir Schwierigkeiten bereitet, wird er sich genau überlegen, ob es Sinn hat, sich hier niederzulassen. Und dann ist Barbara um eine Hoffnung ärmer.«
Er sah sie gedankenvoll an. »Du hättest Pfarrer werden sollen«, meinte er kleinlaut. »Ich gehe in mich. Leihst du mir deinen Wagen, Schätzchen?«
»Wofür?«, fragte sie überrascht.
»Um mich bei ihm zu entschuldigen. Das alte Vehikel werde ich ja wohl einholen.«
*
An der Straßenkreuzung hielt Bert Wolfram an und überlegte. Hatte es überhaupt noch Sinn, zu Dr. Baumgarten zu fahren, nachdem Lutz Brachmann ihn so feindselig angeschaut hatte? Er wollte Claudia keinen Ärger bereiten. Auf dem Lande war das Leben anders als in der Stadt. Da konnte man einander nicht so leicht aus dem Weg gehen, und dieser Dr. Brachmann war hier daheim und kam aus einer angesehenen Familie. Er konnte ihm viele Steine in den Weg legen, wenn er wollte.
Dass Claudia unerreichbar für ihn war, hatte er längst eingesehen, aber sein Beruf bedeutete ihm alles. Noch konnte er zurück. Noch konnte er Dr. Baumgarten einen höflichen Absagebrief schreiben.
Neben ihm hielt ein Wagen, und Bert Wolfram sah in Lutz Brachmanns Gesicht.
»Können wir ein paar Worte miteinander sprechen?«, fragte Lutz und stieg aus. »Ich habe mich wohl ziemlich dämlich benommen, Dr. Wolfram?«
»Wir versperren die Straße«, wich Bert Wolfram einer Antwort aus.
»Ach, um diese Zeit kommt hier sowieso keiner vorbei«, erklärte Lutz. »Ich wollte mich nur bei Ihnen entschuldigen. Claudia hat mir die Leviten gelesen. Ich dachte, dass es vielleicht gut wäre, wenn ich Ihnen gestehe, dass ich mich wie ein Flegel benommen habe. Wir brauchen so nötig einen zweiten Arzt. Und Claudia sagt, dass Sie okay sind.«
»Danke«, erwiderte Bert Wolfram. »Ich habe gerade überlegt, ob es noch sinnvoll wäre, Dr. Baumgarten aufzusuchen.«
»Ich bitte Sie darum«, antwortete Lutz. »Der arme Doktor ist völlig überlastet. Sie werden ein gutes Auskommen hier haben. Das Landleben liegt nicht jedermann. Und Frau Baumgarten wird Ihnen ein Lied davon singen können, wie schwer es ein Arzt hier hat.«
»Ich könnte mir keine schönere Aufgabe vorstellen«, erwiderte Bert. »Landarzt zu werden, war immer mein Wunschtraum.«
Lutz streckte ihm die Hand entgegen. »Seien Sie mir bitte nicht böse«, murmelte er. »Vielleicht werden wir eines Tages gute Freunde werden. An mir soll es nicht liegen. Wenn Sie Gast unserer Hochzeit sein wollen – Sie sind herzlich eingeladen.«
Mit einem festen Händedruck schieden sie voneinander. Lutz wendete seinen Wagen, und Bert Wolfram fuhr zum Doktorhaus, wo er freudig empfangen wurde.
*
Zu Dominiks Verwunderung war mittags alles wieder in bester Ordnung und man sprach darüber, dass Dr. Wolfram nun wohl doch die Praxis im Ort übernehmen würde.
»Es wird ja auch Zeit, dass Doktor Baumgarten entlastet wird«, meinte Claudias zukünftiger Schwiegervater.
»Unser Tugendwächter Dominik hätte es beinahe verhindert«, spottete Claudia.
»Weil er dich doch so angeguckt hat«, verteidigte sich der Junge.
»Liebe Güte«, schlichtete Dr. Brachmann senior, »es werden noch viele Männer Claudia anschauen. Wenn Lutz da immer gleich aus dem Häuschen geriete, könnten wir uns auf was gefasst machen.« Danach wechselte er das Thema und sprach von der Hochzeit, die auf Denises Wunsch in Sophienlust gefeiert werden sollte.
Dass Denise heute nicht anwesend war, hatte man zwar staunend vermerkt, aber auf einen Wink von Claudia hin sprach man nicht darüber. Zur allgemeinen Überraschung äußerten sich auch die Kinder nicht dazu. Auch Edith Gerlachs Schweigsamkeit fiel nicht sonderlich auf, denn sie war immer äußerst zurückhaltend. Andrea aber schwärmte laut von der kleinen Petra, die ja sooo süß sei.
»Hat sie eigentlich noch immer keine Verbindung zu ihren Eltern?«, fragte Frau Brachmann Claudia leise.
Claudia schüttelte den Kopf. »Ist doch komisch, dass immer die nettesten Mädchen auf schäbige Männer hereinfallen.«
»Doch nicht immer«, lächelte Frau Brachmann. »Dich zähle ich zu den allernettesten Mädchen.«
»Ich habe ja auch ein Mordsglück, einen Mann wie Lutz zu bekommen und Schwiegereltern wie euch«, erwiderte Claudia dankbar.
Lautlos hatte sich Lutz herangepirscht. »Interessant zu hören, wie sich Schwiegermutter und Schwiegertochter mit Komplimenten überschütten«, lachte er. »Das soll es selten geben.«
»Na, das Märchen von der bösen Schwiegermutter wird manchmal auch reichlich übertrieben«, äußerte sich seine Mutter. »Natürlich ist es nicht ganz einfach, wenn man nur einen Jungen hat, aber man braucht sich ja nicht in die Idee zu verrennen, dass er einem weggenommen wird. Wir haben jedenfalls eine Tochter hinzugewonnen, und das ist für uns zwei Alte wunderschön.«
»Ihr zwei Alten«, sagte Claudia neckend. »Schau mal, wie Papa mit den Jungen Fußball spielt.«
Er tat es mit jugendlicher Begeisterung, während Andrea sich wieder mit Petra beschäftigte und Roli vor ihrer Staffelei saß.
»Denise wollte doch einen Zeichenlehrer ins Haus nehmen«, erinnerte Frau Brachmann sich plötzlich. »Roli ist wirklich ungewöhnlich begabt.«
»Es hat sich aber bisher niemand gefunden, dem die Umstände zugesagt hätten«, berichtete Claudia.
»Ich glaube, ich wüsste jemanden. So eine Art Universalgenie. Er malt, modelliert und spielt auch noch ein paar Instrumente. Erinnerst du dich noch an Wolfgang Rennert, Lutz?«
Dessen Gesicht verdüsterte sich. »Aber, Mama«, sagte er vorwurfsvoll, »das könnte man Denise doch nicht zumuten. Er ist vorbestraft.«
»Wegen einer Dummheit«, antwortete sie ruhig. »Die Menschen sind so voller Vorurteile. Gut, er hat einmal Geld unterschlagen. Aber nicht für sich, sondern für seine kranke Mutter. Außerdem hat er seine Strafe verbüßt, und man sollte ihm eine Chance geben.«
»Doch nicht gerade hier unter so vielen Kindern«, wandte Lutz ein.
»Warum nicht? Gerade Kinder könnten ihm neuen Lebensmut geben. Schließlich ist er kein Sittlichkeitsverbrecher. Ihm geht es schlecht. Sehr schlecht sogar. Aber Almosen nimmt er nicht.«
»Du vergisst nur eins, Mama. Es war Hubert von Wellentin, der ihn damals angezeigt hat.«
»Na und? Er hatte auch keine reine Weste und hat sich jetzt sehr zu seinem Vorteil verändert. Und schließlich ist es Denises Angelegenheit. Ich werde einmal mit ihr sprechen.«
Dazu ergab sich an diesem Tage jedoch keine Gelegenheit mehr, denn Denise kam sehr spät.
»Nun, habt ihr den Tag gut verbracht?«, erkundigte sie sich.
»Von einigen Aufregungen abgesehen«, lächelte Claudia. »Dich braucht man ja nicht zu fragen. Dir sieht man es an.«
»Ist Nick böse auf mich gewesen?«
»Gemeckert hat er natürlich, aber dann kam Dr. Wolfram, und Nick bemühte sich sehr, Lutz’ Eifersucht anzustacheln. Vierzehn Tage vor unserer Hochzeit hätten wir beinahe unseren ersten Streit bekommen.«
»Dieser Nick«, seufzte Denise, »ich möchte nur wissen, was er sich manchmal so denkt.«
»Was dich und Alexander betrifft, denkt er bestimmt das Richtige«, meinte Claudia neckend. »Er hat halt so seine Grundsätze. Wenn zwei zusammengehören, hat es keinen anderen zu geben. Alexander kann sehr beruhigt sein. Nick wird wie ein Zerberus darüber wachen, dass dir kein anderer Mann zu nahe kommt.«
»Für mich gibt es nur Alexander – keinen anderen«, sagte Denise träumerisch.
»Davon bin ich überzeugt, Isi«, lächelte Claudia. Dann kam sie auf Wolfgang Rennert zu sprechen.
»Wenn Mama für ihn bürgt, kann er nicht schlecht sein«, sagte sie.
»Nun, ich kann ihn mir ja einmal anschauen. Aber jetzt bin ich müde. Morgen steht uns ein anstrengender Tag bevor.«
*
Mit dem neuen Bus waren sie abgeholt worden. Zwölf Kinder zwischen dreizehn und vier Jahren, begleitet von Schwester Gretli, die von Dominik und Roli freudig begrüßt wurde.
Gretli war ein nettes Mädchen, aber im Moment machte sie einen reichlich erschöpften Eindruck. Denn mit einem Dutzend Kinder eine weite Reise zu machen, strapazierte selbst das geduldigste Geschöpf. Denise war dafür, dass sie sich erst einmal ausruhte.
Dominik, Sascha und Andrea musterten die Kinder eingehend, während Roli, Robby und Mario sich zurückzogen. Robby, weil er nie von Marios Seite wich, Roli mehr, weil jäh alle Erinnerungen an das Haus Bernadette und Madame Merlinde in ihr erwacht waren, die sie lieber nicht geweckt wissen wollte. Sie ging zu Edith, die eben ihre kleine Petra versorgte. Zärtlich betrachtete sie das Kind.
»Mir wäre es lieber, wenn nur kleine Kinder herkommen würden«, bekannte sie.
Edith war überrascht. Roli sagte selten etwas und schon gar nichts, was nach Kritik klingen könnte.
»Warum wäre dir das lieber?«
»Tante Isi wird jetzt manchen Ärger bekommen, und das gefällt mir nicht«, antwortete Roli. »Mit kleinen Kindern ist das anders. Die kann man so erziehen, wie man sie haben möchte. Manche von den neuen Kindern legen es doch darauf an, Ärger zu machen. Ich kenne das.«
»Es wird schon nicht so schlimm werden«, tröstete Edith.
»Na, ich weiß nicht«, zweifelte Roli.
Auch Dominik war von den vielen Kindern, die da angekommen waren, nicht begeistert. Ein paar waren schon darunter, die er mochte und die er noch von früher kannte. Aber sehr genau konnte er sich an die Zeit, die er im Heim verbracht hatte, nicht mehr erinnern.
Augenblicklich ging alles noch ganz ruhig ab. Frau Trenk brachte die Kinder in ihre Zimmer, und in diesen hübschen Räumen hellten sich selbst die düstersten Gesichter auf.
»Der Toni, die Ursi und der Marco sind ganz nett«, sagte Dominik währenddessen zu seiner Mutter.
»Du sollst dich nicht sofort festlegen«, ermahnte sie ihn. »Sie haben alle die gleichen Rechte und sollten auch alle gleich nett behandelt werden. Auch von dir.«
»Das ist aber ein bisschen viel verlangt«, murrte er. »Den Großen mit dem komischen Namen mag ich gar nicht. Du hättest sie dir alle vorher anschauen sollen.«
Der Große mit dem komischen Namen, er hieß Golo, war ein Mischling, aber für Denise war das kein Werturteil. Er stammte, wie sie aus den Papieren wusste, sogar aus einer sehr guten Familie. Sein Vater war ein Libanese, seine Mutter eine Deutsche, die sich aber von ihrem Mann getrennt und wieder geheiratet hatte. Regelmäßig war für den Jungen gezahlt worden, aber zu sich nehmen wollte ihn weder der Vater noch die Mutter.
Er war unter den Neuankömmlingen das älteste Kind, sicher auch das schwierigste und verschlossenste – und nun kam Dominik gleich mit seiner Ablehnung daher.
»Wir werden uns später ernsthaft über alle Kinder unterhalten«, bestimmte Denise. »Ich möchte nicht, dass du unfreundlich bist, Nick.«
Er zog einen Schmollmund, sagte aber nichts und verschwand.
Da kam Claudia. »Golo will ein Einzelzimmer haben«, berichtete sie. »Sein Vater würde dafür auch mehr bezahlen. Er ist schwierig, Denise.«
»Ja, ich weiß. Aber er kann ja ein Einzelzimmer haben.«
»Dann wird er wohl immer ein Einzelgänger bleiben«, gab Claudia zu bedenken.
»Erzwingen lässt sich nichts. Lassen wir doch alles an uns herankommen.«
»Na, wenn ich die Gesellschaft so betrachte, möchte ich doch meinen, dass du dir einigen Ärger eingehandelt hast, Isi.«
»Jetzt fängst du auch noch an«, seufzte Denise. »Sie sind ja noch gar nicht richtig da. Es wird ziemlich lange dauern, bis wir mit allen vertraut werden. Ich bin mir darüber durchaus im Klaren. Bis jetzt hatten wir ja nur Kinder um uns, die wir sozusagen selber ausgesucht hatten. Aber das ist nicht der Sinn eines solchen Heimes, Claudia.«
»Sie hängt sich so hinein, dass sie nie mehr herauskommen wird«, dachte Claudia. »Sie wird sich selbst und ihr privates Glück darüber vergessen, weil sie anderen nicht die Schwierigkeiten aufbürden will.«
Inzwischen redeten Dominik und Sascha auf Sandra ein. »Mit so viel Kindern mag ich nicht essen«, erklärte er. »Ich werde Mutti sagen, dass wir nun nur noch mit ihr essen wollen.«
»Das geht doch nicht«, lenkte Sascha ein.
»Und was sollen Roli, Mario und Robby dazu sagen?«, fragte Andrea.
»Ich hab’s mir eben ganz anders vorgestellt. Es ist schon viel zu lange her, dass ich in einem Heim war.«
»Sophienlust ist auch ein Heim«, entgegnete Andrea.
»Aber nicht eins, in das jeder kommen kann«, beharrte Dominik.
»Wenn sie doch aber keine Eltern haben, die sich um sie kümmern«, versuchte Andrea ihn umzustimmen.
»Wollt ihr nicht zum Essen kommen?«, forderte Claudia die drei auf.
»Nein«, erwiderte Dominik heftig. »Wir wollen mit euch essen.«
»Wir essen heute aber mit den Kindern, damit sie uns alle kennenlernen.«
»Mutti und du auch? Und Edith ebenfalls«, fragte Dominik empört.
»Wir auch.«
»Wenn das immer so ist, gehe ich mit nach Schoeneich«, erklärte Dominik renitent. »Ich sag’s Onkel Alexander gleich, wenn er euch abholen kommt.«
*
Es blieb nicht bei der bloßen Drohung. Alexander fiel aus allen Wolken, als Dominik ihn mit der Frage überfiel: »Darf ich mit nach Schoeneich kommen, Onkel Alexander?«
»Was ist denn los?«, fragte er verblüfft.
»Mir sind das zu viel Kinder, und die meisten mag ich nicht. Ich möchte lieber mit Sascha und Andrea allein sein. Ich mag auch nicht mit den anderen essen.« Dominik sprach so laut, dass auch Denise es hören konnte.
»Und deine Mutti?«, wollte Alexander wissen.
»Sie soll auch mitkommen«, bestimmte Dominik eigensinnig. »Es war so schön in Sophienlust, solange wir allein waren. Jetzt gefällt es mir gar nicht mehr.«
Alexander warf Denise einen besorgten Blick zu. Dass es Komplikationen geben könnte, hatte er befürchtet, dass aber gerade Dominik sich so aufsässig zeigen würde, hatte er nicht erwartet.
»Natürlich kannst du mit nach Schoeneich kommen, wenn deine Mutti es erlaubt«, erklärte er und fragte sich zugleich, ob das richtig war.
»Sie erlaubt es schon. Sie hat ja jetzt mit den anderen Kindern zu tun«, behauptete Dominik aggressiv.
»Nun, wenn du also mitfahren willst …« Denise tat gleichgültig, obgleich ihr sorgenvolle Gedanken kamen.
»Ja, ich will.«
Sascha und Andrea waren ziemlich fassungslos. Sascha ging zu Denise und sah sie mit einem um Verzeihung bittenden Lächeln an.
»Er meint es bestimmt nicht so, Tante Isi«, sagte er. »Es waren halt auf einmal so viel, und er kennt sie eben noch nicht. Wir möchten gern weiter nach Sophienlust kommen. Du darfst nicht denken, dass es uns nun nicht mehr gefällt.« Er machte eine kleine Pause, dann fügte er hinzu: »Ich werde auch mal vernünftig mit Nick reden.«
»Danke, Sascha, du bist mir lieb«, antwortete Denise leise. Danach wandte sie sich Alexander zu. »Bist du auf meiner oder auf seiner Seite?«
»Was ich wünsche, weißt du doch genau. Diesbezüglich kann ich Dominik verstehen. Liebes. Es ist schwer, einen geliebten Menschen mit anderen teilen zu müssen.«
»Ein richtiger Trotzkopf ist er«, stellte Claudia fest, als Alexander mit den drei Kindern davonfuhr. »Aber Alexander wird ihn schon zur Vernunft bringen.«
»Dann eher Sascha«, seufzte Denise mit einem müden Lächeln. »Wäre es möglich, dass ich meinen Jungen verliere, weil ich anderen Kindern eine Heimat geben möchte?«
»Es war nicht deine Idee, Isi. Du hast sie nur aufgegriffen.«
»Eine gute, edle Idee, und ich werde sie durchführen«, erklärte Denise energisch. »Ich habe nicht vergessen, was früher war. Ich habe alles Sophie von Wellentin zu verdanken – auch dass ich Alexander fand.«
Drüben, im Seitenflügel, war Ruhe eingekehrt. Müde von der Fahrt, gesättigt von einem guten Essen, wie sie es noch nie bekommen hatten, schliefen die Kinder. Nur einer war noch munter, als Denise durch die Zimmer ging: Golo! Er drehte schnell den Kopf zur Seite, als sie durch die Tür blickte.
Golo war dreizehn, schmal, schlank, und sein schwarzer Lockenkopf hob sich krass von dem weißen Kissen ab. Ihrem Impuls folgend, trat Denise an sein Bett.
»Bist du nicht gern hergekommen, Golo?«, fragte sie leise.
»Ich bin überhaupt nicht gern in einem Heim«, erwiderte er trotzig. »Ich bin schon zweimal weggelaufen, aber sie haben mich immer wieder gefunden. Das nächste Mal bringe ich mich um. Haben will mich doch keiner.«
»Das darfst du nicht sagen. Ich möchte, dass du dich hier wohlfühlst.«
Seine tiefschwarzen Augen blickten sie an. Alle Trauer eines einsamen Kindes war in ihnen zu lesen.
»Sie möchten das vielleicht«, antwortete er stockend. »Aber die anderen? Ich bin anders als die anderen Kinder. Madame Merlinde hat mich doch auch bloß genommen, weil mein Vater so viel für mich bezahlt hat.«
»Schreibt er dir?«, fragte Denise.
Er nickte.
»Und schreibst du ihm auch?«
»Wenn ich muss«, erwiderte er trotzig.
»Du solltest es gern tun, dann freut er sich sicher darüber.«
»Er hat ja keine Zeit. Er hat nur Geld. Warum hat meine Mutter ihn geheiratet, wenn sie doch nicht bei ihm geblieben ist?«
»Ich weiß es nicht, Golo.«
Er lachte bitter, und dieses Lachen ging Denise durch und durch.
»Weil sie sein Geld wollte«, sagte er hart. »Und dann hat sie einen gefunden, der auch Geld hatte. Da wollte sie uns nicht mehr. So ist das. Nun wissen Sie es, und nun fragen Sie mich nichts mehr.«
Denise fragte nicht mehr. Sie widerstand auch der Versuchung, ihm über das Haar zu streichen.
»Schlaf gut, Golo«, sagte sie leise. »Morgen ist alles besser.«
Dann stand sie vor Dominiks leerem Bett, und ihr Herz zog sich zusammen. Um seinetwillen, um immer mit ihm zusammen sein zu können, für ihn hatte sie Sophie von Wellentins Erbe angenommen, obgleich ihr Stolz es ihr verboten hätte. Und nun?
*
»Glaubst du, dass Mutti traurig ist?«, fragte Dominik leise. Sein Gewissen schlug. Er konnte nicht schlafen. Auf Zehenspitzen war er zu Alexander ins Zimmer geschlichen.
»Bestimmt ist sie traurig. Aber du hättest es dir früher überlegen müssen, Nick.«
»Ich will nicht, dass sie traurig ist. Sie kann ja auch herkommen. Frau Trenk und Edith sind da, Gretli, Erna und Liesel auch. Früher war das eben anders. Da hatten wir dich noch nicht, Onkel Alexander, Sascha und Andrea auch nicht.«
»Aber ihr fandet es doch immer schön, unter vielen Kindern zu sein.«
»Nicht immer, manchmal«, schränkte Dominik ein. »Jetzt möchte ich lieber eine kleine Familie haben.«
»Ich auch«, dachte Alexander, aber das konnte er ihm nicht sagen, sonst hätte sich Nick noch mehr auf diesen Rückhalt verlassen.
»Geh jetzt schlafen, Nick«, forderte er ihn liebevoll auf.
»Kommst du noch ein bisschen zu mir? Das tut Mutti auch immer. Erzählst du Andrea keine Geschichten?«
»Das tun Männer nicht, Nick.«
»Warum eigentlich nicht? Wenn ich mal Kinder habe, erzähle ich ihnen Geschichten. Vielleicht probierst du es mal?«
Dominik vermisste das abendliche Gespräch mit seiner Mutter, an das er gewöhnt war und ohne das er nicht einschlafen konnte. Was Alexander bei seinen Kindern nie getan hatte, tat er nun für Nick. Er setzte sich zu ihm und erzählte. Und weil ihm nichts anderes einfiel, sprach er über einen Mann, eine Frau und einen kleinen Jungen, die sich an einem trüben Tag begegnet waren und sich lieb gewonnen hatten.
»Du darfst Sascha und Andrea nicht vergessen«, murmelte Dominik schlaftrunken. »Wenn wir uns zusammentun, werden wir Mutti bestimmt dazu bringen, auch nach Schoeneich zu kommen. Ich freue mich schon, wenn ich Papi zu dir sagen darf.«
Alexander beugte sich zu ihm herab und küsste ihn auf die Stirn.
*
Kati hatte es heute besonders eilig, von der Schule heimzukommen. Sie ließ sich auf keine Gespräche mit Nick und Andrea ein, die ihr gar zu gern berichten wollten, was sich nun in Sophienlust tat. Die Mutti – in ihrem kleinen Herzen hatte sich schon ganz fest der Gedanke verankert, dass Irene von Wellentin nun für immer ihre Mutti sei – war schon seit ein paar Tagen so unruhig. Richtig krank sah sie aus, und das betrübte Kati sehr. So schnell sie nur konnte, lief sie heim, nicht ahnend, dass Frau von Wellentin, mit dem Wagen von Sophienlust kommend, sie abholen wollte.
»Tag, Omi«, begrüßte Dominik seine Großmutter. »Kati ist schon fort. Sie hatte es mächtig eilig, aber sie wusste sicher nicht, dass du sie abholen willst.« Er gewahrte seine Mutter und fuhr aggressiv fort. »Onkel Alexander wollte uns abholen.«
»Er musste in die Stadt«, erwiderte Denise bedrückt. »Bekomme ich keinen Kuss, Nick?«
Irene von Wellentin hatte es eilig. »Ich schaue morgen bei euch vorbei«, sagte sie überstürzt.
»Warum ist sie denn so aufgeregt?«, erkundigte sich Dominik.
»Sie will Kati nur nicht warten lassen«, meinte Denise, aber sie wusste, warum ihre Schwiegermutter so erregt war. Heute war mit dem Eintreffen von Hanna Ebert zu rechnen. Irene von Wellentin hatte gerade ihr Herz bei ihr ausgeschüttet, und darüber hatte Denise für kurze Zeit ihre eigenen Sorgen vergessen. Jetzt waren sie wieder da, denn Nick machte keine Anstalten, in ihren Wagen zu steigen, während die anderen schon verlegen um ihn herumstanden.
»Ich will nicht nach Sophienlust«, verkündete er aufsässig. »Ich hätte mit Omi fahren sollen, wenn Onkel Alexander nicht da ist.«
»Wie ist es mit euch?«, fragte Denise Andrea, Robby und Roli. »Findet ihr, dass es richtig ist, wie Nick sich benimmt?«
»Sei doch lieb, Nick«, redete Andrea auf ihn ein.
Eigentlich blieb ihm nichts anderes übrig, als sich der Mehrheit zu beugen, aber seine Miene verriet, dass er es nur unter Protest tat.
»Gefällt Omi der Betrieb?«, fragte er aggressiv.
»Sie ist jedenfalls nicht so ungerecht wie du«, antwortete Denise.
»Es sind wirklich nette Kinder dabei«, mischte sich Robby ein, der sonst nicht viel sagte.
»Über mich sollst du dich nicht ärgern, Tante Isi«, flüsterte Andrea verschüchtert.
Dominik warf ihr einen beleidigten Blick zu. Er fühlte sich verraten. Ganz geheuer war ihm in seiner Rolle zwar nicht, aber klein beigeben wollte er auch nicht so rasch.
Stumm saß er neben seiner Mutter und starrte geradeaus. Er sprach nicht wie sonst von der Schule und seinen Erlebnissen, die er sonst gar nicht rasch genug loswerden konnte.
*
Kati kam außer Atem vor der Villa Wellentin an. Da stand eine Frau vor der Gartentür und starrte sie so komisch an, dass sie Angst bekam. Ihr gefiel die Frau nicht. Sie hatte gefärbte Haare und einen stark geschminkten Mund. Und es gefiel ihr schon gar nicht, wie sie von der Frau gemustert wurde. Sie drückte rasch auf die Klingel, aber da fuhr schon die dunkle Limousine vor, und Kati atmete hörbar auf.
»Mutti«, rief sie und umarmte Irene von Wellentin stürmisch.
»Ich wollte dich abholen, Kati, aber du warst schon weg. Du musst aber sehr schnell gelaufen sein.«
Über den Kopf des Kindes hinweg bemerkte Irene von Wellentin nun die noch junge Frau, und ein starkes Zittern lief durch ihren Körper.
»Ich hatte so Angst, dass du krank bist, Mutti«, sagte Kati und blickte erschrocken in das totenbleiche Gesicht. »Du bist ja auch krank. Ich rufe ganz schnell Dr. Baumgarten an.«
Bewegungslos stand die Fremde noch immer vor dem Haus, als Irene von Wellentin und Kati schon längst darin verschwunden waren.
»Du brauchst Dr. Baumgarten nicht anzurufen«, lenkte Irene von Wellentin das Kind ab. »Ich bin nicht krank. Ich möchte nur schnell einmal in der Fabrik anrufen. Holst du mir bitte ein Glas Wasser, Kati?«
Jetzt erst fiel Kati auf, dass das Hausmädchen nicht da war. Und plötzlich dachte sie, dass die Fremde, die vor der Tür gestanden hatte, vielleicht eine Stellung suchte. Man hatte darüber gesprochen, dass eine neue Haushaltshilfe eingestellt werden sollte. Aber solch eine wie die wollte Kati nicht hier sehen. Ob sie das sagen durfte?
Als sie durch die Diele ging, vernahm sie Irene von Wellentins erregte Stimme.
»Sie ist es, Hubert«, sagte sie. »Sie ist es bestimmt. Sie ist da.«
Kati wusste nicht, was das bedeuten konnte, sie fühlte nur, dass die Mutti sich maßlos aufregte, und das ging ihr sehr nahe. Und sie fühlte auch, dass jene fremde Frau vor der Tür der Anlass dazu war.
*
»Sie sagt Mutti zu Frau von Wellentin«, ging es Hanna Ebert durch den Kopf. »Es ist Kati, meine Tochter, und sie nennt diese Frau Mutti.« Es war kein Schmerz, der sie bei diesem Gedanken bewegte. Sie überlegte nur fieberhaft, ob daraus Kapital zu schlagen sei.
Die Sucht nach Geld und Wohlstand hatte sie einst an der Seite ihres Mannes aus der Heimat in die Ferne getrieben. An harte Arbeit hatte sie dabei nicht gedacht. Aber sie hatte hart arbeiten müssen, und zu Reichtümern war sie doch nicht gekommen. Sie wollte leben und nicht an der Seite eines strebsamen Mannes ein bescheidenes Dasein führen. Deshalb hatte sie ihren Mann verlassen und ihr Glück anderswo gesucht. Aber sie hatte es nicht gefunden.
Als sie die Nachricht vom Tode ihres Vaters bekommen hatte, war sie gerade wieder einmal am Ende gewesen. Ein Häufchen Elend, das sich zu einem gefühlvollen Brief aufgerafft hatte, in dem jedes Wort eine Lüge gewesen war, denn der Gedanke, nun auch noch mit ihrem Kind belastet werden zu können, hatte sie in Panik versetzt.
Später kam das Schreiben von Hubert von Wellentin, das Geld für das Flugticket in die Heimat. Es zog sie nicht zurück. Besser konnte es ihr daheim wohl auch nicht gehen, hatte sie gedacht und sich mit dem Geld Hubert von Wellentins ein paar schöne Wochen gemacht.
Bald aber war es verbraucht, ohne dass sich irgendwo eine neue Geldquelle aufgetan hätte. Nur das Reisegeld war ihr geblieben.
Nicht die Sehnsucht nach ihrem Kind hatte sie schließlich heimgetrieben, auch nicht die Sehnsucht nach der Heimat. Sie hatte nur keinen Ausweg mehr gesehen.
»Ich möchte gutmachen, was ich früher versäumt habe«, hatte Hubert von Wellentin ihr geschrieben. »Ich werde für Sie und Kati sorgen.«
Nun, für Kati sorgte er anscheinend sehr gut, wenn sie in seinem Hause lebte und Mutti zu seiner Frau sagte.
Die Begegnung mit Kati war für Hanna Ebert überraschend gekommen, denn sie hatte angenommen, dass das Kind in Sophienlust sei. Davon, dass es bei den Wellentins lebte, hatte Hubert von Wellentin nichts geschrieben. Aber vielleicht hatte sich das erst später ergeben.
Wie entsetzt Frau von Wellentin sie angesehen hatte! Das konnte doch nur bedeuten, dass sie fürchtete, Kati zu verlieren. Der Gedanke elektrisierte Hanna Ebert. Wenn sie es fürchtete, wollte sie das Kind vielleicht behalten! War Kati ein Objekt, aus dem sie Kapital schlagen konnte?
Hanna Ebert hatte einen Silberstreifen am Horizont entdeckt. Vielleicht sogar ein Huhn, das goldene Eier legte.
*
Was früher undenkbar gewesen wäre, geschah an diesem Tag. Hubert von Wellentin sagte sämtliche Besprechungen ab und fuhr nach Hause.
Seine Frau befand sich noch immer in einem Zustand höchster Erregung, als er ankam.
»Ist sie noch da?«, raunte sie.
»Ich habe niemanden gesehen, Irene. Vielleicht war es eine ganz zufällige Begegnung.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe sie erkannt. Sie sieht schrecklich aus. So billig, so verdorben. Kati darf nie erfahren, dass sie ihre Mutter ist. Hubert, ich flehe dich an, tu alles, um diesem empfindlichen Kind dies zu ersparen.«
»Ich will ja gern alles tun«, erwiderte er begütigend. »Ich weiß doch, wie dir Kati ans Herz gewachsen ist, und ich selbst kann sie aus unserem Leben auch nicht mehr wegdenken.«
Er versank in Nachdenken. Nun hatte sie Dominik, ihren Enkel, und er wusste, dass sie ihn sehr liebte. Und dennoch nahm Kati einen Platz in ihrem Herzen ein, der dem des Enkels gleichkam. Wie konnte das geschehen? Weil Kati niemanden hatte? Weil sie so anhänglich und dankbar war?
Es war doch gar nicht so leicht gewesen, ihr Vertrauen zu gewinnen. Er erinnerte sich noch genau, wie abweisend sie zu ihm gewesen war, ja, wie sie sich vor ihm geradezu gefürchtet hatte. Doch eines Tages war alles anders geworden. Mit ihren großen, ernsten Augen hatte Kati ihn angesehen und war auf ihn zugekommen.
»Schade, dass der Großvater nicht mehr erlebt, wie lieb Sie zu den Kindern sind«, hatte sie erklärt. Ein paar schlichte Worte, die sein Herz gerührt hatten. Und dann hatten sie Kati mit sich nach Hause genommen, weil Irene wohl gespürt hatte, dass dieses Kind noch viel mehr Liebe und Verständnis brauchte als jedes andere.
»Ich gehe zu Kati«, sagte er.
»Du wirst ihr doch nichts sagen?«, stöhnte sie auf.
Er legte seine Hände auf ihre Schultern. »Irene, wir wollen uns keine Illusionen machen. Kati hat eine Mutter, und wenn sie zu dieser Mutter will, können wir ihr den Weg nicht versperren. Wir können weiter über sie wachen, aber ein Recht auf sie haben wir nicht. Es tut mir weh, dass ich dir das sagen muss, und ich verspreche dir noch einmal, dass ich nichts unversucht lassen werde, damit Kati bei uns bleiben kann. Aber …«
Er konnte nicht mehr weitersprechen, als er in ihre kummervollen Augen blickte. Schnell ging er aus dem Zimmer und stieg die Treppe hinauf.
Kati saß an ihrem Schreibpult. Er blickte über ihre Schulter hinweg auf das Heft.
»Schön schreibst du«, lobte er sie.
»Das sagt Herr Brodmann auch«, versicherte sie eifrig. »Ich gebe mir ja auch Mühe. Ich möchte euch Freude machen. Ihr seid so gut zu mir, und Mutti freut sich doch so sehr, wenn ich ein gutes Zeugnis bekomme. Erlaubst du es, Onkel Hubert, dass ich sie Mutti nenne?«
»Ja, mein Kleines. Komm, setz dich zu mir. Wir müssen uns einmal unterhalten.«
»Ist es dir nicht recht, wenn ich hier bin?«, fragte sie sogleich ängstlich. »Soll ich wieder in Sophienlust bleiben?«
»Nein, das sollst du nicht, Kati. Meine Frau ist sehr glücklich darüber, dass du hier bist, und ich bin es auch. Du hast doch jetzt keine Angst mehr vor mir? Du weißt doch sicher, dass ich es sehr bedaure, dass ich nicht mehr für deinen Großvater getan habe?«
»Großvater war immer zufrieden«, erwiderte sie.
»Aber ich bin mit mir nicht zufrieden. Auch jetzt noch nicht.«
»Warum nicht? Du bist doch so lieb zu den Kindern, und alle haben dich gern. Ich habe dich auch gern«, flüsterte sie.
»Ich habe sehr lange gebraucht, bis jemand mich so richtig lieb gewonnen hat«, murmelte er. »Und nun wäre es doppelt schwer für mich, wenn ich das wieder entbehren müsste.«
»Das brauchst du doch nicht. Du weißt doch, wie sie sich alle freuen, wenn du nach Sophienlust kommst.«
Ihre Augen strahlten ihn an. Die reinen Augen eines Kindes, das doch schon so viel Leid durchlebt hatte. Ja, jetzt wusste er, warum Kati ihnen so viel bedeutete. Sie wusste um Kummer und Sorgen und um die Unzulänglichkeit der Menschen.
»Kati, mein Kind, wir wollen dich behalten, aber du hast eine Mutter«, stieß er heiser hervor.
»Ja, ich weiß, irgendwo habe ich eine Mutter. Aber ich kenne sie doch nicht. Sie war nie da. Sie hat mich bei Großvater gelassen. Wenn sie mich lieb gehabt hätte, hätte sie das doch nicht getan.«
»Wenn deine Mutter nun aber kommen würde …«
Er kam nicht weiter. Abwehrend hob Kati die Hände.
»Nein, ich will nicht, dass sie kommt«, rief sie aus. »Ich will nicht zu ihr. Bitte, Onkel Hubert, sag, dass ich nicht zu ihr gehen muss in dieses Land, das so weit weg ist. Wenn ich Mutti nicht mehr sehen könnte …« Tränen rannen über ihr Gesicht, und ein haltloses Schluchzen schüttelte ihren schmalen Körper.
»Nicht weinen, Kati«, versuchte er zu trösten. »Wir werden schon einen Weg finden.« Dann folgte er einem Instinkt, als er vorschlug: »Weißt du, Kati, es wäre am besten, wenn du mit Mutti ein paar Tage verreisen würdest. Du kennst unser Haus in den Bergen noch gar nicht. Da ist es jetzt schon sehr schön.«
»Aber ich muss doch in die Schule gehen«, flüsterte sie unter Tränen.
»Ein so gescheites kleines Mädchen kann ruhig mal ein paar Tage versäumen. Ich werde mit Lehrer Brodmann sprechen.«
»Aber wir sollen doch zu Tante Claudias Hochzeit singen«, murmelte sie.
»Zu Claudias Hochzeit seid ihr lange zurück«, versprach er. »Mutti tut es auch gut, wenn sie ein paar Tage andere Luft atmen kann.«
*
Hanna Ebert hatte einen Entschluss gefasst. Was ihr an Intelligenz mangelte, ersetzte sie durch Raffinesse. Es war ein Fehler gewesen, zu der Villa Wellentin zu gehen. Das sah sie jetzt ein. Auch ihr Äußeres, das wurde ihr plötzlich bewusst, hatte keinen guten Eindruck hervorgerufen. Immer noch sah sie Irene von Wellentins Gesicht vor sich, das von Entsetzen, Furcht und Abscheu gezeichnet war. Sie kniff die Augen zusammen und betrachtete sich in dem Spiegel des bescheidenen Hotelzimmers, in dem sie untergekrochen war.
Gefärbte Haare, ein geschminktes Gesicht, viel zu rote Lippen … In dieser ländlichen Umgebung war dies ungewohnt und erregte Aufsehen. Sie musste sich in die Hanna Ebert zurückverwandeln, die man früher hier gekannt hatte, und die Barfrau aus der Hafenkneipe von Adelaide abstreifen. Und sie musste zuerst dorthin gehen, wo sie Kati vermuten konnte. Nach Sophienlust.
Sie wusch sich das Haar, ließ es trocknen und band es zu einem strengen Knoten. Scharf traten ihre Backenknochen hervor. Scharf zeichneten sich aber nun auch die Falten in ihrem ungeschminkten Gesicht ab. Dreißig Jahre war sie alt und sah aus wie vierzig!
Was hatte sie von dem Leben gehabt, nach dem sie sich so gesehnt hatte? Männer – ja, eine ganze Anzahl, aber keinen, der es ernst gemeint hatte. Whisky – mehr als genug, und auch schlaflose Nächte. »Gut, dass Vater es nicht mehr erlebt hat«, dachte sie. Und das war die einzige ehrliche Regung, zu der sie noch fähig war. Ihr ganzes Leben war eine einzige Lüge gewesen. Eine Selbsttäuschung. Was hatte sie noch zu verlieren?
Währenddessen war der Wagen mit Irene von Wellentin und Kati bereits unterwegs zum Landhaus in den Bergen, und Hubert von Wellentin wartete, dass Hanna Ebert sich bei ihm melden würde. Doch der Tag verging. Hubert von Wellentin wartete umsonst.
*
Es war merkwürdig still in Sophienlust. Viel stiller als sonst. Kein fröhliches Lachen schallte durch den Park. Die Kinder standen oder saßen herum, fremd, verwirrt und verschüchtert.
Es quälte Denise. Sie stand zwischen diesen Kindern und ihrem Sohn, der plötzlich den Erben von Sophienlust herauskehrte.
»Mir gehört das alles hier«, hatte er heute Nachmittag plötzlich geschrien. »Meine Urgroßmama hat es mir vererbt. Merkt euch das.«
Sie hatte ihn hart angepackt. Zu hart vielleicht? Sie überdachte das ernsthafte Gespräch mit ihm noch einmal.
»Deine Urgroßmama hat gewollt, dass hier viele Kinder glücklich werden, Dominik«, hatte sie ihn ermahnt. »Nicht nur du allein. Erinnerst du dich nicht mehr, wie du dich darauf gefreut hast, dass du hier mit anderen Kindern spielen und aufwachsen würdest?«
Er hatte zu ihr das Gleiche gesagt wie am Tag zuvor zu Alexander, Sascha und Andrea. »Robby, Mario und Roli können ja bleiben. Frau Trenk und Edith auch. Ich mag sie, aber ich mag die anderen Kinder nicht. Du hast jetzt keine Zeit mehr für mich.«
Sie hatte nicht gewusst, was sie darauf erwidern sollte. Noch immer überlegte sie, wie sie aus der allem Anschein nach verfahrenen Situation für ihn und auch für sich selbst das Beste machen könnte.
Sie saß an ihrem Schreibtisch, um sich mit den Schicksalen der ihr anvertrauten Kinder zu befassen. Zwölf Aktendeckel lagen vor ihr, die einen dünn, die anderen angefüllt mit Briefen und Dokumenten.
Zuoberst lag die Akte Golo Djaleli. Beruf des Vaters: Diplomat. Die Mutter: in zweiter Ehe verheiratet mit einem Großkaufmann.
Denise sah den Jungen vor sich, das feingeschnittene Gesicht, die großen, traurigen Augen. Nein, so schön konnte Sophienlust gar nicht sein, dass er hier heimisch werden würde. Er war ein Außenseiter – nicht nur wegen seiner dunklen Hautfarbe.
Warum nahm sein Vater ihn eigentlich nicht zu sich?
Ein schwerer Seufzer klang an Denises Ohr, Claudia stand vor ihr. Denise hatte nicht einmal bemerkt, dass sie eingetreten war.
»Ich weiß genau, was dich beschäftigt«, bemerkte Claudia. »Aber eines muss ich dir sagen, Isi. Du kannst das Schicksal dieser Kinder nicht mit deinem eigenen verknüpfen. Du machst nicht nur dich unglücklich, sondern auch ein paar andere Menschen. Auch deinen Sohn. Du bist Nick böse, weil er seine Rechte geltend macht, aber er ist ein Kind. Dein Kind. Instinktiv wehrt er sich dagegen, dich mit fremden Kindern teilen zu müssen. Schau, er liebt Sascha und Andrea – ist das nicht schon sehr viel? Er liebt Alexander. Er wünscht ihn sich als Vater – das ist noch mehr. Kinder können grausam sein, wenn sie ihre Meinung kundtun, aber man muss ihre Motive zu begreifen versuchen.«
»Was soll ich tun?«, fragte Denise deprimiert. »Was soll ich nur tun, um vor mir selbst bestehen zu können?«
»Willst du allem entsagen? Gut, ich gebe dir recht, Sophienlust soll seinen Sinn behalten. Aber Sophie von Wellentin wollte bestimmt nicht, dass du dich opferst. Niemand erwartet das. Überlass deinen Platz einer anderen Frau, die ihre Erfüllung nicht anderswo finden kann, Isi. Ich bin deine beste Freundin. Ich möchte es auch bleiben. Ich beschwöre dich: Denke an Nick, denke an Alexander, an Sascha und Andrea, die sich eine Mutter wünschen. Du kannst nicht zwanzig Kindern Mutter sein.«
Das Läuten des Telefons unterbrach sie. Mechanisch nahm Denise den Hörer ab. Sie lauschte stumm.
»Ja, Papa, ich verstehe euch«, sagte sie. »Wenn sie herkommt, werde ich dich sofort unterrichten.«
»Gott im Himmel, ist das ein Tag«, stöhnte sie, als sie den Hörer auflegte. »Nicht nur ich habe meine Probleme, Claudi, Katis Mutter ist im Lande, und sie wollen das Kind nicht mehr hergeben. Aber sag, kannst du dir eine Mutter vorstellen, die sich ihr Kind abkaufen lassen würde?«
Claudia hob den Kopf und sah sie nachdenklich an. »Wenn es mein Kind wäre, ich wäre zu Fuß gegangen, um zu ihm zu gelangen. Ich hätte es niemals allein gelassen.«
Denise holte aus ihrem Schrank die Akte Kati Ebert. Der Brief, den Hanna Ebert damals geschrieben hatte, war beigeheftet. Sie las ihn noch einmal durch.
»Ich weiß, dass für Kati eine Welt zusammenbrechen wird, wenn man sie von Irene wegnimmt«, sagte Claudia.
»Wir müssen gerecht sein. Ich will gewiss das Beste für Kati, aber wenn ihre Mutter Anspruch auf sie erhebt, können wir doch nichts dagegen tun, Claudia«, meinte Denise.
»Warten wir es ab. Jetzt lass mal die anderen Kinder und kümmere dich um deinen Sohn, damit er nicht wieder weggeht. Das bringt Alexander auch in Konflikte. Er will dir nicht wehtun und Nick auch nicht.«
»Ist er denn schon da?«, fragte Denise hastig.
»Schon eine ganze Weile.«
*
Als Alexander mit Sascha eingetroffen war, hatte Dominik schon bereitgestanden.
»Fahren wir gleich nach Schoeneich?«, hatte er sich bemerkbar gemacht.
»Die Absicht habe ich eigentlich nicht.« Er sah sich um. »Mächtig ruhig ist es hier. Sind die Kinder nicht da?«
»Freilich sind sie da, aber sie hocken alle nur rum«, brummte Dominik.
»Da habt ihr zu fünft ja bedeutend mehr Krach gemacht«, meinte Alexander gelassen. »Es scheinen brave Kinder zu sein.«
»Doofe«, widersprach Nick. »Nur mit dem Toni und der Ursi kann man reden. Der Marco hat zu mir gesagt, dass er mich nicht mag.«
»Das hast du doch auch zu den anderen gesagt. Da brauchst du dich nicht zu wundern, wenn sie ebenso reagieren.«
»Aber mir gehört Sophienlust«, trumpfte Dominik auf. »Das ist doch ein Unterschied.«
»Nun, wenn du unbedingt darauf pochen willst, werden wir wohl eine andere Lösung finden müssen.«
»Was für eine?«, fragte Dominik interessiert.
»Ich überlege, ob ich die Kinder nicht mit nach Schoeneich nehme. Dann bist du hier allein, und Sophienlust gehört dir.«
Dominik sah ihn bestürzt an. »Aber Sascha und Andrea bleiben doch bei mir.«
»Nein, sie kommen natürlich auch mit nach Schoeneich. Sie haben dich sehr gern, Nick, aber sie verstehen nicht, wie du dich benimmst. Du enttäuschst deine besten Freunde, und das ist schlimm.«
»Dich enttäusche ich auch?«, fragte Dominik stockend.
»Wenn du nicht zur Einsicht kommst, schon. Schau, man kann Dinge, die man begonnen hat, nicht einfach beiseitewerfen. Kannst du dich denn nicht mehr erinnern, wie du früher gedacht hast?«
»Ich will mich nicht erinnern. Da war ich auch noch kleiner. Jetzt weiß ich genau, was ich will. Eine kleine Familie. Ich habe es dir schon gesagt.«
»Und diese Kinder dort«, sagte Alexander sinnend, »wünschen sich das Gleiche, aber das Schicksal versagt die Erfüllung dieses Wunsches.«
Dominik überlegte. »Wir können ihnen ja Familien suchen. Es gibt viele Leute, die gern Kinder haben wollen und keine kriegen. Kati fühlt sich ja auch wohl bei Omi, und sie war früher doch gern in Sophienlust.«
Er hatte seine eigene Logik, und Alexander kam zu der Überzeugung, dass man ihm nur beikommen konnte, wenn man ihm das Unsinnige seiner Gedanken deutlich vor Augen führte.
Aber waren seine Gedanken denn so unsinnig? Wünschte er, der Mann, sich nicht im Grunde das Gleiche?
»Ich werde mir die Kinder jetzt mal anschauen und mit ihnen sprechen«, erklärte er fest.
»Willst du nicht erst Mutti begrüßen?«, versuchte Nick ihn abzulenken.
»Sie ist sicher beschäftigt.«
»Sie ist immer beschäftigt«, brummte Nick. »Das ist es ja eben.«
Roli übernahm es, Alexander die Kinder der Reihe nach vorzustellen. Mit den Kleinen fing sie an. Zwölf Namen rauschten an Alexanders Ohr vorbei, zwölf Augenpaare musterten ihn, teils neugierig, teils ärgerlich oder auch trotzig und abweisend.
»Gefällt es euch hier?«, fragte er.
Ein leises Ja von hier und dort ertönte. Die meisten aber sagten nichts.
Plötzlich trat Marco vor. Er mochte etwas älter sein als Dominik und war ein hübscher Junge.
»Uns würde es schon gefallen, wenn Dominik nett wäre«, meinte er. »Madame Merlinde hat zu uns gesagt, dass er sich ganz mächtig auf uns freut, aber das stimmt gar nicht. Na ja, sie wollte uns loswerden, und er will uns gar nicht haben.«
»Er hat ja auch eine Mutti«, mischte sich Toni ein. »Ich habe keine, und ich weiß nicht, wie das ist.«
Als Alexander auf Golo zuging, drehte dieser sich um und entfernte sich rasch.
»Den mag ich am wenigsten«, sagte Dominik, aber doch so leise, dass nur Alexander es hören konnte.
»Das musst du mir aber erklären«, verlangte Alexander. »Man kann einen Menschen nicht einfach ablehnen, man muss auch begründen, warum man das tut.«
»Ich mag ihn eben nicht. Statt froh zu sein, dass er hier sein kann, ist er arrogant!«
»Er hat eben gleich gefühlt, dass du ihn nicht magst, und hat seinen Stolz. Mich würde es auch kränken, wenn mir jemand so deutlich seine Abneigung zeigte.«
Nick betrachtete ihn nachdenklich. »Du bist unzufrieden mit mir, nicht?«
»Ja, das bin ich, Nick.«
»Ich möchte aber nicht, dass du unzufrieden bist.«
»Dann sei wieder vernünftig und nicht mehr so bockig.«
»Und wenn Mami nun so viel zu tun hat, und sie dich nicht heiratet?«, spielte der Junge seine Trumpfkarte aus. »Du hast ja keine Ahnung, um was sie sich alles kümmern muss.«
Doch, das wusste Alexander, und er hegte für seine persönlichen Pläne auch große Bedenken.
*
Um sich besser mit den Verhältnissen, aus denen die Kinder stammten, vertraut zu machen, hatte Denise sie in vier Kategorien eingeteilt.
Da waren drei Vollwaisen, für die der Unterhalt aus vorhandenem Vermögen bezahlt wurde. Fünf Kinder waren Halbwaisen, zwei stammten aus geschiedenen Ehen, wobei beide Elternteile noch lebten – zu ihnen gehörte auch Golo – und zwei – es waren die Geschwister Odette und Oliver – waren für zwei Jahre in das Heim gegeben worden, weil ihre Eltern als Wissenschaftler im Ausland tätig waren und die vierjährigen Zwillinge als Behinderung angesehen hatten.
Eine Behinderung! Es ging Denise durch und durch, als sie darüber nachdachte. Überlegten sich diese Eltern denn gar nicht, welchen Schaden sie in den kindlichen Seelen anrichten konnten?
Aber auch sie war einmal in einer Situation gewesen, in der ihr nichts anderes übrig geblieben war, als Dominik in das Heim zu geben. Sie hatte zwar den Kontakt zu ihrem Sohn nie verloren, aber jetzt musste sie darüber nachdenken, ob nicht vielleicht doch ein Stachel in ihm zurückgeblieben war, der sich nun in seiner unerwarteten Aggressivität äußerte.
Jedenfalls war unter diesen Kinder nicht eines, das sozialer Unterstützung bedurfte. Von allen Kindern, die nun in Sophienlust weilten, war Carola Dahm die Einzige, die völlig mittellos war, wollte man Robby ausschließen, dessen Mutter ja durch Arbeitsleistung für ihn bezahlte.
Ganz so hatte es sich Sophie von Wellentin wohl nicht gedacht, als sie ihre Bestimmungen getroffen hatte. Ein Verlustunternehmen würde Sophienlust nie werden, die vorhandenen Vermögenswerte würden sich eher vermehren.
Justus hatte die Kinder mit dem Bus zur Schule gebracht, aber Golo war nicht zum Mitfahren zu bewegen gewesen. Denise wollte noch einmal mit ihm sprechen. Doch er war nicht in seinem Zimmer.
Siedend heiß fiel ihr ein, was er am ersten Abend angedroht hatte: Zweimal sei er schon weggelaufen, ein drittes Mal wolle er sich umbringen, bevor man ihn zurückhole. Nur eine kindliche Drohung? Mit dreizehn Jahren war ein Junge kein kleines Kind mehr, vor allem nicht einer, der so intelligent war wie er und schon so viel erlebt hatte.
Wie gehetzt lief Denise über den Gutshof, als Edith aus dem Park kam.
»Haben Sie Golo gesehen?«, fragte Denise aufgeregt.
»Vorhin war er bei den Ställen«, antwortete Edith. »Er ist am liebsten allein. Er wird sich am schwersten eingewöhnen.«
Golo war noch immer bei den Ställen. Denise sah ihn bei Wildfang stehen, dem braunen Hengst, und dieses sonst so feurige Tier ließ sich von ihm streicheln. Überrascht sah Denise, wie der Junge seine Wange an die Nüstern des Pferdes drückte. Sie räusperte sich leise, und Golo blickte sie an. In seinen dunklen Augen war ein tiefes Leuchten.
»Er ist schön«, sagte er leise. »Wie heißt er?«
»Wildfang. Aber er ist unberechenbar.«
Golo schüttelte den Kopf. »Er versteht mich. Er weiß, dass ich ihm nichts tue. Dürfte ich ihn einmal reiten?«
»Kannst du denn reiten?«
»Früher konnte ich es. Man verlernt es nicht. Ich könnte meinen Vater bitten, mir ein Pferd zu kaufen. Er würde es sicher tun. Gestatten Sie es?«
»Wir haben doch genügend Pferde, Golo.«
»Aber ich möchte eines, das mir allein gehört«, erwiderte er bestimmt. »Ich habe meinen Vater noch nie um etwas gebeten. Er wird mir diesen Wunsch nicht abschlagen.«
»Wenn ich dir nun eines schenke?«
»Nein, das kann ich nicht annehmen. Außerdem müssten Sie dann jedem Kind ein Pferd schenken. Ich will nicht bevorzugt werden. Es ist hier überhaupt ganz anders als in den anderen Heimen.«
»Ich hoffe, dass du gern bei uns sein wirst«, sagte sie weich.
»Vielleicht.« Er betrachtete sie mit einem unergründlichen Blick. »Warum machen Sie so etwas? Sie sind doch jung – und Sie sind sehr schön.«
Es berührte Denise eigenartig, dies aus dem Munde eines dreizehnjährigen Jungen zu hören.
»Warum willst du nicht zur Schule gehen, Golo?«, fragte sie rasch.
Er lächelte beinahe nachsichtig. »Was sie hier lernen, kann ich doch alles schon. Ich war auf dem Gymnasium.«
Dass sie daran nicht gedacht hatte! Aber es war ein wenig zu viel auf sie eingestürmt während der letzten Tage.
»Du wirst selbstverständlich auch weiter auf das Gymnasium gehen. Sascha von Schoenecker geht doch auch dorthin. Du wirst dich bestimmt gut mit ihm verstehen.«
»Herr von Schoenecker ist ein vornehmer Mann«, stellte er fest. »Denkt er nicht auch, dass ich ein Mischling bin?«
»Solche dummen Worte wollen wir hier gar nicht gebrauchen, Golo.«
»Ich habe es aber schon sehr oft gehört«, erwiderte er gepresst.
Ihr kam ein Gedanke. Sein Vater war begütert und entstammte einer vornehmen Familie. Warum schickte er den Jungen nicht auf ein Internat, in dem er entsprechend erzogen wurde?
Vorsichtig fragte sie Golo danach. Er lächelte nachsichtig. »Mein Vater denkt wohl gar nicht daran, dass ich älter werde. Er ist ja so beschäftigt.«
Denise beschloss, dies Golos Vater einmal in einem ausführlichen Brief klarzumachen. Nicht, dass ihr daran gelegen war, Golo schnell wieder loszuwerden, aber er hatte einen Reifegrad erreicht, der sein Verbleiben in einem Heim unter so kleinen Kindern schon fast unmöglich machte. Bei Roli lagen die Dinge anders. Sie war ein mittelloses Mädchen, und sie war aus Sophienlust fast nicht mehr wegzudenken. Sie wäre unglücklich geworden.
Als Denise jedoch Golo betrachtete, wie er sich an das Pferd lehnte, das schmale feingeschnittene Gesicht von einem Lächeln erhellt, fragte sie sich, ob er nicht eben auch zum ersten Mal das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft kennengelernt habe.
*
Dennoch schrieb Denise an Golos Vater, der sich zur Zeit im Iran aufhielt. Die monatlichen Überweisungen kamen von einer französischen Bank, sein letztes Schreiben lag vier Wochen zurück. Er hatte es wohl einer Sekretärin diktiert und teilte darin mit, dass dringende Geschäfte ihn davon abhielten, sich persönlich um das Wohlergeben seines Sohnes zu kümmern. Außerdem erklärte er sich damit einverstanden, dass Golo nach Sophienlust gebracht werde, sofern dieses Internat seinem Niveau entspräche. Anscheinend war er überzeugt, dass es sich um ein Internat handelte, und Denise fragte sich, welche Motive Madame Merlinde wohl bewogen hatten, ihn in diesem Glauben zu lassen. Sollten es finanzielle Erwägungen gewesen sein? Ihr, Denise, genügte es jedenfalls nicht, dass die Angehörigen regelmäßig ihren Obolus entrichteten. Sie wollte Klarheit haben für die Kinder, für sich und auch für die, die irgendwie für die Kinder mitverantwortlich waren, wenn sie sich auch um solche Verantwortung zu drücken versuchten.
Denise hatte den Brief gerade beendet, als Claudia in ihr Büro stürmte.
»Halt dich fest, Isi. Hanna Ebert ist gekommen!«
Das Problem Kati hatte Denise in den letzten Tagen ganz vergessen. Jetzt erinnerte sie sich daran, dass sie ihrem Schwiegervater versprochen hatte, ihn sofort zu verständigen.
»Sie möchte noch ein paar Minuten warten«, sagte Denise und griff zum Telefon.
Hubert von Wellentin war sofort am Apparat, als Denise anrief. In spätestens zwanzig Minuten würde er in Sophienlust sein, sagte er.
Denise erhob sich. Hanna Ebert wartete im Salon.
Denise bemerkte den lauernden Blick, den verkniffenen Mund – und sie sah Kati vor sich, dieses sensible, ernsthafte Kind. Nur mühsam gelang es ihr, eine freundliche Begrüßung über die Lippen zu bringen.
Hanna Ebert setzte ein scheinheiliges Lächeln auf, als sie sich nach Kati erkundigte.
»Kati ist im Augenblick nicht hier«, erklärte Denise mit erzwungener Ruhe. »Ich habe nicht mit Ihrem Kommen gerechnet, Frau Ebert.«
»Herr von Wellentin schickte mir das Geld für das Flugticket«, betonte Hanna Ebert.
»Wir dachten nicht, dass Sie doch noch davon Gebrauch machen würden. Es ist schon ziemlich lange her.«
»Ich konnte meine Stellung nicht Hals über Kopf aufgeben. Für Sie ist das wahrscheinlich nicht verständlich. Sie kennen solche Sorgen nicht.« Sehr wortreich versuchte sie nun Denise begreiflich zu machen, welcher Leidensweg hinter ihr lag. Verlassen von ihrem Mann, ausgeliefert einer fremden, feindseligen Welt, geknechtet, gedemütigt.
»Ich kann Ihnen nur dankbar sein, dass Sie Kati so freundlich aufgenommen haben«, presste sie danach mit tränenerstickter Stimme hervor.
»Für Kati ist es eine schwierige Situation«, begann sie ruhig. »Sie hat keine Erinnerung mehr an Sie. Sie hing sehr an ihrem Großvater und jetzt … Aber darüber sprechen wir wohl besser mit meinem Schwiegervater, Frau Ebert. Wie ich sehe, ist er eben eingetroffen.«
Ihr Blick war zum Fenster gewandert. Sie sah ihn aussteigen und schnell auf das Haus zukommen.
»Herr von Wellentin zeigt ein erstaunliches Interesse an meiner Tochter«, meinte Hanna Ebert. Der Tonfall machte Denise stutzig. Der gierige Ausdruck in diesem verlebten Gesicht noch mehr. Und sie ahnte, dass ein unerbittlicher Kampf um das Kind beginnen würde, als ihr Schwiegervater eintrat.
In Hubert von Wellentins Augen war jener Ausdruck, den Denise früher gefürchtet hatte. Kälte paarte sich mit unbeugsamer Härte. Wäre Hanna Ebert ehrlicher Muttergefühle fähig gewesen, hätte sie sich tief verletzt fühlen müssen, als er sie so durchdringend und verächtlich musterte.
»Du musst sicher deinen Pflichten nachkommen, Denise«, sagte er ruhig, was ihr bewies, dass er allein mit Hanna Ebert sprechen wollte. Sie war ganz froh, bei dieser Auseinandersetzung nicht zugegen sein zu müssen. Und sie war froh, dass die Kinder noch in der Schule waren, denn als sie in den Park ging, hörte sie die dröhnende Stimme ihres Schwiegervaters durch das geschlossene Fenster.
»Wir brauchen nicht um den heißen Brei herumzureden, Frau Ebert«, sagte Hubert von Wellentin. »Ich habe eine ganze Menge über Sie in Erfahrung gebracht. Ihnen geht es doch nicht um das Kind …«
Hanna Ebert ließ die scheinheilige Maske fallen. »Na und? Können Sie mir sagen, wie ich mich hätte durchbringen sollen. Es ist dort nicht alles so, wie es einem erzählt wird. Sie können leicht reden. Sie waren nie arm. Sie haben die Leute immer ausgenutzt. Denken Sie, ich hab’s vergessen? Für einen Hungerlohn hat mein Vater für Sie gearbeitet. Er konnte es ja zu nichts bringen. Nun sitzen Sie auch noch auf dem hohen Ross und wagen es, mich zu beschimpfen.«
»Ich beschimpfe Sie nicht. Ich mache Ihnen berechtigte Vorhaltungen. Ich gebe sogar zu, dass Ihre Vorhaltungen auch berechtigt sind. Ich habe aber erkannt, dass ich früher vieles falsch gemacht habe, und deshalb räume ich jedem anderen auch gern eine Chance ein. Aber es geht um Kati.«
Sie kniff die Augen zusammen. »Die Ihre Frau bereits Mutti nennt.«
Er zuckte zusammen. Sie war also gestern vor seinem Haus gewesen …
»Sie wollen mir das Kind abhandeln«, fuhr Hanna Ebert fort, »aber das wird Sie allerhand kosten, Herr von Wellentin. Sie werden nicht nur für Kati bezahlen, sondern für meinen Vater und mich mit.«
Nun war die Linie wenigstens geklärt. Aber zu früh wiegte er sich in Sicherheit. Hanna Ebert war raffinierter, als er angenommen hatte.
»Wenn ich nun aber nicht auf Kati verzichten will?«, fragte sie lauernd.
Eiskalt rann es ihm den Rücken herunter. Er musste wachsam sein. Er durfte sie nicht unterschätzen. Doch gleichzeitig fragte er sich, ob das Kind einer solchen Mutter später wirklich Irenes Hoffnungen entsprechen würde.
»Kati ist sechs Jahre alt«, sagte er, sich zur Ruhe zwingend. »Sie war knapp zwei, als Sie fortgingen. Sie überließen das Kind einem alten Mann und kümmerten sich nicht darum, ob er es ernähren konnte oder nicht.«
»Hat Sie das gekümmert?«, fragte sie höhnisch. »Ich glaube kaum. Sie saßen in Ihrer Fabrik und kommandierten. Sie haben sich überhaupt nicht darum gekümmert, wie es Ihren Arbeitern ging. Hauptsache, Sie hatten Ihr Geld. Und wie war es denn mit Ihrem Sohn?«
»Schweigen Sie«, herrschte er sie an. »Das hat mit unserer Angelegenheit gar nichts zu tun.«
»Nein, damit hat es nichts zu tun, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn Sie mal wieder daran erinnert werden, Herr Generaldirektor von Wellentin. Jetzt bin nämlich ich mal im Vorteil. Kati ist meine Tochter. Und wenn Sie sie haben wollen, müssen Sie sich auch einiges gefallen lassen.«
Kalter Zorn erfasste ihn. Eine Mutter, die ihr Kind verschachern wollte, verdiente keine Nachsicht. Und zu solchen Überlegungen, dass Kati ihr ähnlich werden könnte, durfte er sich schon gar nicht hinreißen lassen. Ein Kind formte sich in seiner Umgebung. Er hatte es doch immer wieder in Sophienlust beobachten können.
Erst jetzt wurde ihm wirklich bewusst, welch eine große Aufgabe seine Mutter anderen hinterlassen hatte. Hanna Eberts Feilschen um das Kind machte es ihm ganz klar.
»Wenn ich die Behörden einschalte, wird man Ihnen das Sorgerecht für Kati ohnehin absprechen«, erklärte er. »Wenn wir uns jedoch einigen, bleibt dem Kind erspart zu erfahren, was Sie bezwecken. Ich werde Ihnen eine Stellung besorgen – natürlich nicht hier in der Nähe – und ich bin auch bereit, Ihnen eine Starthilfe zu geben. Erpressen lasse ich mich jedoch nicht. Sie können es sich überlegen. Selbstverständlich möchte ich unsere Abmachungen schriftlich niedergelegt wissen.«
Sie musterte ihn hintergründig. »Ich werde es mir überlegen«, entgegnete sie, »aber vielleicht fällt es mir leichter, eine Entscheidung zu treffen, wenn Sie mir einen Vorschuss geben? Ich bin nämlich völlig abgebrannt.«
Er nahm ein paar Geldscheine aus seiner Brieftasche, die sie gierig an sich riss. Sinnend blickte er in ihr Gesicht.
»Sehen Sie«, sagte er, »ich wollte etwas Gutes tun. Ich glaubte, es würde Sie und Kati glücklich machen, wenn ich Sie zusammenführe, und nun ist alles ganz anders gekommen. Ich habe mir selbst ein Bein gestellt. Aber vielleicht denken Sie auch darüber einmal nach – um des Kindes willen, Frau Ebert.«
»Der Tyrann Hubert von Wellentin als Mensch und Kinderfreund«, antwortete sie mit einem schrillen Lachen. »Man sollte es nicht für möglich halten …«
»Es ist alles möglich, wenn man guten Willens ist. Sie sehen es an meinem Beispiel«, gab er ruhig zurück.
Sie warf ihm einen schrägen Blick zu. »Sie wollen verhindern, dass ich Kati sehe, dass sie erfährt, wer ihre Mutter ist?«
»Ich weiß nicht, ob es sich verhindern lässt. Das liegt wohl zum großen Teil bei Ihnen. Aber ich werde alles tun, dass dieses Kind eine glückliche Jugend erlebt. Und wenn Sie auch nur einen Funken Anstand besitzen, werden Sie das nicht verhindern.«
Er sah zum Fenster hinaus. »Justus fährt ins Dorf. Sie können mit ihm fahren, Frau Ebert. Sie wissen, wo Sie mich erreichen können. Vielleicht haben Sie auch den Wunsch, das Grab Ihres Vaters zu besuchen? Kati ist zur Zeit mit meiner Frau verreist«, fügte er hinzu. »Sie werden ihr nicht begegnen.«
*
Als Denise zu ihrem Schwiegervater ins Zimmer trat, stand er am Fenster.
»Kann ich heute hierbleiben, Denise?«, fragte er. »Ich möchte nicht allein sein.«
»Bei uns geht es jetzt hoch her, Papa«, warnte sie. »Wenn es dir nichts ausmacht?«
Er drehte sich um und legte seine Hände auf ihre Schultern. »Es gibt nichts Schöneres als glückliche Kinder, Denise. Warum habe ich das so spät begriffen? Warum wusste ich es noch nicht, als Dietmar noch lebte? Glaubst du, dass ich vor Gott bestehen kann, wenn ich mich bemühe, für den Rest meines Lebens nach diesem Grundsatz zu leben?«
»Du tust es doch schon. Konntest du dich mit ihr einigen?«
»Noch nicht. Aber Kati wird bei uns bleiben, da mag kommen, was will.«
»Sie wird es euch danken, Papa.«
»Und du, bist du davon überzeugt, dass Nick deshalb nicht benachteiligt wird?«
»Oh, Papa, er hat genug. Er soll mir nicht zu übermütig werden.«
Sie schwieg einen Moment, fuhr dann fort: »Ach, bei der Gelegenheit hätte ich noch eine Frage. Frau Brachmann erzählte mir von einem Wolfgang Rennert. Er soll ein sehr begabter junger Mann sein, aber du hattest wohl früher einmal mit ihm Schwierigkeiten?«
»Was ist mit ihm?«
»Ich dachte, dass wir ihm eine Chance einräumen und ihn als Hauslehrer herholen könnten. Aber ich wollte dich nicht übergehen.«
»Du weißt, dass er einmal Geld unterschlagen hat?«
Sie nickte. »Du hattest Anzeige gegen ihn erstattet.«
»Es war in meiner schlimmen Zeit, Denise«, meinte er gedankenvoll. »Heute würde ich das wohl auch anders sehen. Aber für ihn hat der Name von Wellentin natürlich einen bitteren Beigeschmack. Er findet sich wohl jetzt nicht mehr zurecht. Tu nur, was du für richtig hältst. Durch dich ist schon so viel gut geworden, mein Kind.«
»Es wäre alles nicht, wenn nicht unsere Urgroßmutter gewesen wäre«, sagte sie leise. »Ich wollte zum Friedhof gehen. Kommst du mit?«
*
Im Hinblick auf Claudias Hochzeit konnte Irene von Wellentin ihren Aufenthalt in den Bergen nicht mehr länger ausdehnen. Zu schmerzlich wäre es für Kati gewesen, wenn sie sich dem Reigen der Kinder nicht hätte anschließen dürfen, die Claudia und Lutz zur Kirche begleiten sollten. Und ihre besonders hübsche Stimme hätte auch im Chor gefehlt. Doch Irene von Wellentin hatte Angst vor diesem Tag, Angst, dass Hanna Ebert kommen und alle Freude zerstören könnte.
»Für mich bist du meine Mutti«, sagte Kati immer wieder, als wollte sie es sich Tag für Tag bestätigen.
Mit ihren fünfzig Jahren fühlte sich Irene von Wellentin noch immer jung genug, diesem Kind auch eine wirkliche Mutter zu sein. Weit wies sie den Gedanken von sich, dass eine andere ihre Rechte geltend machen könnte, und fürchtete es doch gleichzeitig so sehr, dass ihr ganz elend wurde.
Nun waren sie wieder heimgekehrt, aber nicht einen Schritt durfte Kati ohne Aufsicht gehen.
Hanna Ebert hatte sich seit dem ersten Gespräch nicht mehr bei Hubert von Wellentin gemeldet. Er ließ sie auf Schritt und Tritt beobachten. Das Geld, das er ihr gegeben hatte, brachte sie in obskuren Lokalen durch. Sie hatte sich neu eingekleidet und ließ es sich im Hinblick auf die Quelle, die sie so rasch nicht versiegen lassen wollte, gut gehen. Sie konnte warten. Sie wusste, dass jeder Tag, den sie die Wellentins warten ließ, von Vorteil für sie war.
Man tuschelte bereits im Dorf. »Die Hanna Ebert ist wieder da. Jetzt wird sie den Wellentins die Kati wieder wegnehmen. Das arme Kind!«
Nein, Sympathien hatte Hanna Ebert hier nicht. Diese einfachen Menschen verziehen ihr nicht, dass sie eine so schlechte Mutter gewesen war. Es hatte zwar lange gedauert, bis man Hubert von Wellentin verziehen hatte, dass er sich anfangs so gegen seine Schwiegertochter gestellt hatte. Das hatte man jedoch nun vergessen. Alle standen auf seiner Seite, alle bildeten eine geschlossene Front gegen Hanna Ebert.
Und zwischen den Fronten stand Kati, abgeschirmt, bewacht und nicht ahnend, welche düsteren Schicksalswolken sich über ihrem kleinen Leben zusammengeballt hatten.
Auf Sophienlust war alles für Claudias Hochzeit vorbereitet. Zwischen Dominik und den Kindern herrschte eine Art Waffenstillstand. Denises Ermahnungen hatten gefruchtet. Kein Schatten sollte auf Claudias schönsten Tag fallen. Aus diesem Grunde hatten sie auch Kati in Sophienlust gelassen, und weil Irene von Wellentin in ihrer ständigen Sorge um das Kind nicht von ihrer Seite weichen wollte, war sie ebenfalls dageblieben.
»Mach dir doch nicht so viele Sorgen, Mama«, tröstete Denise. »Es wird schon alles gut werden. Horch, die Kinder singen! Freu dich, Mama. Morgen ist ein Freudentag!«
Claudia war nicht weniger aufgeregt als alle anderen Bräute, wenn sie es auch zu verbergen suchte. Morgen wurde sie Lutz Brachmanns Frau. Morgen schlug für sie die Abschiedsstunde von Sophienlust.
Man konnte kaum noch einen Schritt im Gutshaus machen, ohne an Blumen und Geschenke zu stoßen. Das ganze Dorf war auf den Beinen, um dem jungen Paar an seinem Polterabend Ovationen darzubringen.
Die Feuerwehrkapelle spielte, der Gesangverein schmetterte seine Lieder, und die Kinder zerschlugen mit wahrer Begeisterung alles alte Geschirr auf den Fliesen vor dem Eingang.
Claudia und Lutz kamen recht ins Schwitzen, als sie die Scherben zusammenkehren mussten, aber beide zeigten eine strahlende Miene. Dann schlug es Mitternacht, und Claudia kamen die Tränen.
Abschied von Sophienlust! Kein Abschied für immer, aber doch ein entscheidender Augenblick. Die beiden Freundinnen lagen sich in den Armen. Auch Denise konnte die Tränen nicht zurückhalten.
»Es war eine schöne Zeit«, sagte sie innig. »Ich wünsche dir alles, alles Glück, Claudia. Und Dank dafür, dass du mich nie im Stich gelassen hast.«
»Jetzt lasse ich dich im Stich«, schluchzte Claudia, und die Tränen flossen noch reichlicher.
»Du kannst es dir ja noch überlegen«, mischte sich Lutz ein. »Noch ist Zeit.«
Denise legte seine und Claudias Hand ineinander. »Sie gehört jetzt zu dir. Es macht mich glücklich, dass sie dich bekommen hat, Lutz.«
Er umarmte sie. »Und dir danke ich, dass du sie hergebracht hast.«
Behutsam trocknete er die Tränen auf den Wangen seiner Braut, die morgen nun seine Frau werden würde.
»Der Weg nach Sophienlust ist ja nicht weit, Liebling«, sagte er zärtlich.
»Gott sei Dank«, seufzte Claudia.
*
Dann brach der Hochzeitsmorgen an. Glitzernd lag der Tau auf dem grünenden Rasen. Wie schimmernde Diamanten glänzten die Tropfen in der Morgensonne. Das Brautkleid, zart und duftig, lag bereit.
Feierlich trug Denise den wundervollen Spitzenschleier, den sie für Claudia gekauft hatte, auf einem silbernen Tablett herein. Die Rührung lähmte ihr die Stimme.
Vor dem Fenster sangen die Kinder. »An diesem schönen Tag in deinem Leben bringen wir dir ein Ständchen dar. Der Himmel soll dir Glück und Freude geben und eine große Kinderschar.«
»Roli hat es gedichtet«, erklärte Denise mit erstickter Stimme.
»Sie kann nicht nur malen, sie kann auch dichten«, sagte Claudia gerührt. »Wie lieb sie alle sind.«
Mit bebenden Händen befestigte Denise den Schleier in dem duftigen Haar, das Claudias glücklich leuchtendes Gesicht in weichem Schwung umgab.
»Wie schön du bist, Liebstes«, sagte Lutz andächtig, als er ihr das Brautbukett in den Arm legte.
Nur eine einzige Wolke stand am Himmel, als sie aus der Kirche traten. Aber aus ihr fielen große Tropfen auf das Brautpaar – nur für Sekunden und wohl nur, um dem Volksglauben Genüge zu tun, dass es der Braut in den Schleier regnen müsse, damit die Ehe glücklich würde.
Mit hellen Stimmen sangen die Kinder. »Ich bin dein und du bist mein«, als das frischgetraute Paar seine ersten Schritte in das gemeinsame Leben tat, und Alexander von Schoenecker umschloss Denises Hand mit festem Griff. Er beugte sich zu ihr herab und flüsterte in ihr Ohr: »Ich bin dein und du bist mein, dessen sollst du gewiss sein!«
»Solch einen Beginn werden wir nicht haben«, dachte Denise versonnen. »Wir werden mit drei Kindern beginnen, von denen zwei eine andere Mutter und eines einen anderen Vater haben. Aber unsere Liebe wird nicht kleiner dadurch, eher größer.«
*
Nun waren Claudia und Lutz schon auf der Hochzeitsreise. Still war es in Sophienlust geworden. Erschöpft von dem Trubel saß Denise an Dominiks Bett. Nachdenklich blickte er sie an.
»Warum fahren sie weg, wo sie doch ein so schönes Haus haben?«, fragte er.
»Damit sie ein paar Wochen ganz für sich allein haben.«
»Tut ihr das auch, wenn ihr heiratet – du und Onkel Alexander?«
»Vielleicht«, erwiderte sie.
»Und wo bleiben wir dann?«
»Zerbrich dir doch nicht über Dinge den Kopf, die noch in weiter Ferne liegen«, meinte sie.
»In wie weiter Ferne?«, bohrte er enttäuscht. »Du hast doch das Brautbukett aufgefangen. Edith sagt, nun bist du die nächste Braut.«
»Das ist doch Aberglaube.«
»Ich glaube es aber gern«, beharrte er.
»Bei uns wird es außerdem ganz anders sein.«
»Warum?«
»Weil wir drei Kinder haben.«
Er lächelte nachsichtig. »Ich finde das schön. Sascha und Andrea auch. Wir verstehen uns prima. Ich begreife nur nicht, dass wir nicht zusammen wohnen.«
»Es ist nicht so einfach, wie du es dir vorstellst, Nick«, erklärte sie. »Du bist doch schon ein vernünftiger Junge.«
»Wenn du das sagst«, fiel er ihr ins Wort, »dann fängst du immer mit Urgroßmama an. Was wir ihr zu verdanken haben und so. Ich möchte zu gern wissen, wie sie es haben wollte.«
»Sie ist tot«, flüsterte Denise.
»Das ist es ja eben«, seufzte er, doch dann wechselte er das Thema. »Ich habe mich mit Golo versöhnt«, berichtete er. »Wildfang und Senta mögen ihn. Warum kommt sein Vater nicht mal her?«
»Er hat keine Zeit.«
»Ich verstehe die Eltern nicht, die keine Zeit für ihre Kinder haben.«
Denises Gesicht überschattete sich. Er hatte vergessen, dass es bei ihr auch einmal so gewesen war. Kinder vergaßen schnell. Es war gut so.
»Ich finde es zu komisch, dass Kati zu Omi Mutti sagt«, fuhr Dominik sinnend fort.
»Das ist gar nicht komisch, Nick. Das ist schön. Omi hat Kati sehr lieb.«
Langsam wurde er nun doch müde. »Aber zuerst dachten wir doch, dass Omi und Opa Kinder gar nicht mögen«, murmelte er schlaftrunken. »Wenn nun Katis Mutter kommt, was wird dann?«
Wie kam er plötzlich auf Katis Mutter?
»Magda hat sie gesehen«, fuhr er geheimnisvoll fort. »Sie hat mit Justus darüber geredet.«
»Du hast es doch Kati nicht etwa gesagt?«, fragte Denise bestürzt.
»Ich bin doch nicht blöd. Was meinst du, wie sie weinen würde, wenn sie nach Australien müsste. Das lässt Omi doch nicht zu?«
»Schlaf jetzt, Nick«, flüsterte Denise.
»Du musst mir erst antworten, Mutti. Ich möchte ja keine andere Mutti haben als dich, aber bei Kati ist das anders.«
»Ja, da ist es anders«, erwiderte sie gedankenvoll und war froh, dass ihm endlich die Augen zufielen.
*
Kati suchte ihr Kätzchen, das wieder einmal im Garten herumstreifte.
Plötzlich rief eine fremde Stimme, die vom Gartenzaun herkam, den Namen des kleinen Mädchens.
Kati blickte auf und sah in das Gesicht der fremden Frau. Obgleich es nicht geschminkt war wie damals, erkannte sie es sofort. Ihr war, als griffe eine eisige Hand nach ihrem kleinen Herzen. Die Stimme sollte wohl freundlich klingen, aber in Katis Ohren hatte sie einen drohenden Klang. Die fremde Frau, die sie nicht mochte, kannte ihren Namen!
»Kati, ich bin deine Mutter«, sagte die Stimme jetzt.
»Nein«, rief Kati entsetzt. Und dann schrie sie gellend durch den Garten. »Mutti, Mutti!«
Irene von Wellentin kam herausgeeilt. Sie sah das schreckensbleiche Gesicht des Kindes, das zornige der Frau.
»Gehen Sie«, rief sie flehend, »so gehen Sie doch zu meinem Mann. Lassen Sie uns in Ruhe.«
»So leicht mache ich es Ihnen nicht, Frau von Wellentin«, schrie Hanna Ebert hinter ihr her, als Irene Kati ins Haus zog. »So einfach geht das nicht. Es ist mein Kind!«
Kati zitterte, und auch Irene von Wellentin bebte.
»Sie war schon mal hier«, flüsterte Kati angsterfüllt. »Oh, Mutti, sie wird mich wegholen. Aber ich will nicht. Sie ist nicht meine Mutter. Das sagt sie nur. So kann meine Mutter nicht sein.«
»Sie wird dich nicht wegholen«, versprach Irene von Wellentin bebend. »Wir werden weit weg gehen, wo sie uns nicht finden kann.«
»Ohne Papa?«, fragte Kati angstvoll. »Wir können ihn doch nicht allein lassen.«
Irene von Wellentin wurde ruhiger. Sollte ihr ganzes Leben eine Flucht sein vor dieser Frau, immer gepeinigt von der Angst, dass sie wiederkommen könnte? Nein, es musste Klarheit geschaffen werden. Hanna Ebert wollte Geld. Also sollte sie Geld haben.
Es läutete anhaltend. Kati klammerte sich an Irene. »Mach nicht auf. Sag Lisa, sie soll nicht öffnen, bitte, bitte, Mutti.«
Aber Lisa war schon zur Tür gegangen.
»Geh auf dein Zimmer, Kati«, stieß Irene von Wellentin hervor, ihren ganzen Mut zusammennehmend. »Ich stelle das Telefon nach oben durch. Ruf Papa an. Er soll rasch kommen. Sag ihm, dass es ganz dringend ist. Und dann schließe dich in dein Zimmer ein.«
Kati gehorchte, während draußen die fremde, harte Stimme sagte: »Ich will Frau von Wellentin sprechen.«
Dann standen sie sich gegenüber. Die Frau, die Katis Mutter war, und die, die es sein wollte.
»Wir werden vernünftig miteinander reden, Frau Ebert«, erklärte Irene von Wellentin würdevoll. Es gelang ihr sogar, ihrer Stimme einen festen Klang zu geben.
Hanna Ebert lächelte boshaft. Der Frau von Wellentin lag noch viel mehr an dem Kind als ihrem Mann, das hatte sie schnell erfasst. Aus ihr war sicher noch mehr herauszuholen.
»Vielleicht können wir uns einigen«, meinte sie gleichmütig. »Es kommt ganz darauf an, was Sie mir bieten werden.«
Irene von Wellentin dachte nicht nüchtern wie ihr Mann. Sie dachte nicht daran, dass Hanna Eberts Forderungen ins Uferlose gehen könnten. Sie dachte nur an Kati.
»Sie können doch wohl kaum erwarten, dass eine Mutter so einfach auf ihr Kind verzichtet«, fuhr Hanna Ebert fort.
»Sie haben viele Jahre nicht danach gefragt«, erwiderte Irene. »Außerdem haben Sie keine Existenz und können dem Kind keine Sicherheit bieten. Kati hat hier bei uns alles, was sie braucht, und was sie lange vermissen musste. Was wollen Sie dafür, dass es so bleiben kann?«
Hanna Ebert überlegte angestrengt. Wie hoch konnte sie mit ihren Forderungen gehen? Sie blickte sich um. Kostbare Gemälde, wertvolle Teppiche, allein das Haus stellte ein immenses Vermögen dar. Und dann waren da die Fabrik und das Gut, Ländereien und was sonst noch alles.
»Eine Million«, sagte sie dreist.
Irene von Wellentin hielt den Atem an. »Sie überschätzen unsere Verhältnisse. Unser Kapital steckt zum größten Teil in der Fabrik. Ich biete Ihnen einen monatlichen Unterhalt von …«
Sie kam nicht weiter, denn im gleichen Augenblick trat der Hausherr ein.
»Halt dich aus Geldangelegenheit heraus, Irene«, riet er freundlich. »Das ist meine Sache. Und sie wird vor einem Notar geregelt. Ich habe Ihnen bereits einmal ein Angebot gemacht, Frau Ebert, und seitdem auf Ihren Besuch gewartet. Die Vorbereitungen sind getroffen. Sie bekommen für Ihren Verzicht auf Kati eine einmalige Abfindung von zwanzigtausend Euro. Wenn Sie sich bereit erklären, Deutschland wieder zu verlassen, zahle ich Ihnen das Doppelte. Das ist mein Angebot.«
Hanna Ebert kniff die Augen zusammen. »Sie wollen das Kind doch wohl adoptieren. Was bekomme ich dafür?«, fragte sie lauernd.
»Wir können uns in Gegenwart meines Anwaltes darüber unterhalten«, erklärte Hubert von Wellentin ruhig. »Sie sind doch wohl nicht daran interessiert, dass Kati erfährt, wofür Sie sie missbrauchen wollen?«
»Kehren Sie doch nicht den Spieß um«, höhnte Hanna Ebert. »Sie setzen mich doch unter Druck.«
»Das hätten wir nicht getan, wenn Sie dem Kind eine richtige Mutter wären«, stellte Hubert von Wellentin ruhig fest. »Ich habe meinen guten Willen bewiesen, für Sie das Beste zu tun, aber jetzt ist es unsere Pflicht, Kati vor einem solchen Leben zu bewahren, wie Sie es führen. Würden Sie jetzt mit mir kommen, Frau Ebert?«
»Sie haben das Kind gegen mich aufgehetzt«, machte sie noch den Versuch einer Rechtfertigung.
»Nein«, warf Irene von Wellentin ein, »Kati hat Sie abgelehnt, noch bevor sie wusste, dass Sie ihre Mutter sind. Sie fühlte sich nicht einen Augenblick zu Ihnen hingezogen.«
»Ein Kind ist bestechlich. Kati wird hier ein herrliches Leben geboten. Ist es da verwunderlich, dass sie sich gegen mich entscheidet?«
»Sie tut es instinktiv. Sie sind bestechlich aus Berechnung. Das wollen wir doch einmal festhalten«, erklärte Hubert von Wellentin heiser. »Ziehen wir doch endlich einen Schlussstrich.«
»Ich will mich erst mit einem Anwalt beraten«, verlangte Hanna Ebert.
»Wie wäre es mit dem Vormundschaftsgericht?«, fragte Hubert von Wellentin. »Ich habe es vorsichtshalber eingeschaltet.«
Seine Frau sah ihn entsetzt an, aber er nickte ihr beruhigend zu.
Voller Sorge verbrachte Irene von Wellentin die nächsten Stunden, nicht von Katis Seite weichend, die ihr immer wieder versicherte, dass nur sie ihre Mutti sei und dass sie keine andere haben wolle.
Dann kam endlich der erlösende Augenblick, als Hubert von Wellentin heimkam. Es wurde ein feierlicher Augenblick, denn er brachte Kati eine goldene Kette mit einem Medaillon mit.
»Zur Erinnerung an diesen Tag, an dem du nun unser Kind geworden bist, Kati«, sagte er bewegt und übergab ihr das Geschenk.
»Ist es ganz sicher?«, fragte sie ungläubig.
»Es bedarf nur noch der amtlichen Bestätigung«, nickte er.
Lachend und weinend zugleich fiel sie ihnen um den Hals, und dankbar blickte Irene von Wellentin zu ihrem Mann auf.
»Ich danke dir, Hubert, ich danke dir tausendmal.«
*
»Fünfzigtausend Euro hat Papa sich das kosten lassen«, sagte Denise staunend zu Alexander von Schoenecker. »Mein Gott, das hätte ich ihm nicht zugetraut.«
»Ich auch nicht. Aber ein Kind ist eben mehr wert als alles Geld.«
Sie dachten beide nicht an Hanna Ebert, die das Geld genommen und auf ihr Kind verzichtet hatte. Sie dachten an Irene von Wellentin, die sich nicht mehr zu ängstigen brauchte.
»Kommt ihr gut zurecht?«, erkundigte sich Alexander, besorgt in Denises abgespanntes Gesicht blickend. »Übernimmst du dich auch nicht?«
»Es kommt jetzt alles wieder ins Lot«, lächelte sie beruhigend. »Eine Hochzeit bringt doch allerlei Aufregungen mit sich. Natürlich fehlt mir Claudi, aber Frau Trenk und Edith sind sehr umsichtig.«
»Sind eigentlich alles zahlende Gäste?«, wollte er wissen.
»Bis auf Roli und Mario. Ich habe seinen Großeltern geschrieben, dass sie kein Geld mehr schicken sollen. Sie müssen es sich ja vom Munde absparen. Zwei alte Leute, die von einer kleinen Pension leben müssen.«
»Was soll eigentlich aus Mario einmal werden? Willst du ihn zur Adoption freigeben?«
»Gott bewahre. Er bleibt in Sophienlust. Frau Trenk wird schon für ihn sorgen. Denkst du, dass ich dir noch mehr Kinder aufhalse, Alexander?«
»Ach, weißt du, ich glaube, ich würde alles in Kauf nehmen, wenn ich dich nur erst bei mir hätte«, erwiderte er. »Aber wir sollten doch einmal überlegen, wie wir nun das Beste aus unserer Situation machen. Was dir fehlt, ist eine Respektsperson.«
»Keine Respektsperson, Alexander. Jemand, der Kinder liebt und an ihr Wohl denkt.«
»Dabei aber auch die Zügel fest in der Hand hält. Frau Trenk ist zu nachgiebig, genau wie du. Du darfst nicht vergessen, dass die Kinder heranwachsen und dass sie eines Tages Sophienlust wieder verlassen, um hinauszugehen in ein Leben, das manchmal sehr hart ist. Das bleibt keinem erspart, Denise. Auch nicht, wenn die finanziellen Voraussetzungen vorhanden sind. Schau, wir brauchen nur an unsere Kinder zu denken. Sie haben auch schon manches erlebt.«
»Eine glückliche, unbeschwerte Kindheit entschädigt für vieles, Liebster. Und die sollen sie hier haben. Es wäre natürlich schön, wenn unsere Waisenkinder auch ein so glückliches Zuhause fänden wie Kati.«
Es klopfte. »Ach, da kommt Edith mit der Abrechnung. Es dauert nicht lange, Liebling. Sie will nur ihren Bericht fertigmachen.«
»Es stimmt alles, Frau von Wellentin«, sagte Edith, »nur die Überweisung von den Boltons ist noch nicht eingetroffen.«
»Sie werden wohl im hintersten Indien sein«, antwortete Denise gleichmütig. Die Boltons waren die Eltern der Zwillinge Odette und Oliver.
»Und dann wollte ich noch sagen, dass Ursi leichtes Fieber hat.«
»Ich werde nach ihr sehen«, versicherte Denise.
»Dann kann ja Dr. Wolfram gleich seinen Einstand geben«, lächelte Alexander. »Ich habe ihn vorhin getroffen. Dafür, dass er erst zwei Tage hier ist, hat er schon ganz schön zu tun.«
Sie wunderten sich ein bisschen, wie schnell Edith verschwand, aber Alexander fiel noch etwas ein.
»Übrigens sollen wir Werner und Babs mal besuchen. Dein Patenkind wächst heran. Ein goldiges Kerlchen ist sie inzwischen. Aber das ist ja kein Wunder, wenn man eine so schöne Namensschwester hat.«
Er gab ihr rasch einen Kuss, den sie zärtlich erwiderte.
»Du hast viel Geduld mit mir, Liebster«, murmelte sie. »Wann besuchen wir Babs und Werner?«
»Gleich am Wochenende. Aber dann bringe ich vorher Frieder und Axel her, und unsere Kinder lassen wir auch zu Hause, damit wir unsere Ruhe haben. Einmal in der Woche können wir uns das wohl gestatten.«
*
Ursi war inzwischen ziemlich fiebrig. Edith hatte sie schon in das Krankenzimmer gelegt.
»Hoffentlich ist es nicht was Ansteckendes«, meinte sie besorgt. »Petra ist auch ganz verschnupft.«
»Dann rufen wir gleich mal Dr. Wolfram an.«
»Soll nicht lieber Dr. Baumgarten kommen?«, fragte Edith.
Denise sah sie verwundert an. »Haben Sie etwas gegen Dr. Wolfram? Wir haben mit Dr. Baumgarten verabredet, dass Dr. Wolfram die Betreuung der Kinder übernimmt.«
Dr. Wolfram kam bald darauf. Ursi weinte. Sie wollte nicht krank sein. Morgen wollten sie mit Schwester Gretli einen Ausflug machen. Darauf hatte sie sich schon so gefreut. Aber mit dem Ausflug würde es nichts werden. Eine Mittelohrentzündung schien sich zu entwickeln.
»Schauen Sie lieber auch gleich nach Petra«, bat Denise Dr. Wolfram. »Bei einem Baby kann man nicht vorsichtig genug sein.«
Petra hatte ganz rote Äuglein, und ihr Näschen lief ununterbrochen. Dennoch lachte sie und patschte Dr. Wolfram mit ihren kleinen Händen ins Gesicht.
»Sie hat wenigstens keine Angst vor dem Onkel Doktor«, stellte Denise fest.
Ediths Benehmen war auffallend komisch. Zwar war sie Fremden gegenüber immer scheu, aber so abweisend hätte sie zu Dr. Wolfram nicht zu sein brauchen, fand Denise.
Petra machte Hatschi und fasste es scheinbar als Spaß auf, als Dr. Wolfram ihr Tropfen ins Näschen träufelte. Sie lachte und strampelte, aber als er ging, begann sie zu weinen.
»Sie haben eine Eroberung gemacht«, meinte Denise lächelnd.
»Von einer so hübschen jungen Dame lasse ich mir das gern gefallen«, erwiderte er. Er nickte Edith zu. »Ich schaue morgen noch mal herein.«
Sie wurde rot und blass, und insgeheim schüttelte Denise den Kopf, während Dr. Wolfram davon keine Notiz nahm.
»Haben Sie sich schon häuslich eingerichtet?«, erkundigte sie sich.
»In der Praxis ja«, nickte er, »im Haus merkt man halt, dass die Frau fehlt. Aber bald kommt Frau Nickel regelmäßig, dann wird es gemütlicher.«
Wie mochte wohl einem Mann zumute sein, wenn die Frau, die er liebte, einen anderen heiratete? Nun, er sah nicht aus, als würde er leiden. Er hatte seinen Beruf, der ihn ausfüllte, und über Mangel an Arbeit konnte er sich auch nicht beklagen.
»Wir werden uns ja jetzt öfter sehen«, verabschiedete Denise sich lächelnd. »Sie sind auch willkommen, wenn wir keine Kranken haben, Dr. Wolfram. Und wenn Sie etwas brauchen, wissen Sie ja, an wen Sie sich wenden können.«
*
Dr. Wolfram kam während der nächsten vierzehn Tage täglich. Ursi war recht krank, und auch Petras Erkältung hatte sich verschlimmert. Dann verstauchte sich Toni das Bein, und als alle wieder einigermaßen gesund waren, legte sich Edith mit einer fieberhaften Grippe ins Bett. Sie wollte zwar keinen Arzt, aber Denise bestand energisch darauf, denn es hatte sie tüchtig erwischt. Doch um nichts in der Welt wollte sie sich gründlich von Dr. Wolfram untersuchen lassen.
»Haben Sie etwas gegen mich?«, fragte er behutsam. »Soll lieber Dr. Baumgarten kommen, wenn Sie kein Vertrauen zu mir haben?«
»Ich brauche keinen Arzt«, antwortete sie bockig.
»Doch, Sie brauchen einen«, widersprach er ernst.
»Dann geben Sie mir etwas zum Einnehmen.«
»Damit ist es nicht getan. Wenn Sie es mir auch nicht glauben wollen, aber der Körper und die Seele eines Menschen sind ein Ganzes. Man muss die Ursache der Krankheit erforschen. Bei Ihnen ist es nicht nur eine Grippe. Sie tragen Ballast mit sich herum, den Sie abwerfen müssen. Soll ich Ihnen etwas sagen, Edith? Sie sind nicht damit fertig geworden, dass ein Mann Sie einmal enttäuscht hat. Nun kapseln Sie sich ein. Aber das ist nicht gut. Sie sind jung. Das Leben liegt vor Ihnen. Fressen Sie den Groll nicht in sich hinein. Ziehen Sie einen Schlussstrich. Sie haben eine süße kleine Tochter, die Sie braucht.«
»Sie hätten Pfarrer werden sollen«, spottete sie. »Was hat das alles mit meiner Erkältung zu tun?«
»Das ist etwas anderes. Denken Sie darüber nach. Vielleicht können wir uns morgen noch einmal darüber unterhalten.«
»Das ist ganz allein meine Angelegenheit«, entgegnete sie widerspenstig.
Seufzend verließ er sie.
Denise sah ihn aufmerksam an. »Sie ist ein bisschen schwierig, aber das kommt durch ihre Situation«, meinte sie. »Sie lebt jetzt nur für das Kind und ist dankbar, dass sie hier sein darf. Schade ist es um dieses Mädchen, aber wahrscheinlich wird sie das Schuldgefühl nicht ganz verlieren, dass sie Petra einmal ausgesetzt hat, wenn wir dieses dumme Wort gebrauchen wollen. Übrigens geht sie allen Männern aus dem Weg, nicht nur Ihnen, Dr. Wolfram. Die Welt wäre wohl auch zu schön und friedlich, wenn sich immer gleich die richtigen Partner zusammenfinden würden. Wenn man diese Kinder hier so der Reihe nach ansieht und ihre Schicksale nachliest, kommen einem manche Zweifel, ob das göttlicher Wille ist. Aber es gibt auch immer wieder eine Hoffnung, wenn man den Glauben nicht verliert.«
Er nickte. »In diesem Sinne also, auf Wiedersehen bis morgen, Frau von Wellentin.«
*
Sie hatten mit Barbara und Werner bei ihrem letzten gemütlichen Beisammensein verabredet, dass sie sich nun regelmäßig treffen wollten. Da Dr. Wolfram jetzt da war, konnte Werner Baumgarten ja nun leichter mal einen Abend ausspannen.
Diesmal trafen sie sich in Schoeneich. Denise hatte Dominik mitgenommen, und Babs ihre drei.
»Na, ist alles wieder in Ordnung bei euch?«, erkundigte sich Babs, die ihre kleine Denise im Wagen neben sich stehen hatte.
»Es geht so«, erwiderte Denise. »Wenn man zwanzig Kinder im Haus hat, ist natürlich immer irgendetwas los.«
»Mir langen unsere drei«, meinte Werner. »Aber sie ist wirklich süß. Väter brauchen eben eine Tochter.«
»Mütter auch«, erklärte Babs. »Was doch diesen beiden Bengels so alles einfällt. Gestern haben sie Doktor gespielt und dreißig Mullbinden dabei verarbeitet.«
»Hoffentlich erfährt Nick das nicht, sonst macht er es morgen nach«, seufzte Denise. »Seit Dr. Wolfram bei uns ein und aus geht, hat er ohnehin seine Liebe zum Arztberuf entdeckt.«
»Kommt er jetzt gut mit ihm aus?«, erkundigte sich Babs. »Zuerst war er doch ziemlich renitent.«
»Claudia ist ja verheiratet«, lächelte Denise, »und für mich scheint er keine Gefahr zu sehen.«
»Was ich auch sehr hoffen möchte«, mischte sich Alexander ein.
»Und was ist mit Wolfgang Rennert?«, wollte Babs wissen.
»Am Montag fängt er an. Ob er sich zurechtfindet, ist noch die Frage. Wir haben lange Gespräche miteinander geführt, aber viel ist leider nicht dabei herausgekommen. Er ist ein begabter Bursche, aber die Zeit im Gefängnis hängt ihm doch sehr nach.«
Sie ahnte nicht, dass Dominik ihre Worte zufällig hörte. Er war heruntergekommen, um Schokolade zu holen, die sie für ein Spiel brauchten. Nun vernahm er etwas, was er eigentlich gar nicht wissen sollte.
Es beschäftigte ihn ungemein, und natürlich musste er mit jemandem darüber sprechen. So ging er zu Sascha.
»Ich muss mal mit dir reden«, sagte er. »Was sagst du dazu, Sascha, der Rennert war im Gefängnis. Warum wohl?«
»Warum kommt man schon ins Gefängnis? Geklaut wird er halt haben oder so was.«
»Aber dann darf er doch nicht nach Sophienlust«, ereiferte sich Dominik. »Da gibt es viel zu klauen. Mutti lässt immer alles offen herumstehen.«
»Woher weißt du es überhaupt?«, wollte Sascha wissen.
»Mutti hat es gerade erzählt. Aber bestimmt sollte ich es nicht hören.«
»Ich würde sie einfach fragen«, meinte Sascha.
»Dann denkt sie, ich lausche, und das kann sie nicht leiden. Aber einen Dieb stellt man doch nicht ein.«
»Wenn er seine Strafe abgesessen hat?«
»Bei uns hat neulich einer in der Klasse auch Geld geklaut«, erzählte Dominik. »Dann sind sie ihm draufgekommen, und er hat mächtig geflennt. Aber er hat das Geld zurückgegeben, und Lehrer Brodmann hat gesagt, dass wir es vergessen sollen.«
»Vielleicht hat der Rennert das Geld auch zurückgegeben«, überlegte Sascha.
»Dann wäre er doch nicht ins Gefängnis gekommen. Aber vielleicht hat er was viel Schlimmeres gemacht, Autos gestohlen oder so was?«
»Es ist ganz egal, was man stiehlt, Geld oder Autos. Gestohlen ist gestohlen. Soll ich mal mit Papi reden?«
»Warten wir lieber ab«, meinte Dominik diplomatisch. »Vielleicht sagt Mutti es mir noch. Sie hat es gar nicht gern, wenn ich mich in Dinge einmische, die Erwachsene angehen. Aber ein bisschen unheimlich ist es mir doch.«
»Wenn der Rennert richtig böse wäre, würde Papi bestimmt nicht erlauben, dass er nach Sophienlust kommt«, bemerkte Sascha nachdenklich. »Er malt schöne Bilder, und gut Geige spielen kann er auch. Und wenn er in der Kirche spielen darf, hat Gott ihm seine Sünden bestimmt vergeben.«
Dominik sah ihn bewundernd an. »Du redest schon wie ein Erwachsener.«
»Ich bin ja auch schon zwölf«, antwortete Sascha darauf stolz.
»Wenn ich in die Oberschule komme, bist du schon sechzehn«, rechnete Nick rasch nach. »Meine Güte.«
»Dann kann ich dir wenigstens helfen«, meinte Sascha großmütig. »Ihr zwei habt es viel besser, du und Andrea. Ihr habt einen großen Bruder.«
Das fand Nick außerordentlich beruhigend. So gesehen war Sascha wirklich am schlechtesten dran.
»Aber jetzt habe ich wenigstens Golo. Der ist verdammt schlau«, gab Sascha anerkennend zu.
»Sind sie nett zu ihm in der Schule?«
»Warum sollten sie nicht nett sein? Neidisch sind sie halt, weil er immer gute Noten schreibt.«
»Und machen sie keine Bemerkungen, weil er anders aussieht?«
»Ach, Blödsinn. So anders sieht er doch gar nicht aus. Die großen Mädchen sind mächtig hinter ihm her.«
»Warum denn?«, fragte Dominik naiv.
»Er gefällt ihnen halt.«
Mit dieser Bemerkung tat sich für Dominik ein neues Problem auf, über das er nachdenken musste.
*
Denise glaubte, dass Dominik müde sei, weil er so schweigsam neben ihr saß. Daheim angekommen, musste sie jedoch bemerken, dass er eine rege Geschäftigkeit entwickelte. Staunend sah sie, dass er, schon im Schlafanzug, auf einem Stuhl herumturnte und versuchte, das oberste Fach seines Schrankes zu erreichen.
»Was suchst du denn da, Nick?«, fragte sie verwundert.
»Mein Sparschwein wollte ich verstecken«, erwiderte er trotzig.
»Und warum, wenn ich fragen darf?«
»Eigentlich möchte ich gar nicht, dass du fragst, Mutti«, meinte er kleinlaut.
»Seit wann hast du Heimlichkeiten vor mir?«, forschte sie.
»Du hast ja auch welche vor mir«, rechtfertigte er sich.
»Nun, das musst du mir schon genauer erklären, Nick. Komm herunter, stell dein Sparschwein auf seinen Platz und setz dich zu mir.«
Nur zögernd kam er der Aufforderung nach. Wohl war ihm nicht in seiner Haut. Mutti schien recht ärgerlich zu sein, und dann konnte sie auch sehr streng werden.
»Nun, der Rennert kommt doch am Montag, und er war im Gefängnis. Was hat er geklaut, Mutti? Geld, Autos, oder was sonst?«
»Er hat nicht gestohlen«, erwiderte sie und sah neue Probleme auf sich zukommen.
»Warum war er dann im Gefängnis? Ich habe es ganz zufällig gehört, als ich Schokolade holte«, fügte er rasch hinzu. »Ich habe auch mit Sascha darüber geredet. Er meint zwar, dass der liebe Gott ihm vergeben hat, weil er doch in der Kirche spielen darf. Aber weiß man’s?«
Denise seufzte tief auf. »Gut, dass wir heute noch darüber sprechen. Es wäre ziemlich schlimm gewesen, wenn Herr Rennert hätte merken müssen, dass ihm misstraut wird.«
»Aber das muss man doch, wenn er im Gefängnis war.«
»Nun pass mal auf, Nick. Du hast doch schon manchmal einen Fehler gemacht. Herr Rennert auch. Er bereut diesen Fehler genauso, wie du bereust, dass du so abweisend zu den Kindern warst.«
»Dafür kommt man aber nicht ins Gefängnis«, beharrte er.
»Es gibt kleine Fehler, größere und ganz schlimme. Für manche wird man bestraft, für andere nicht.«
»Manchmal wird man auch um einen Dreck bestraft. Bloß wenn man mal schwatzt in der Schule. Was muss man eigentlich im Gefängnis machen?«
»Du lieber Himmel«, dachte Denise, »was wird er noch alles für Fragen stellen?« Aber glücklicherweise interessierte es ihn bald mehr, wie lange Herr Rennert hatte im Gefängnis bleiben müssen, und dann konnte sie ihm endlich vorsichtig klarmachen, warum er da hineingekommen war.
»Aber wenn er das Geld so nötig für seine Mutter gebraucht hat, warum hat er dich nicht darum gebeten?«, fragte er.
»Da waren wir ja noch nicht hier.«
»Und es hat sich kein anderer gefunden, der es ihm gegeben hat?« Sein Mitgefühl war geregt, jetzt tat ihm Herr Rennert schon leid.
»Ach, weißt du, Nick, in der Verzweiflung tut man manches, was man später sehr bereut. Ich finde, wenn man dafür gebüßt hat, sollten die anderen nicht mehr daran denken. Versprichst du mir, dass du es nicht erwähnst?«
»Ich schon, aber andere wissen es ja auch, und wenn die nun darüber reden?«
»Wenn wir ihm das Gefühl geben, dass wir ihn mögen, wird es ihm sicher helfen.«
»Hat das Geld seiner Mutter nun eigentlich geholfen?«, fragte Nick nach langem Überlegen.
Wolfgang Rennerts Mutter … An die hatte Denise gar nicht gedacht. Lebt sie eigentlich noch? War sie gesund geworden? Wie hatte sie das alles ertragen, denn geliebt hatte sie ihren Sohn doch bestimmt, wie er sie geliebt haben musste, wenn er imstande war, etwas Unrechtes für sie zu tun.
»Ich werde ihn einmal danach fragen, Nick«, meinte sie gedankenverloren.
Aber Nick hörte sie nicht mehr. Er war eingeschlafen.
*
Pünktlich auf die Minute erschien Wolfgang Rennert in Sophienlust. Schmal, bleich, mit eingefallenen Wangen und kurzgeschnittenen Haaren, in einem unmodischen und zu weiten Anzug stand er vor Denise.
»Bitte, nehmen Sie doch Platz«, sagte sie freundlich. »Ich denke, wir sollten uns erst noch über das Gehalt unterhalten. Vormittags haben Sie ja nur mit den Kleinen zu tun. Eine Stunde Musik, eine Stunde Zeichnen. Es sind natürlich nicht alle so talentiert wie Roli. Ihr sollen Sie sich nachmittags widmen. Sie waren zwei Jahre auf der Akademie?«
Er nickte scheu. »Ich musste dann aufhören, weil meine Mutter krank wurde.«
»Ist sie gesund geworden?«, fragte Denise rasch.
»Ja! Sie wurde operiert, und jetzt geht es ihr recht gut.« Etwas Farbe kam in sein blasses Gesicht. »Sie arbeitet jetzt in der Stadt als Fürsorgerin. Das war ihr eigentlicher Beruf. So war es doch zu etwas nütze, dass ich …«
»Darüber wollen wir nicht mehr sprechen, Herr Rennert«, fiel ihm Denise freundlich ins Wort. »Ich vertraue Ihnen unsere Kinder an, das sollte Ihnen beweisen, dass ich auch Vertrauen zu Ihnen habe.«
»Ich weiß es zu würdigen, gnädige Frau. Ich danke Ihnen sehr. Wie kann ich mich sonst noch nützlich machen? Mit den paar Stunden am Tag bin ich ja nicht ausgelastet.«
»Warten wir es ab«, lächelte sie und dachte: »Zuerst muss er mal zu Kräften kommen, erbärmlich schaut der arme Kerl aus.« Denises Herz war voller Mitgefühl. Es würde noch einige Zeit dauern, bis er seine Hemmungen verloren hatte, aber er war nicht der Einzige in Sophienlust, der seelische Belastungen mit sich herumschleppte.
Ein anderer Gedanke kam ihr noch. Fürsorgerin war seine Mutter. Wenn man ihr nun auch die Möglichkeit gab, hier ein neues Betätigungsfeld zu finden? Eine ausgebildete Kraft wäre hier dringend nötig. Natürlich musste man sie erst einmal kennenlernen. Und zu allererst wollte Denise ihre ganze Aufmerksamkeit dem Sohn zuwenden, der sich bewähren musste.
Von den Angestellten wussten alle Bescheid. Sie hatten über diesen neuen Hausgenossen geteilte Meinungen, aber wenn Denise etwas anordnete, wagte niemand zu widersprechen.
Jetzt machte sie ihn zunächst mit allen bekannt.
»Aufpäppeln musst man ihn erst mal«, meinte Magda später gutmütig.
»Wie der mit den Kindern fertig werden soll, ist mir schleierhaft«, brummte Lena. »Die rennen ihn ja über den Haufen.«
Edith war wie immer, steif und zurückhaltend. Und die Kinder schlichen um ihn herum und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Doch wenn er allein mit ihnen war, schien er wie verwandelt. Denise konnte es aus der Ferne beobachten. Nick, der mahnenden Worte seiner Mutter und seiner guten Vorsätze eingedenk, zeigte sich von seiner tolerantesten Seite. Für Roli aber schien er eine Offenbarung zu sein. Ihre Augen hingen andächtig an seinen Lippen, wenn er etwas erklärte. Und unausgesetzt beobachtete sie seine Hände, wenn er zeichnete.
»Roli ist ganz weg von ihm«, berichtete Nick. »So muss das bei den Mädchen sein, die Golo nachrennen.«
Denise starrte ihn verblüfft an. Wie kam er nur zu einem solchen Vergleich?
»Da guckst du, Mutti, was?«, meinte Nick. »Sascha sagt, dass die großen Mädchen mächtig hinter Golo her sind. Ich habe immer überlegt, was er damit meint, aber jetzt kann ich es mir vorstellen. Roli ist ganz anders, wenn Herr Rennert mit ihr redet.«
»Du lieber Gott«, dachte Denise, »sollte das möglich sein? Was hatte sie da angerichtet? Roli war fünfzehn und ein hübsches Mädchen. Und Wolfgang Renner war vierundzwanzig.«
»Was stöhnst du denn, Mutti?«, erkundigte sich Nick erstaunt. »Du hast doch gewollt, dass wir ihn verstehen. Roli versteht ihn halt am besten. Das kommt eben davon, dass sie malt und auch gut singen kann.«
»Hoffentlich ist das die einzige Erklärung«, dachte Denise leicht erschüttert.
*
Zu den Musikstunden, die Wolfgang Rennert sehr gewissenhaft und auch mit großem Einfühlungsvermögen gab, kam auch Kati immer nach Sophienlust. Und auch sie war von ihm hellauf begeistert. Mit strahlenden Augen erzählte sie, dass er nicht nur wunderschön Geige, sondern auch Klavier spielen könnte und dass sie das auch gern lernen würde.
»Und er hört es ganz genau, wenn einer falsch singt«, stellte sie fest.
Nun, Kati war ein kleines Mädchen, aber Roli war in einem Alter, in dem Schwärmerei bereits gefährlich werden konnte. Denise nahm sich vor, einmal ernsthaft mit Wolfgang Rennert darüber zu sprechen.
Er begriff erst gar nicht, worauf sie hinauswollte. Dann wurde er rot.
»Roli ist sehr talentiert«, erwiderte er. »Aber Sie werden doch nicht glauben, dass ich das Vertrauen, das Sie in mich setzen, irgendwie missbrauche, gnädige Frau?«
Es war das erste Mal, dass sie einen energischen Zug in seinem Gesicht bemerkte, und sie schalt sich, dass sie überhaupt damit angefangen hatte. Doch das war nur seine Meinung, nicht die von Roli.
»Sie ist fünfzehn«, meinte sie tastend. »Sie hat die gleichen Interessen wie Sie. Es ist sicher nicht einfach, dies ganz nüchtern zu betrachten. Aber ich muss es. Ich habe die Verantwortung für die Kinder.«
»Soll ich wieder gehen?«, fragte er leise, und in seinen Augen war Verzweiflung.
»Nein, Herr Rennert, ganz gewiss nicht. Ich möchte nur vorbeugen.«
»Ich habe noch nichts bemerkt. Sie können ganz unbesorgt sein, gnädige Frau. Ich verehre Sie viel zu sehr, als dass ich einen solchen Fehler machen würde.«
*
Bis zur Rückkehr von Lutz und Claudia aus den Flitterwochen geschah noch allerlei. Denise bekam einen Vorgeschmack davon, was sich in einem Heim mit zwanzig Kindern alles tun konnte, und manchmal konnte sie jetzt sogar Madame Merlinde verstehen, die nicht mehr die Nerven gehabt hatte, alles mit Gelassenheit zu ertragen.
Schon bald musste Denise die Erfahrungen machen, dass ein einziges Kind alles durcheinanderbringen konnte. Es war nicht Golo, sondern Heiner Ebeling, der sich anfangs ziemlich umgänglich gezeigt hatte. In letzter Zeit aber waren schon von Lehrer Brodmann Klagen gekommen, weil er dauernd den Unterricht störte, und nun begann er auch hier im Heim zu rebellieren.
Denise geriet in Zorn, als sie beobachtete, dass er mit Steinschleudern nach den Vögeln zielte. Robby und Mario kamen angestürzt und empörten sich ebenfalls darüber.
»Getroffen hat er auch schon, eine Amsel«, jammerte Mario.
»Warum habt ihr es mir nicht früher gesagt?«, fragte Denise.
»Er macht’s ja erst seit ein paar Tagen«, rechtfertigte sich Robby.
Zuerst musste geklärt werden, woher er die Steinschleuder bekommen hatte, denn in Sophienlust wurde nicht mit Dingen gespielt, die eine Gefahr für sie selbst und für Tiere bedeuten konnten.
Heiner war verstockt, als Denise ihn zu sich holte. Er war ein stämmiger zehnjähriger Junge, eines von den Kindern, die zwar noch Vater und Mutter besaßen, von denen sich aber niemand um ihn kümmerte, abgesehen davon, dass sie abwechselnd die Unterhaltskosten überwiesen und regelmäßig ihre Berichte bekamen. Ein persönliches Schreiben war von ihnen bisher noch nicht gekommen, obgleich Denise sich in verbindlicher Art an sie gewandt hatte.
»Woher hast du die Steinschleuder?«, fragte sie ihn eindringlich.
Er presste die Lippen zusammen und schwieg.
»Warum tust du so was?«, fragte Denise weiter. »Du musst doch einen Grund haben.«
»Sie fressen die ganzen Kirschen weg, wenn die erst reif sind«, erklärte er darauf. »Die Bauern schießen ja auch nach ihnen. Da sagt keiner was. Ich kann das Getue, das um die Tiere hier gemacht wird, sowieso nicht leiden. Nur die Starken sollen überleben, sonst frisst uns das Ungeziefer eines Tages auf.«
Für einen Zehnjährigen war das eine erschreckende Philosophie. Er musste sie von jemandem eingeimpft bekommen haben. Denise bekam es auch heraus.
»Franz sagt es auch«, rückte Heiner schließlich heraus. »Wenn wir groß sind, werden wir Soldaten und dann schießen wir alle tot, die nichts taugen.«
»Das sind ja schöne Aussichten«, dachte Denise, und es fröstelte sie. Franz war der Sohn des Bürgermeisters, und sie wusste nicht recht, wie er sich zu der Lebensauffassung seines Sohnes stellte.
»Erzähle doch ein bisschen«, forderte sie Heiner auf. »Es ist sehr interessant, was du sagst.«
»Nicht wahr, das finde ich auch. Im Fernsehen müssen sie immer ganz tolle Sachen bringen. Franz erzählt es mir immer. So wie es früher war, war es viel schöner. Da haben sie nicht lange gefackelt, da haben sie gleich geschossen oder einen aufgehängt. Und mit den Tieren haben sie auch nicht so’n Trara gemacht.«
Er redete sich in eine wahre Begeisterung hinein, und Denise wurde himmelangst, als sie seine Ansichten so klar und deutlich vernahm.
»Hör mir mal gut zu, Heiner«, unterbrach sie ihn. »Wir sind hier eine Gemeinschaft, in der jeder mit den anderen gut auskommen soll. Mit Menschen und mit Tieren. Ich höre mir gar nicht gern an, was du da so für Ideen entwickelst.«
»Aber in der Natur ist es doch auch so, dass die Starken die Schwachen besiegen, und es hat auch keiner was dagegen, wenn Rehe und Hasen abgeschossen werden. Aber wenn ich ein paar Amseln umlegen will, macht man ein Mordstrara. Dabei gibt es sowieso zu viele, und Krähen auch. Franz sagt auch, dass die Kinder hier alles Memmen sind. Singen und Malen und so lächerliche Spiele machen, das mag ich nicht mehr, dazu bin ich schon zu groß.«
»Aber ich dachte, dass es dir recht gut hier gefiele«, sagte Denise müde.
»Na ja, so ist es ja auch ganz schön, und das Essen ist prima. Und irgendwo muss ich ja sein. Wo soll ich denn sonst hin? Franz sagt, wenn man als Kind Blödsinn macht, kommt man in eine Erziehungsanstalt, und da gibt es jeden Tag Schläge.«
»Na, das merk dir nur gut«, erwiderte Denise ärgerlich. »Und jetzt gib mir mal die Steinschleuder her.«
Zögernd holte er sie aus der Tasche. Trotzig schob sich seine Unterlippe vor. »Wollen Sie mich in eine Erziehungsanstalt stecken?«, fragte er aggressiv.
»Gewiss nicht. Aber ich möchte, dass du dich an guten Beispielen orientierst und nicht auf das Geschwätz eines dummen Jungen hörst.«
»Aber Franz Vater ist Bürgermeister, und der hat was zu sagen«, begehrte er auf.
»Und hier habe ich was zu sagen«, antwortete sie streng. »Hier wird getan, was für die Gemeinschaft gut ist. Ich hoffe, dass du vernünftig genug bist, das einzusehen.«
»Sie sind ja bloß eine Frau«, stieß er eigensinnig hervor.
Denise lächelte flüchtig. »Du meinst, das Wort eines Mannes gilt mehr?«, fragte sie und nahm sich vor, doch einmal mit Bürgermeister Lenhard zu sprechen, auch wenn es dadurch zu Differenzen kommen sollte.
Aber für Bürgermeister Lenhard galt Denise von Wellentins Wort genauso viel wie das eines Mannes.
»Die Buben sind in einem schwierigen Alter«, meinte er. »Franz will sich plötzlich auch behaupten. Na und hier auf dem Dorfe hören sie so manches.«
»Und im Fernsehen sehen sie so manches«, warf Denise ein.
»Was will man denn machen«, brummte er. »Der Apparat steht da, und ehe man sich versieht, hocken sie davor. Und da sehen sie dann Kriege und all die grässlichen Dinge. Wenn es mir zu viel wird, kriegt er mal richtig den Hosenboden voll, dann ist wieder eine Weile Ruhe.«
Denise fragte sich, ob das die richtige Erziehungsmethode sei, aber vielleicht hatte sie doch etwas Gutes.
»Vielleicht können Sie sich den Heiner bei passender Gelegenheit auch mal vornehmen«, schlug sie vor. »Er hat vor einem Mann mehr Respekt als vor einer Frau.«
»Wenn er Ihnen Schwierigkeiten macht und wenn gar Franz daran schuld ist, kriegt er es mit mir zu tun«, knurrte Bürgermeister Lenhard. »Das fehlt noch, dass die beiden Bengels jetzt schon mit diesem ganzen Revoluzzerquatsch anfangen.«
*
Hatte Denise den Teufel an die Wand gemalt?
Selbst Bürgermeister Lenhards Strafpredigt hatte bei den beiden renitenten Burschen nicht viel gefruchtet, auch nicht, dass er ihnen beiden eine Tracht Prügel verabreichte, als sie ihm den Zaun einrissen.
Aber dann geschah es, dass Franz bei seinen täglichen Schießübungen ausgerechnet den Heiner traf, und zwar genau neben der Schläfe. Der Junge fiel wie ein Klotz um. Franz, vom schlechten Gewissen geplagt, lief weg. Wäre nicht zufällig Dr. Wolfram des Weges gekommen, hätte er nicht den Jungen am Straßenrand liegen sehen, das Gesicht blutüberströmt, wer weiß, was dann noch geschehen wäre …
Dr. Wolfram wusste zwar nicht, wie der Junge zu dieser bösen Verletzung gekommen war, aber er erkannte sofort, dass sie schlimm genug war, die Sehkraft des linken Auges zu gefährden.
*
Mehrere Tage verbrachte Heiner in einem Dämmerzustand. Er wusste nicht, dass er in Sophienlust war, fürsorglich betreut von Schwester Gretli und Edith. Er wusste auch nicht, dass man dem Missetäter Franz bereits ein Geständnis abgerungen hatte.
Für Dominik war dies alles sehr aufregend. Zum ersten Mal wurde ihm wirklich bewusst, was aus Leichtsinn und Unüberlegtheit entstehen konnte, und dass man unter Umständen lebenslänglich für etwas bestraft werden konnte, was man eigentlich gar nicht gewollt hatte. Er zog Vergleiche mit Wolfgang Rennert und meinte, dass es doch besser sei, wenn man eine Strafe verbüßen könne und daraus lerne.
Nun, gelernt hatte Franz wohl auch aus seiner leichtsinnigen Tat, aber ob sie ihn nicht doch ein Leben lang verfolgen würde, das stand noch nicht fest. Die Tracht Prügel, die er von seinem Vater bezogen hatte, war das Wenigste. Viel schlimmer war, dass die Gefahr bestand, dass Heiner auf einem Auge blind werden würde.
Denise hatte sowohl Heiners Vater als auch seine Mutter verständigt. Der Vater reagierte in ungewöhnlicher Weise darauf. Heiner sei schon immer ein Nichtsnutz gewesen, schrieb er, und er sei froh, dass er die Verantwortung für ihn nicht mehr zu tragen brauche. Für die Arztkosten käme er selbstverständlich auf, im Übrigen aber möchte er von Heiner verschont bleiben, denn er sei wieder verheiratet und habe Gott zwei Dank zwei wohlgeratene Kinder.
Doch Heiners Mutter kam. Es war eine riesengroße Überraschung für Denise, als ihr dieser Besuch gemeldet wurde.
Frau Ebeling war eine Frau Mitte Dreißig, gepflegt, gebildet und im Augenblick ziemlich verstört. Vor fünf Jahren war ihre Ehe geschieden worden, und Denise vernahm die tragische Geschichte einer Frau, die ein paar Jahre älter als ihr Mann, einer Jüngeren hatte Platz machen müssen.
Bis vor zwei Jahren war Heiner bei ihr gewesen, aber dann war auch in ihr Leben ein Mann getreten, und auf sein Drängen hin hatte sie Heiner zu Madame Merlinde gegeben. Dass sie es heute bereute, erfuhr Denise im Verlauf dieser Unterredung. Und nachdem Frau Ebeling das Kind in das Heim gegeben hatte, war sie von dem Mann tief enttäuscht und betrogen worden. Er hatte sie um den größten Teil ihres Vermögens gebracht, und nun bemühte sie sich, in ihrem Beruf als Innenarchitektin wieder Fuß zu fassen.
Warum sie sich nie um Heiner gekümmert hatte? Zuerst war da der Mann gewesen, der dies verhindert hatte, dann war die Scham gekommen und die Angst, von ihm zurückgewiesen zu werden, von diesem Jungen, der von ihr verlassen worden war.
Wie Heiner es aufnehmen würde, wenn sie ihn besuchte, wusste niemand. Es konnte ein Schock für ihn sein, weil die Trennung von der Mutter vielleicht auch ein Schock gewesen war, der erklärte, warum er so aggressiv war.
Denise ging zu ihm. Er lag regungslos in seinem Bett. Das eine Auge war verbunden, das andere stand offen und starrte zur Decke.
»Franz war nicht schuld«, sagte er. »Ich war selber schuld. Ich hätte ihn auch treffen können. Sie haben mich ja gewarnt. Das ist die Strafe, weil ich nicht auf Sie gehört habe. Jetzt sind Sie aber froh, dass Sie mal wieder recht behalten haben, nicht wahr?«
»Kann ich froh sein, wenn du Schmerzen hast?«, fragte Denise behutsam.
»Die Strafe folgt auf dem Fuße, Herr Brodmann hat es oft genug gesagt.«
»Nun weißt du, was man mit solchem Unsinn anrichten kann. Tut es noch sehr weh, Heiner?«
»Auf einem Auge kann man gar nicht so gut sehen, aber man gewöhnt sich daran. Ist das Auge kaputt?«
»Du hast großes Glück gehabt, aber vielleicht wirst du nun auf dem Auge schlechter sehen.«
»Das geschieht mir ganz recht«, murmelte er. »Wir waren ganz schön blöd. Die Großen sind doch schlauer.«
»Warum bist du eigentlich so aggressiv?«, fragte sie. »Meinst du nicht, dass deine Mutti sehr traurig darüber wäre?«
»Ach die, der ist es doch egal. Meinem Vater auch. Er hat eine andere Frau, und Mutti wollte mich auch nicht mehr haben wegen eines Kerls. Wenn ich mal groß bin, heirate ich nie, und Kinder will ich auch keine haben.«
»Wenn deine Mutti dich aber nun besuchen würde?«, tastete sich Denise vor.
»Die kommt nicht. Die hat keine Zeit«, sagte er verächtlich.
»Sie ist aber gekommen, Heiner. Sie möchte dich besuchen.«
»Hat er sie weggelassen?«, fragte er ungläubig. Dann sah er Denise aufmerksam an. »Oder wollen Sie mich jetzt in ein Erziehungsheim bringen lassen? Ist sie deswegen da?«
»Nein. Um dich zu besuchen, und mit dir darüber zu sprechen, ob du wieder zu ihr kommen willst.«
»Nein, ich will nicht. Ich kann den Mann nicht leiden. Er ist auch nicht anders als mein Vater. Er ist genauso gemein.«
Harte Worte, aber waren sie bei einem Kind, das so schwer enttäuscht worden war, nicht verständlich?
»Wenn deine Mutter nun aber eingesehen hat, dass der Mann nicht zu ihr passt, wenn sie lieber wieder mit dir zusammenleben möchte, Heiner, was dann? Möchtest du nicht einmal mit ihr sprechen?«
»Wenn sie schon da ist«, murmelte er nach einer langen Pause. »Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen. Warum ist sie nie gekommen?«
»Das wird sie dir selbst erzählen«, entgegnete Denise.
*
»Heiners Mutter ist gekommen«, sagte Dominik zu Toni und Ursi, die sich auf der Schaukel vergnügten.
»Na, da wird es schön was setzen«, meinte Toni. »Manchmal bin ich ganz froh, dass ich keine Mutter mehr habe. Mir gefällt es hier. Ich möchte immer hierbleiben. Will sie Heiner mitnehmen oder muss er weg wegen des Blödsinns?«
»Weg muss keiner«, verkündete Dominik. »Mutti sagt, man muss alles verstehen lernen, damit hilft man sich selbst am besten und den anderen auch.«
»Wenn ich solch eine Mutti hätte wie du, wäre ich auch froh«, versicherte Toni. »Aussuchen kann man es sich ja nicht. Aber es ist immer noch besser, wenn man gar keine Eltern hat, als wenn sie sich nicht um einen kümmern. Da weiß man wenigstens, woran man ist.«
»Wenn man es aber so schön hat wie wir, dann muss man dankbar sein«, überlegte Ursi. »Da kann man nicht aus der Reihe tanzen. Ich möchte hierbleiben, bis ich groß bin. So wie Roli. Ob Heiner nun von seiner Mutter mitgenommen wird?«
Doch diese Frage rückte sofort in den Hintergrund, weil in diesem Augenblick ein ganz toller Straßenkreuzer, wie sie alle drei gleichzeitig bemerkten, in den Gutshof einfuhr. Er hatte sogar eine Standarte auf dem rechten Kotflügel.
Ein dunkelhäutiger Chauffeur in heller Livree sprang heraus und öffnete eilfertig den Wagenschlag. Wie hypnotisiert verfolgten die Kinder dieses Schauspiel, und auch Golo kam zu ihrer Überraschung näher.
Er war blass geworden unter seiner dunklen Haut. Dominik sah, dass sein Blick starr wurde. Dann drehte er sich plötzlich um und flüchtete wie gehetzt in den Wald hinein.
Dominik wusste im Moment nicht recht, was er tun sollte. Anfangs war ja oft davon gesprochen worden, dass man darauf achten müsse, dass Golo nicht fortlaufe, aber diese Sorge hatten sie eigentlich schon lange nicht mehr. Und nun lief er doch weg.
»Renn zu Mutti und sag ihr, dass Golo fortgelaufen ist«, raunte er Toni zu. »Ich laufe ihm nach.«
Toni war daran gewöhnt, das zu tun, was Dominik von ihm verlangte. Und so lief er zu Denise, die eben davon informiert worden war, dass Fürst Djaleli eingetroffen sei.
Ein Fürst! Der Vater von Golo war ein Fürst! Schwester Gretli erstarb in Ehrfurcht und knickste ein über das andere Mal. Und ein Mann war das! Toll sah er aus mit seinen angegrauten Schläfen, den feurigen Augen, dem fremdländischen Gesicht.
Toni war nicht so leicht zu beeindrucken, und er war viel zu aufgeregt, weil er Tante Isi ja erzählen musste, dass Golo fortgelaufen sei und dass Dominik ihm folge. Er drängte sich zwischen den vornehmen Fremden und Denise und flüsterte es ihr aufgeregt zu.
»Golo ist fortgelaufen?«, fragte der Fremde in französischer Sprache, um es dann sofort in sehr gutem Deutsch zu wiederholen. »Er muss mich bemerkt haben. Aber er kennt mich doch gar nicht.«
»Er kann nicht weit sein«, antwortete Denise. »Oh, ich bedauere diesen Zwischenfall, Sir, aber ich konnte nicht mit Ihrem Besuch rechnen.«
Er musterte sie eindringlich. Sein schmales Gesicht hatte einen gespannten wachsamen Ausdruck.
»Frau von Wellentin«, sagte er mit seiner klangvollen Stimme. »Ich hatte Sie mir nicht so jung vorgestellt. Mein Besuch ergab sich rein zufällig, weil ich zwei Tage in Deutschland zu tun habe. Aber über dies alles können wir wohl sprechen, wenn Golo gefunden ist. Ist er sehr schwierig?«
»Ich kann nicht klagen«, erwiderte Denise erregt. Es war ein wenig viel, was wieder einmal auf sie einstürmte. Aber ihre Sorge galt jetzt in erster Linie Golo. Er kannte seinen Vater nicht, aber er musste wohl den Stander an seinem Wagen erkannt haben. Das ging ihr durch den Sinn, als sie diesen bemerkte.
»Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick, Sir. Ich möchte doch, dass sich noch mehr Leute auf die Suche nach Ihrem Sohn machen. Dominik kennt sich hier zwar aus, aber der Wald ist groß und unübersichtlich.«
»Ich bin nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen«, meinte er entschuldigend. »Ich muss gestehen, dass es mich sehr überrascht, meinen Sohn an einem so traumhaft schönen Ort zu wissen. Dazu betreut von einer so charmanten und schönen Frau«, fügte er galant hinzu.
»Guter Gott«, dachte Denise, »kann er an so etwas denken, wo jetzt alles seinen Sohn sucht? Er schien jedenfalls nicht bereit zu sein, sich an dieser Suche zu beteiligen, aber Denise dachte nicht daran, dass dieses unter seiner Würde war. Ein Fürst Djaleli brauchte sich nicht zu bemühen, er hatte dafür seine Domestiken. Selbst wenn es um seinen Sohn ging!«
*
Dominik hatte es gar nicht so leicht, Golo zu folgen. Er konnte zwar wie ein Wiesel laufen, aber Golo hatte die längeren Beine.
»Bleib doch stehen«, schrie Dominik. »Warum rennst du denn weg?« Aber dann bemerkte er zu seiner Beruhigung, dass Golo auf Schoeneich zulief. Der See war schon ganz nahe.
Doch gerade auf diesen See lief Golo zu, wie Dominik mit wachsendem Entsetzen beobachtete. Mitten hinein in das Wasser rannte er, und an dieser Stelle gab es doch so viele Schlingpflanzen …
»Golo, Golo, komm zurück!«, brüllte Dominik außer sich. Da vernahm er das Wiehern eines Pferdes, und gleich darauf sprang Alexander von seinem Pferd.
»Golo rennt in den See«, stammelte Dominik voller Angst. »Alexander, hilf doch. Er kommt nicht zurück. Er wird ertrinken.«
Alexander hatte schon seine Jacke abgeworfen und setzte dem Jungen nach, der glücklicherweise durch das Schilf nicht schnell vorankam.
»Golo, zum Donnerwetter«, schrie er in seiner Erregung, »willst du denn Denise ins Unglück stürzen?«
Diese Worte schienen den Jungen zur Besinnung zu bringen, gleichzeitig aber schien ihn ein Sog zu erfassen, der ihn hinabzog. Alexander konnte gerade noch seine Hand ergreifen, und dann spielte sich alles in Blitzgeschwindigkeit ab. Justus kam angekeucht, hinter ihm Edith und Robby.
Justus wälzte geistesgegenwärtig einen Baumstamm ins Wasser, an den sich Alexander klammern konnte, und mit vereinten Kräften zogen sie den Jungen an das rettende Ufer.
Vom Schlamm bedeckt waren sie beide und sahen schlimm aus. Unter anderen Umständen hätten die Kinder wohl lachen müssen, aber jetzt standen sie vor Entsetzen erstarrt da und überlegten, was das wohl zu bedeuten hatte.
Alexander scheuchte sie mit einer Handbewegung fort. Nur Dominik blieb an seiner Seite. Um nichts in der Welt hätte er sich vertreiben lassen, da er es doch gewesen war, der instinktiv die Gefahr erkannt hatte, in die Golo hineingerannt war. Warum nur?
»Er will mich abholen lassen«, murmelte Golo undeutlich.
»Was meint er?«, fragte Alexander.
Dominik zuckte die Schultern. »Da ist ein tolles Auto gekommen. Vielleicht ist es sein Vater«, meinte er.
»Ich will nicht weg«, flüsterte er. »Ich habe doch zum ersten Mal eine Heimat. Ich möchte lieber sterben.«
Entsetzt riss Dominik die Augen auf. Er wollte sterben! Sterben war doch etwas Schreckliches! Man konnte nie mehr zurück. Urgroßmama war auch nicht wiedergekommen, obgleich er es sich so sehr gewünscht hatte. Der Tod ist etwas Endgültiges, hatte seine Mutti zu ihm gesagt. Und zu ertrinken musste ganz schrecklich sein. Aber wenn jemand es wollte, ohne es zu müssen, dann musste ihm schon ganz traurig zumute sein, überlegte Dominik rasch und beugte sich zu Golo hinab.
»Ich war mal so gemein zu dir«, raunte er bebend, »aber du darfst mir jetzt nicht mehr böse sein.« Und da sah er, dass Tränen über Golos Wangen rannen. Dieser große Junge weinte. Ganz verzweifelt sah Dominik Alexander an.
»Er muss doch gar nicht weg, wenn er nicht will«, murmelte er. »Sag doch endlich was, Onkel Alexander.«
Aber der Mann wusste nicht, was er sagen sollte.
*
»Das habe ich doch nicht gewollt«, gestand Fürst Djaleli. »Ich schwöre es bei Allah, Ihr Brief, Madame, hat mich zutiefst bewegt. Mir wurde bewusst, dass ich mit Geld allein meine Vaterpflichten nicht erfüllen kann. Sie sehen mich erschüttert!«
Denise war es auch. Sie fühlte sich der Situation nicht gewachsen, aber es war tröstlich für sie zu wissen, dass Alexander in der Nähe war.
Justus war nach Schoeneich gefahren, um saubere Kleidung für ihn zu holen, und Alexander bemühte sich indessen, sich von dem Schlamm zu befreien, ebenso wie Golo, der sich dabei sehr viel Zeit ließ. Schließlich duldete er aber doch, dass Robby und Dominik ihm halfen.
Sophienlust – Oase des Friedens! Seit ein paar Tagen schien das nicht mehr zu stimmen. Im Augenblick war es draußen jedoch wieder still, und Fürst Djaleli tupfte sich mit einem blütenweißen Taschentuch die Stirn.
»Es ist mir entsetzlich peinlich, Madame, die Ursache dieser Aufregung zu sein«, murmelte er. »Wie kann ich das wieder gutmachen?«
»Wenn sich so viele Schicksale unter einem Dach zusammenballen, gibt es vielerlei Aufregungen«, erklärte sie, sich zur Ruhe zwingend. »Wichtig ist, dass für die Kinder alles gut wird.«
»Golo ist kein Kind mehr. Er wird zu einem Mann. Ich habe es mir zu spät überlegt. Ich werde künftig in Paris tätig sein und ihn in meine Nähe holen. Schließlich ist er mein Sohn.« Er sprang auf und lief im Zimmer umher. »Sie müssen mich verstehen, Madame, ich liebte seine Mutter sehr, aber sie fand sich nicht mit unseren Lebensgewohnheiten ab. Man sollte alles vorher und besser überlegen. Das entschuldigt natürlich nicht, dass ich mich nicht mehr um Golo gekümmert habe. Ich habe über meiner Arbeit auch vergessen, dass er älter wurde. Erst Sie haben mir das deutlich gemacht.«
»Golo ist ein überaus intelligenter und begabter Junge, aber auch sehr sensibel.«
»Sie kennen seine Mentalität besser als ich«, murmelte er.
»Er ist kein Einzelschicksal in einem solchen Hause. Wir haben mehrere Kinder, die zwischen ihren Eltern stehen«, sagte Denise verhalten.
»Er steht nicht zwischen seinen Eltern. Seine Mutter hat ihn einfach abgeschrieben. Ich habe immer gefürchtet, dass er mich an sie erinnern könnte.«
Denise betrachtete ihn sinnend. »Er ist Ihnen sehr ähnlich.«
Schweigend blickte er zu Boden. »Man hätte es mir vorher mitteilen sollen, vielleicht wäre dann manches anders gekommen. Dieser Zwischenfall jedoch macht mich sehr unsicher. Ich weiß nicht, ob es Sinn hat, einen Weg zur Verständigung zu suchen.«
»Man sollte nichts unversucht lassen, wenn es um ein Kind geht, auch wenn Sie meinen, dass Golo kein Kind mehr ist. Er trägt die Sehnsucht aller Kinder mit sich herum, zu erfahren, zu wem er gehört.«
Wieder betrachtete er sie aufmerksam. »Wie kann man nur so jung und doch so weise sein«, flüsterte er.
»Es kommt nicht auf die Jahre an, sondern auf die Erfahrungen.« Ein winziges Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. »Ich werde jetzt nach Golo sehen. Übrigens wünscht er sich glühend ein eigenes Pferd. Er ist ein guter Reiter«, bemerkte sie nebenbei.
Er trat auf sie zu, ergriff ihre Hand und zog sie an seine Lippen. »Ob ich ihn damit gewinnen kann?« fragte er.
»Gewinnen wohl nicht, aber eine Freude könnten Sie ihm bereiten.«
Dominik und Robby traten unaufgefordert den Rückzug an, als Denise in Golos Zimmer trat.
»Sauber ist er wieder«, raunte Dominik seiner Mutter zu, »aber reden tut er nichts.«
Die nachtdunklen Augen blickten Denise tieftraurig an, als sie ihre Hand auf Golos Arm legte.
»Ich mache Ihnen nur Kummer«, sagte er nach einem tiefen Atemzug. »Wenn Nick mir nicht nachgelaufen wäre, hätte man mich nie gefunden.«
»Das wäre sehr schlimm für mich gewesen«, erwiderte sie leise. »Wie hätte ich vor deinem Vater bestehen sollen, Golo?«
»Mein Vater …« Er machte ein wegwerfende Handbewegung.
»Er ist gekommen. Bedeutet dir das nichts?«
»Er selbst?«, fragte er verwundert.
»Hat man es dir noch nicht gesagt?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie haben ihm geschrieben? Das hätten Sie nicht tun sollen.«
»Er ist dankbar dafür. Weißt du, manchen Menschen muss man erst sagen, was gut ist. Nicht alle kommen von selbst darauf. Möchtest du nicht immer bei deinem Vater sein, Golo?«
»Jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt Freunde. Es ist nirgendwo so schön wie in Sophienlust.«
»Und dennoch wolltest du weglaufen?«
»Weil ich immer hierbleiben wollte«, erwiderte er mit erstickter Stimme.
»Oh, du unbesonnene, leidenschaftliche Jugend«, dachte sie, die nicht überlegt, dass der Wunsch zu sterben nur einem schmerzlichen Augenblick entspringen kann, die nicht bedenkt, wie viel Schönes sie noch erwartet.
Sie ging zu dem Globus, der auf seinem Schreibtisch stand. »So weit ist die Welt, Golo«, meinte sie gedankenvoll. »Millionen Geheimnisse birgt sie. Sophienlust ist nur ein kleiner Punkt. Man kann ihn nicht einmal finden. Die ganze Welt steht dir offen. Dein Vater wird sie dir zeigen.«
»Er wird mir das Geld geben, damit ich sie sehen kann, sonst nichts«, erklärte er voller Bitterkeit.
»Er ist erst dreizehn Jahre«, dachte Denise, und sie fragte sich, ob sie richtig gehandelt hatte, denn Golo hatte erst hier das Gefühl der Geborgenheit kennengelernt.
*
Bis zu dem Augenblick, als Heiner merkte, dass draußen etwas los war, hatte er seine Mutter nur misstrauisch betrachtet. Die Süßigkeiten und Bücher, die sie ihm mitgebracht hatte, waren achtlos beiseite gelegt worden. Als er aber die aufgeregten Stimmen vernahm, das Laufen und das Klappen der Türen, richtete er sich interessiert auf.
»Schau doch mal nach, was da los ist«, bat er drängend.
Sie tat ihm den Gefallen und fand auch jemanden, der ihr Auskunft gab. Es war Lena, die das Geschehen dramatisch schilderte.
Renate Ebelings Stimmung wurde dadurch noch gedrückter. Wenn ein Junge sogar davonlief, weil sein Vater kam, konnte sie kaum hoffen, dass Heiner seinen Widerstand gegen sie aufgeben würde.
»Hat wieder einer Blödsinn gemacht?«, empfing er sie.
»Ich glaube. Ein Junge ist weggelaufen, weil sein Vater gekommen ist«, antwortete sie geistesabwesend.
»Wer?«
»Golo heißt er.«
Heiner versank in Nachdenken. »Er ist schon dreizehn. Er ist ein Mischling, aber sein Vater ist mächtig reich«, erklärte er. »Er war schon immer ein bisschen komisch. Haben sie dir erzählt, was ich angestellt habe?«, lenkte er ab.
»Du hast doch nichts angestellt«, meinte sie. »Wärst du auch vor mir davongelaufen, wenn du nicht im Bett liegen müsstest, Heiner?«
»Nö«, antwortete er kurz. »Ich habe genauso mit der Steinschleuder geschossen wie Franz. Auch auf Vögel.« Es schien ihn zu befriedigen, sich vor ihr schlechtzumachen, und er wartete mit sichtlicher Spannung, wie sie reagieren würde.
»Aber du hast nun eingesehen, wie gefährlich das ist«, meinte sie.
»Ich hab’s gemerkt«, brummte er. »Wenn ich auf dem einen Auge nicht mehr gucken kann, werde ich mich immer daran erinnern. Franz sagt, dass sein Vater dann ganz schön blechen muss. Er hat seine Dresche dafür bezogen.«
»Davon wird es auch nicht besser«, versicherte sie. »Man kann es nicht ungeschehen machen.«
»Hättest du mich nicht geschlagen?«, fragte er skeptisch.
»Ich habe auch manches falsch gemacht, Heiner«, sagte sie leise. »Ich habe dir wehgetan. Nicht körperlich, aber du warst mir doch sehr böse, nicht wahr?«
»Früher schon«, gab er zu. »Warum bist du gekommen, Mutti?«
Sie schluckte ein paarmal, weil er Mutti gesagt hatte. »Ich habe mir Sorgen um dich gemacht.«
»Und wenn ich früher schon mal richtig krank gewesen wäre, wärest du dann auch gekommen?«
»Du wirst mich vielleicht nicht verstehen, Heiner, aber ich wollte schon lange kommen. Ich dachte nur, dass es für dich besser ist, wenn du nicht an mich erinnert wirst.«
»Ich konnte den Mann nicht leiden, er hat dich mir weggenommen.«
»Er ist nicht mehr da.«
»Ist er dir auch weggelaufen? «
Die Wahrheit konnte sie ihm nicht sagen. »Ich möchte lieber allein bleiben, und wenn du willst, kannst du wieder zu mir kommen. Ich arbeite jetzt in meinem Beruf und verdiene genug für uns zwei. Es ist nur ein Vorschlag.«
»Ich bin gar kein braver Junge«, meinte er. »Ich habe viele Scherereien gemacht, auch in der Schule. Hast du auch Ärger meinetwegen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Frau von Wellentin ist sehr nett, und sie wäre sicher ebenfalls froh, wenn wir beide uns wieder vertragen würden.«
»Will sie mich loswerden?«
»Nein, so ist es nicht, Heiner.«
»Dann schickt sie mich nicht gleich weg? Ich möchte ihr nämlich noch gern beweisen, dass mir die Sache eine Lehre war.«
»Wenn du noch hierbleiben willst …, sagen wir bis zu den Ferien?« Hoffnung erwachte in ihr, dass er sich für sie entscheiden könnte. »Ich habe eine hübsche Wohnung, auch ein Zimmer für dich, und kann öfter daheim sein.«
»Du gibst mich in kein Internat?«
»Nein, Heiner, du kannst dann immer bei mir bleiben.«
»Ich möchte es ganz gern«, sagte er leise. Seine Hand glitt zum Verband. »Das war schon blöd, dass das passiert ist, aber wenn du deshalb hergekommen bist, ist es eigentlich auch wieder ganz gut.«
»Dann hast du mich noch ein bisschen lieb?«, fragte sie gepresst.
»Lieb hatte ich dich immer. Deswegen war ich ja manchmal so ungezogen. Ich hoffte immer, dass sie dir das schreiben würden und dass du dann doch mal kommen würdest. Ich dachte auch, dass der Mann sich dann ärgern würde.«
Sie küsste ihn auf die Stirn.
»Hoffen wir, dass nun alles gut wird, Heiner«, flüsterte sie. »Wir haben beide etwas gelernt.«
*
Golo blickte seinem Vater nicht nur misstrauisch, sondern mit feindseliger Abwehr entgegen.
»Du hättest dich nicht zu bemühen brauchen«, sagte er in seiner gepflegten Sprache, die ihn viel älter erscheinen ließ, als er war.
Fürst Djaleli sah Golo ernst an.
»Hätte ich geahnt, dass mein Besuch eine solche Reaktion bei dir hervorrufen würde, hätte ich mich angemeldet«, antwortete er.
Golo presste die Lippen aufeinander. Da war sein Vater, nach dem er sich so sehr gesehnt hatte. Er erinnerte sich noch genau daran, wie er früher mit ihm gespielt, wie er ihn zum ersten Mal auf ein Pferd gesetzt hatte, das dann später gestorben war. Er erinnerte sich auch noch des Tages, an dem er mit seiner Mutter weggefahren war, nicht ahnend, dass er seinen Vater lange Zeit nicht mehr wiedersehen würde.
»Warum bist du gekommen?«, fragte er abweisend.
»Ich gehe nach Paris. Eigentlich wollte ich dir vorschlagen, mit mir zu kommen, Golo, aber dazu ist es jetzt wohl zu spät. Du bist groß geworden, mein Sohn«, fügte er leise hinzu. »Was hast du für Zukunftspläne? Sollten wir nicht darüber sprechen? Oder willst du nicht mit mir sprechen?«
Sein Vater sprach von der Zukunft, und noch vor wenigen Stunden hatte er sterben wollen. Golo schloss die Augen. Es war schrecklich gewesen, als ihn der Sog hinabgezogen hatte.
»Du hast alle Möglichkeiten, Golo«, fuhr sein Vater fort. »Du kannst dich entscheiden, wie du willst.«
Golo drehte den Globus. Was hatte Denise von Wellentin vorhin zu ihm gesagt? »So weit ist die Welt. Millionen Geheimnisse birgt sie. Sophienlust ist nur ein kleiner Punkt.« Für Wochen war es seine Welt gewesen, aber für immer?
»Vielleicht möchte ich einmal Diplomat werden wie du«, sagte Golo leise. »Kann man die Welt verändern, Dad?«
»Die Welt? Nein, Golo, die Welt kann man nicht verändern. Die Gesetze vielleicht, die Regierungen, die Bedingungen, unter denen die Völker leben, aber die Welt und die Menschen – nein, die kann nur der verändern, der über allem steht.«
»Und es wird immer Eltern geben, die sich von ihren Kindern trennen? Männer und Frauen, die heiraten und wieder auseinandergehen? Ich verstehe das nicht.«
»Wer versteht das schon am Anfang eines Lebens, mein Sohn. Du denkst sehr viel darüber nach.«
»Ich habe immer darüber nachgedacht. Es ist so schwer, das zu begreifen.«
»Ja, es ist sehr schwer, Golo«, sagte sein Vater und machte einen Schritt auf ihn zu.
Der Junge wich nicht zurück. Stolz hob er den Kopf.
»Aber es gibt Menschen wie Frau von Wellentin, Dad. Warum hast du nicht solch eine Frau geheiratet?«
Fürst Djaleli sah ihm fest in die Augen. »Es kommt alles, wie es einem bestimmt ist, Golo. Ich wollte dir keinen Schmerz zufügen. Ich kann mich auch nicht rechtfertigen für das, was ich unterlassen habe. Ich kann dich nur bitten, meine Hand nicht zurückzuweisen. Und ich kann nur wünschen, dass dir erspart bleibt, was mir ein unbegreifliches Schicksal auferlegt hat.«
»Wirst du in Paris bleiben?«
»Ich weiß nicht. Ich werde immer dahin gehen, wohin man mich ruft.«
»Und ich?«, fragte Golo.
»Du kannst mitgehen.«
»Durch die ganze Welt?«, meinte Golo gedankenvoll. »Ich möchte ihre Geheimnisse ergründen, Dad.«
»Wollen wir es gemeinsam versuchen, Golo?«, fragte Fürst Djaleli.
Der Junge nickte gedankenverloren, und sein Vater legte den Arm um seine Schultern. »Frau von Wellentin sagte mir, dass du dir ein Pferd wünschst. Du kannst dir eines aussuchen. Das schönste, das wir finden können.«
»Ich habe es mir sehr gewünscht«, sagte Golo sinnend. »Aber ich müsste mich dann wieder von ihm trennen. Es ist sehr schwer, sich von etwas zu trennen, was man lieb gewonnen hat.«
*
Bebend lag Denise in Alexanders Armen. »Mein Gott, war das ein Tag«, flüsterte sie.
»Das hast du schon manches Mal gesagt«, sagte er tröstend. »Glück und Schmerz liegen dicht beisammen.«
»Das hast du auch schon manches Mal gesagt«, gab sie zurück. »Alles hätte für den Jungen zu Ende sein können, wenn du nicht gewesen wärest.«
»Ich muss gestehen, dass ich mehr an dich und mich gedacht habe, als ich in dem Schlamm lag«, lächelte er.
»Morgen verlässt uns Golo«, sagte sie gedankenverloren. »Und Heiner geht nach den Ferien zu seiner Mutter.«
»Zwei weniger. Aber wer garantiert mir, dass dafür nicht ein halbes Dutzend andere kommen? Ich lasse mich auf kein Risiko mehr ein.«
Die Tür ging auf. Dominik erschien. »Sascha hat eben angerufen, Onkel Alexander. Sie wollen wissen, ob du heute noch heimkommst. Wenn dieses dumme Hin und Her doch endlich aufhören würde … Am Ende kommt es so, dass alle Kinder ihre Eltern haben, und wir gucken in den Mond.«
Alexander hob ihn hoch. »Ich verspreche dir, dass wir bald gemeinsam in den Mond gucken. Zufrieden?«
»Wenn er ganz dick und rund am Himmel steht?«, fragte Dominik verschmitzt. »Heute hat er sich versteckt. Es gibt Regen.«
»Das ist gut für die Saat. Ich hoffe dieses Jahr auf eine reiche Ernte.«
Dominik strahlte über das ganze Gesicht. »Wollt ihr was wissen? Dr. Wolfram und Edith sind jetzt ein Herz und eine Seele. Morgen Abend holt er sie ab. Dann gehen sie zusammen aus.«
»Das darf doch nicht wahr sein«, staunte Denise.
»Das hat Magda eingefädelt«, nickte Dominik. »Ganz schlau hat sie es angefangen. Lena sagt, sie ist ein Genie. Im ›Roten Ochsen‹ ist doch das Bauerntheater, und da hatten sie Karten. Aber Edith wollte nicht hingehen. Da hat Magda den Doktor einfach gefragt, ob er Edith nicht mal mitnehmen würde. Und er hat ja gesagt.« Dominik lächelte pfiffig. »Edith mag den Doktor nämlich. Und Magda hat das längst bemerkt. Meine Güte, ich muss ja Sascha Bescheid sagen, wann du kommst.«
»Sie sollen schlafen. Ich weiß nicht, wann ich komme.«
»Habt ihr wieder was Wichtiges zu besprechen?«, fragte Dominik mit einem schrägen Blick.
»Und wir möchten dabei nicht gestört werden«, sagte Denise.
*
»Weißt du, Sascha, sie haben noch was Wichtiges zu besprechen und wollen nicht gestört werden«, sagte Dominik wenig später am Telefon. »Heute war vielleicht was los hier … Kann Andrea mithören? Dann erzähle ich es euch rasch. Aber es ist zu dumm, dass ihr nicht da seid. Hoffentlich werden sich Mutti und Alexander heute einig, dass das bald anders wird!«