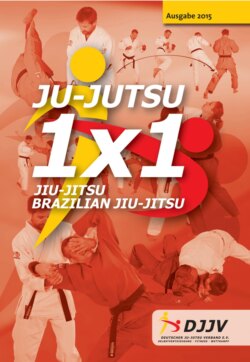Читать книгу Ju-Jutsu 1x1 2015 - DJJV Deutscher Ju-Jutsu Verband e.V. - Страница 3
EINLEITUNG
ОглавлениеWAS IST JU-JUTSU/JIU-JITSU?
Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu, Dschiu-dschitsu, Yu-Yitsu, Ju-Jitsu – Die unterschiedlichen Schreibweisen werden durch ein und dasselbe Kanji (jap. Schriftzeichen) verdeutlicht. Die Unterschiede sind durch verschiedenartige Aussprachen oder Übersetzungen der Kanji entstanden.
Es gibt weltweit kein „einzig anerkanntes“, „offizielles“ Transkriptionssystem von japanischen Kanji zu lateinischen Buchstaben. Auch heute werden noch verschiedene Umschriftarten verwendet. Grundsätzlich bedeuten alle Schreibweisen das Gleiche.
Die Japaner sprechen die Schriftzeichen in etwa „dschuu dschutsu“ oder „dschiuu dschiutsu“. Das „U“ am Ende des ersten Wortes wird stark gedehnt. Das „U“ am Ende des zweiten Wortes ist jedoch fast unhörbar.
Jede Schreibweise hat auch etwas mit der Zeit zu tun, in der sie verwendet wurde. Als Dschiu-Dschitsu wurde unsere Kampfkunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa eingeführt. Später hat sich dann der Begriff Jiu-Jitsu in Deutschland und Ju-Jitsu in Europa etabliert. Als man in Deutschland 1969 das System neu überarbeitet und den zeitgemäßen, europäischen Bedingungen angepasst hat, wurde ganz bewusst die Schreibweise Ju-Jutsu gewählt, um das Moderne zu verdeutlichen.
Ju-Jutsu / Jiu-Jitsu: Name und Bedeutung
Ju / Jiu (jap): sanft, flexibel, geschmeidig, weich, nachgiebig
Unter diesem Begriff versteht man jedoch keineswegs Schwäche, sondern vielmehr Flexibilität des Körpers und des Geistes: „wie sich der Bambus unter der Schneelast biegt, ohne zu brechen“. Das Konzept des „Ju“ beinhaltet auch Kraft und Schnelligkeit.
Jutsu / Jitsu (jap): Kunst, Technik, handwerkliches Können
(nach: Lind, Werner „Das Lexikon der Kampfkunst“)
Ju-Jutsu / Jiu-Jitsu = die flexible Kunst:
Die „Kunst durch Flexibilität, Vielseitigkeit, Anpassungsfähigkeit zu siegen“ ist die Kampfkunst (auch Sport), die den Ausübenden in die Lage versetzen soll, auf die unterschiedlichsten Situationen angemessen und richtig zu reagieren. Dies wird erreicht, indem der JJ-ka vielseitig ausgebildet wird und entsprechend seiner individuellen Möglichkeiten ein Handlungsrepertoire erlernt. Dies gilt insbesondere für Gewalt- und Konfliktsituationen, kann aber auch auf viele Lebensbereiche übertragen werden.
Darin drückt sich aus, dass wir für jeden Angriff die passende Abwehr haben, von Körpersprache und „sanftem Zwang“ bis zur effektiven Verteidigung mit der gebotenen Härte in einer eskalierenden Gewaltsituation. Dies eröffnet dem Anwender stets die Möglichkeit, sich im Rahmen der gesetzlich geforderten Verhältnismäßigkeit zu bewegen. Die Härte der Verteidigung muss dem Angriff angemessen sein, so dass kein Missverhältnis auftritt.
Ju-Jutsu und Jiu-Jitsu
Ju-Jutsu und Jiu-Jitsu erfüllen heute in Europa ähnliche Aufgaben wie das Jiu-Jitsu im feudalen Japan und viele Zweikampfsysteme auf der ganzen Welt: Die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, indem die Verteidigungsfähigkeit trainiert wird. Dies gilt auch speziell für Sicherheitskräfte (damals Samurai, heute zum Beispiel Polizeibeamte oder Soldaten). Hinzu kommt die heute als Fitness bezeichnete „körperliche Ertüchtigung“.
Neben den Grundelementen Bewegungsformen, Falltechniken, Abwehrtechniken, Schlägen, Tritten und Stößen sind ebenso Wurf- und Hebeltechniken der unterschiedlichsten Formen im JJ vertreten. Hinzu kommen die für das JJ speziell entwickelten Festhalte-, Aufhebe-, Transport- und Nothilfetechniken. Auch die Grundlagen der Konfliktbewältigung und Selbstbehauptung ohne den Einsatz körperlicher Gewalt werden im JJ vermittelt.
In der jüngeren Zeit hat die höhere Gewaltbereitschaft und Rücksichtslosigkeit der Täter dazu geführt, dass die Angriffe raffinierter, vielfältiger, brutaler und wesentlich gefährlicher geworden sind. Dem gilt es, ein Selbstverteidigungssystem entgegenzusetzen, das leicht erlernbar ist, von Personen jeden Alters und Geschlechts angewendet werden kann und optimale Wirkung erzielt.
Ju-Jutsu ist ein 1969 neu eingeführtes, modernes Selbstverteidigungssystem, das sich ständig den aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen anpasst und den Anspruch erhebt, eine moderne Selbstverteidigung zu sein. Die Techniken und Bewegungsformen in Verteidigungssituationen sind Grundlage der Ausbildung und Prüfungsinhalte. Dadurch hat man ein einheitliches System, das für ganz Deutschland festgelegt und vergleichbar ist.
Jiu-Jitsu orientiert sich stärker an den japanischen Wurzeln. Hier werden neben den Selbstverteidigungstechniken auch traditionelle Bewegungsformen wie Kata und Etikette gepflegt. Jiu-Jitsu steht also für eine traditionelle Kampfkunst. Die Schulen orientieren sich bei den Techniken an Funktionalität und Überlieferung. Die Prüfingsinhalte gehen von der Abwehr verschiedener Angriffe aus. Jede Schule (Ryû) hat die Möglichkeit, eigene Ausprägungen zu trainieren.
Definition Ju-Jutsu:
Ju-Jutsu ist moderne Selbstverteidigung (SV) und Zweikampfsport, der in sich Elemente unterschiedlicher Zweikampfsport- und Selbstverteidigungssysteme vereint bzw. weiterentwickelt hat. Ju-Jutsu ist ein sich ständig anpassendes System, das sich den aktuellen Gegebenheiten der Gewaltprävention, SV und des Zweikampfes öffnet und diese annimmt.
Definition Jiu-Jitsu:
Jiu-Jitsu ist ein japanisches Selbstverteidigungs-system, das von den Samurai entwickelt wurde. Diese Systeme (Ryû) ermöglichten den Samurai, beim Verlust ihrer Waffen weiter kämpfen zu können. Die Abwehrtechniken sollten dem vermeintlich Schwächeren helfen, über den vermeintlich Stärkeren zu siegen (Siegen durch Nachgeben).
GESCHICHTE
Als Wurzel fast aller asiatischen Kampfkünste wird Indien betrachtet, von wo sie sich über Südost-asien bis nach China und Japan verbreiteten und unterschiedliche Ausprägungen annahmen.
Im 13. Jahrhundert tauchten in Japan erstmals die Samurai als bewaffnete Kämpfer auf. Sie etablierten sich als Kaste, die sich verstärkt der Kriegsführung und den Kampfkünsten widmete. Der japanische Arzt A. Yoshitoki erlernte in China die Kunst des waffenlosen Zweikampfes, zu deren Ausführung enorme Körperkraft notwendig war. Der Legende nach beobachtete er bei einem Sturm (bzw. bei starkem Schneefall) wie sich die Weiden mit dem Wind (bzw. unter der Last des Schnees) bogen und somit unbeschädigt blieben. Er zog sich in den Tennango-Tempel in Tsukushi zurück und entwickelte dort ca. 100 Griffe zur Selbstverteidigung. Sein System, das „Yoshin-ryû“ (Weidenherz-Schule), beruhte auf dem Prinzip „Siegen durch Nachgeben“.
Im feudalen Japan gab es aber kein einheitliches Verteidigungssystem namens „Jiu-Jitsu“. Vorläufer bzw. vergleichbare Stilrichtungen (Ryû) waren z. B. „Yoshin-ryû“, „Yawara“, „Daito ryû“, „Kotori ryû“, „Takeno uchi ryû“, „Tenshin shinyô ryû“ und „Kitô ryû“. Der Name Jiu-Jitsu wird seit der Tokugawa-Ära in der Literatur erwähnt.
Der Begründer des Judo, Prof. Jigoro Kano, erwarb seine Kampfkunstfähigkeiten im Jiu-Jitsu unter anderem durch das Tenshin shinyô ryû und das Kitô ryû. Morihei Ueshiba, der Gründer des Aikido, erlernte ebenfalls das Tenshin shinyô ryû. Er trainierte aber auch das Shinkage ryû, Yagyû ryû und das Daito ryû.
Nach Deutschland gebracht wurde das Jiu-Jitsu von Erich Rahn. Durch seinen Vater, einen angesehenen Kaufmann, hatte Erich Rahn schon in der Kindheit Kontakt zu Japanern. Er erlernte das Jiu-Jitsu bei Herrn Higashi, der ihn in einem Schaukampf beeindruckt hatte. In Berlin eröffnete er 1906 die erste Jiu-Jitsu-Schule Deutschlands.
Seine Schüler gründeten 1922 die ersten Jiu-Jitsu-Vereine - Alfred Rhode, später bekannt als „Vater des deutschen Judo“, in Frankfurt/Main, Max Hoppe in Berlin, Otto Schmelzeisen in Wiesbaden und August Glucke in Stuttgart.
Im Jahr 1924 wurde der „Reichsverband für Jiu-Jitsu“ gegründet. Die erste Deutsche Einzelmeisterschaft im Jiu-Jitsu fand 1926 in Köln statt. 1930 gab es bereits mehr als 100 Jiu-Jitsu-Vereine in Deutschland.
Nach dem 2. Weltkrieg wurden Jiu-Jitsu und Judo von den Besatzungsmächten zunächst verboten. Doch schon ab 1949 durften Jiu-Jitsu und Judo in Westdeutschland wieder trainiert werden.
Das Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführte Jiu-Jitsu und insbesondere die fast nur auf Wettkampfsport ausgelegten Kampfsportarten Judo und Karate waren in den 60er Jahren für die Selbstverteidigung nicht mehr zeitgemäß. Es war dringend erforderlich, etwas Neues, vor allem aber Wirkungsvolleres zu schaffen. Hochgraduierte Dan-Träger erhielten den Auftrag, eine moderne und effektive Selbstverteidigung zu erarbeiten. Federführend dabei waren Franz Josef Gresch und Werner Heim. Sie stellten aus den verschiedensten Budo-Systemen die wirkungsvollsten Techniken zu einem neuen System zusammen, das den Namen Ju-Jutsu erhielt.
1969 wurde das neue Ju-Jutsu dann in Deutschland eingeführt. Es geht nicht mehr vom Angriff aus, sondern primär von den Verteidigungstechniken. Alle Verteidigungstechniken sind gegen mehrere Angriffsarten anwendbar. Im Ju-Jutsu sind altbewährte Erkenntnisse vieler Kampfsportarten, aber auch neue Erkenntnisse nach dem Grundsatz „aus der Praxis für die Praxis“ zu einer modernen und sehr effektiven Selbstverteidigung zusammengeführt worden. Weil auch die Sicherheitsbehörden erkannt hatten, dass Ju-Jutsu sehr praxisnah und wirkungsvoll war, wurde es bei den Polizeien der Länder und des Bundes dienstliches Ausbildungsfach.
Ab 1990 entstanden auch in Ostdeutschland zahlreiche Ju-Jutsu Vereine.
Um die Ziele des Ju-Jutsu besser vertreten zu können, gründete sich 1990 der Deutsche Ju-Jutsu Verband e.V., kurz DJJV.
Die Kenntnisse von verschiedenen Zweikampfsystemen haben sich in den vergangenen Jahren stark erweitert. Unter der Leitung von Bernd Hillebrand (Thomsen) hat eine Kommission im Jahr 2000 eine Überarbeitung des Ju-Jutsu eingeführt. Nach der Prämisse: „Immer das Beste aus den bekannten Kampfsystemen zu adaptieren,“ kamen nun auch Einflüsse aus nicht-japanischen Kampfsportarten zum Ju-Jutsu hinzu und wurden in ein methodisch strukturiertes System eingepasst.
Seit dem Zusammenschluss von Ju-Jutsu und Jiu-Jitsu im Jahre 2005 vereinigt der DJJV moderne und traditionelle Selbstverteidigung in einem Verband.
ETIKETTE
Im DJJV sind unterschiedliche Stile mit unterschiedlichen Wurzeln und Historien beheimatet. Je nach Stil, Anlass und auch je nach Gepflogenheiten einzelner Dojos unterscheiden sich Etikette, Kleiderordnung und das Verhalten auf der Matte in einigen Punkten. Dennoch sind die wichtigsten Grundregeln bei allen gleich.
Höflichkeit, Demut, gegenseitiger Respekt, Selbstbeherrschung und Fairness sind die Grundwerte des Verhaltens auf der Matte. Sie werden durch den Gruß und die Verneigung voreinander symbolisiert. Der Gruß kann unterschiedlich sein – im japanisch orientierten Jiu-Jitsu zum Beispiel durch Verbeugen im Stand oder im Kniesitz, im brasilianisch geprägten BJJ durch Berühren der Fäuste und Abklatschen – er sagt jedoch immer aus: „Lass uns zusammen üben, wir passen auf-einander auf, keiner soll verletzt werden.“
Die Pflege dieser Werte trägt nicht nur zur Sicherheit in Training, Prüfung und Wettkampf bei, sondern lässt sich auch in das Alltagsleben übertragen.
Kleiderordnung
Das Tragen eines sauberen und intakten Anzuges (Gi) sollte selbstverständlich sein. Niemand möchte mit einem ungepflegten Partner üben.
Je nach Stil, Verein und Anlass kann der Gi unterschiedliche Farben haben. Ein weißer Gi ohne auffällige Bedruckung oder Aufnäher (ausgenommen Hersteller- und Vereinsaufnäher) wird jedoch bei allen feierlichen und offiziellen Anlässen wie Prüfungen und Wettkämpfen erwartet. Frauen und Mädchen tragen dann unter der Jacke ein weißes T-Shirt oder Sporttop. Bei offiziellen Anlässen sollen Männer und Jungen unter der Jacke kein T-Shirt tragen. Im Training hingegen sind T-Shirts oder Funktionsshirts in den meisten Vereinen zulässig und können sinnvoll sein, um besser trocken und warm zu bleiben.
Im Training sowie auf Lehrgängen spricht außerdem, sofern es dem Selbstverständnis des Vereins und des Stils entspricht, nichts gegen farbige oder bedruckte Gis in den unterschiedlichsten Ausführungen.
Der Gürtel sollte fest gebunden sein und der Farbe der erreichten Graduierung entsprechen. Es gibt mehrere Ausführungen des Gürtelknotens, die als korrekt angesehen werden. Eine Gemeinsamkeit ist dabei immer die Dreiecksform des Knotens, der sich mittig vor dem Bauch befinden soll.
Körperhygiene
Das Training von Kampfsport und Kampfkunst führt unweigerlich zu Körperkontakt mit den Übungspartnern. Um Verletzungsgefahren zu vermeiden und ein angenehmer Übungspartner zu sein, sollte man ein paar hygienische Grundsätze beachten. Dazu gehören kurz gehaltene Zehen- und Fingernägel, gebändigte lange Haare und ein sauberer und geruchsneutraler Körper, der frei von ansteckenden Krankheiten sein muss.
Schmuck, Uhren und Ähnliches nimmt man vor dem Training ab. Kann ein Schmuckstück nicht abgenommen werden, so muss es mit Tape abgeklebt werden, um das Verletzungsrisiko zu senken.
Auf der Matte wird in der Regel barfüßig trainiert. Um keinen Schmutz auf die Matte zu tragen, trägt man außerhalb der Matte immer Schuhe (Tabis, Sandalen oder Badelatschen). Werden Mattenschuhe getragen, sollten diese erst auf der Matte angezogen werden.
Betreten des Dojos oder der Matte
Vor dem Betreten der Matte oder des Dojos verneigt man sich kurz im Stand. Hiermit bringt man zum Ausdruck, dass man diesen Ort des Lernens respektiert und sich seinen Regeln unterordnet. Alle Gedanken und Probleme des Alltags bleiben zurück.
Es sollte selbstverständlich sein, dass Mobilfunkgeräte vor Betreten des Dojo ausgeschaltet werden.
Angrüßen vor und Abgrüßen nach dem Training
Das An- und Abgrüßen wird je nach Stil, Dojo und Anlass unterschiedlich gehandhabt. Fast immer gibt es eine kurze Phase der Stille, in der man sich gedanklich auf das kommende Training, Prüfung oder Wettkampf vorbereitet oder es zum Abschluss noch einmal Revue passieren lässt.
Meistens nehmen die Schüler gegenüber dem Lehrer oder Gastgeber in einer Linie Aufstellung. Der am niedrigsten graduierte Schüler steht dabei aus Sicht der Schüler links, der höchstgraduierte rechts. Es sind aber auch andere Formen denkbar, zum Beispiel eine Aufstellung im Kreis.
Auf ein Zeichen hin knien die Teilnehmer ab und setzen sich auf die Unterschenkel. Der linke Unterschenkel wird zuerst auf den Boden gelegt, dann der rechte. Die Zehen bleiben aufgestellt, bis das Gesäß auf die Fersen abgesenkt ist, und dann gestreckt. Die Hände können auf den Oberschenkeln abgelegt oder im Schoß gefaltet werden.
Zur Konzentration werden die Augen geschlossen, bis die Konzentrationsphase durch ein Kommando (zum Beispiel den Ruf „Re“ oder ein Händeklatschen des Lehrers oder des höchstgraduierten Schülers) beendet wird. Hierauf verbeugen sich Lehrer und Schüler zueinander, wobei die Hände in Dreiecksform aus Daumen und Zeigefinger vor dem Körper auf die Matte gelegt werden.
Das Aufstehen erfolgt dann auf ein erneutes Kommando hin genau in umgekehrter Reihenfolge zum Abknien. Im Stand wird nochmals durch leichtes Verbeugen zwischen Lehrer und Schülern gegrüßt.
Trainingsbeginn
Vor dem Beginn einer Übung verneigen sich die Partner zueinander oder sie klatschen ab. Neben der Respektsbezeugung ist das auch ein Zeichen, dass sich beide nun aufeinander konzentrieren und ganz bei der Sache sind. Nach einer Übung verabschieden sich die Partner auf die gleiche Weise und beenden damit ihre Zusammenarbeit für den Augenblick; beide Partner wissen dann, dass sie nicht mehr mit Aktionen des anderen rechnen müssen.
Die Schüler trainieren immer ruhig, konzentriert, respektvoll und achtsam. Die Sicherheit und Unversehrtheit des Partners hat stets Vorrang. Tempo, Härte und Dynamik werden miteinander abgesprochen. Das Training soll ein Miteinander, kein Gegeneinander sein. Beim Lernen sollen die Partner einander helfen.
Unterhaltungen abseits der Trainingsinhalte sollten unterbleiben. Um sich zu Trainingsinhalten zu verständigen, genügen leise und kurze Erklärungen.
Erscheint ein Schüler zu spät zum Training, so wartet er am Rande der Matte, bis der Trainer ihn bemerkt und meldet sich dann bei ihm an.
Falls ein Teilnehmer das Dojo während des Unterrichts verlassen muss, meldet er sich beim Trainer ab und nach seiner Rückkehr wieder an. Nur so kann dieser seiner Aufsichtspflicht angemessen nachkommen.
GÜRTELBINDEN
Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Budogürtel korrekt zu binden. Eine häufig verwendete Form wird auf den folgenden Bildern erklärt.
Schließe die Jacke, indem Du das linke Revers über das rechte Revers legst. Lege dann ein Gürtelende (1) rechts seitlich an den Bauch. Wie weit hinten Du anfangen musst, hängt von der Gürtellänge ab: je länger der Gürtel ist, desto weiter hinten musst Du anfangen.
Wickle den Gürtel eineinhalbmal gegen den Uhrzeigersinn um den Bauch herum.
Fädele das nun rechte obenliegende Ende (2) unter dem Gürtel von unten nach oben durch und ziehe den Gürtel etwas stramm.
Ziehe das untere Gürtelende (1) unten heraus und halte dann beide Gürtelenden gerade nach vorne, so dass Du sie annähernd gleich lang ziehen kannst.
Damit die Gürtelenden nach dem Binden gleich lang sind, muss in dieser Phase das linke Gürtelende (2) ein wenig länger sein als das rechte (1).
Überkreuze beide Gürtelenden vorne, wobei das linke Ende (2) über dem rechten (1) liegen muss.
Fädele das obere linke Ende (2) von unten nach oben unter dem rechten Gürtelende durch. Du kannst auch mit der rechten Hand durch die Schlaufe greifen und das Gürtelende fassen....
... und beim Rausziehen stramm ziehen.
Die Gürtelenden sollten jetzt gleich lang sein und der Knoten ein Dreieck bilden.
DEUTSCHER JU-JUTSU VERBAND E.V.
Auszug aus der Satzung
(vollständig unter www.ju-jutsu.de)
§ 2 Verbandszweck
(1) Zweck des Verbandes ist die Pflege und Förderung des Sports, insbesondere des Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu und weiterer artverwandter Stilarten, Förderung der Jugend, Förderung der Ju-Jutsu-Landesverbände, der Arbeitsgemeinschaften und Einrichtungen der öffentlichen Dienste (z.B. Polizeien, Justiz, Zoll, Bundeswehr) sowie Schulen, Hochschulen und Universitäten.
(2) Mittel zur Erreichung dieses Zwecks sind die Vermittlung von Selbstverteidigungstechniken, Konzepten zur Selbstbehauptung und Prävention, die Durchführung eines geordneten Sport- und Wettkampfbetriebes [...] und ein Zusammenwirken mit befreundeten, übergeordneten und internationalen Verbänden im Sinne des Amateurgedankens, sowie die Wahrung eines bundeseinheitlichen Prüfungs- und Graduierungswesens.
(3) Der DJJV ist politisch, rassisch und konfessionell neutral. Der DJJV wirkt gemeinsam mit seinen Verbänden und Vereinen gegen Fremdenfeindlichkeit, politischen Extremismus, jede Form von Gewalt und Gewaltverherrlichung.
(4) Der DJJV verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. [...] Der DJJV ist selbstlos im Sinne der Abgabenordnung tätig.
[…]
§ 3 Aufgaben
Die Aufgaben des DJJV erstrecken sich auf alle Belange des Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu und artverwandter Stilarten in der Gesellschaft.
(1) die Erarbeitung und Förderung von Konzep-ten zur Weiterentwicklung des Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu und weiterer artverwandter Stilarten.
(2) die Vermittlung von Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu und artverwandten Stilarten.
(3) die Zusammenarbeit mit staatlichen und vergleichbaren Ausbildungsträgern auf Bundesebene.
(4) die planmäßige Schulung und Weiterbildung von Sportlern, Trainern, Lehrern, Übungsleitern, Kampfrichtern und Funktionären aufgrund der bundeseinheitlichen Ausbildungsrichtlinien.
(5) die Organisation und Durchführung eines geregelten Sportbetriebes und eines bundeseinheitlichen Prüfungs- und Graduierungswesens auf der Grundlage geltender Bestimmungen.
(6) die Mitwirkung und Teilnahme am nationalen und internationalen Sportbetrieb und Ausrichtung entsprechender Sportveranstaltungen.
(7) die Verbreitung der Sportarten Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu und weiterer artverwandter Stilarten in Theorie und Praxis sowie die Darstellung in den Medien.
[…]
(11) die Vertretung des Ju-Jutsu und Jiu-Jitsu und artverwandter Stilarten im gemeinsamen Interesse der Landesverbände gegenüber Dritten.
Mission Statement:
DJJV Mit SICHERHEIT Lebensgefühl
Vision des DJJV:
Der Deutsche Ju-Jutsu Verband schafft durch seine Angebote eine Verbindung zwischen den Werten fernöstlicher Traditionen und dem Lebensgefühl moderner Menschen. Im Mittelpunkt seiner Programmatik steht die Entwicklung der positiven Eigenschaften des Menschen.
Das Leitbild des DJJV e.V.
Ju-Jutsu ist eine der vielseitigsten Sportarten und beinhaltet harmonische Körperentwicklung. Der Deutsche Ju-Jutsu Verband leistet über die vielfältigen Bewegungsangebote seiner Vereine einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit seiner Mitglieder in einem umfassenden Sinn. Ju-Jutsuka sind die Zehnkämpfer fernöstlich tradierter Sportarten.
Die besondere gesellschaftliche Leistung des Ju-Jutsu liegt in der Ausrichtung seiner Übungsformen auf die Selbstverteidigung. Der Deutsche Ju-Jutsu Verband erbringt hierdurch einen unverwechselbaren Beitrag zur Erfüllung des menschlichen Grundbedürfnisses nach Sicherheit und Unversehrtheit.
Von seiner defensiven Ausrichtung her ist Ju-Jutsu eine Sportart, die Frauen in besonderer Weise ansprechen kann. Der Deutsche Ju-Jutsu Verband verfolgt dabei ausdrücklich das Prinzip der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen (Gender Mainstreaming). Er reduziert dieses Anliegen nicht auf statistische Paritäten, sondern verfolgt das Prinzip der Chancengleichheit auch über die konsequente Förderung sportlicher Talente.
Trotz seines Bemühens um die Bewahrung traditioneller Werte bekennt sich der Deutsche Ju-Jutsu Verband zur Strategie eines permanenten und geplanten Wandels. Er verbindet auf diese Weise Erfahrungen und Erkenntnisse der Vergangenheit mit Zukunftsorientierung und stellt die Aktualität seiner Angebote sicher.
Der Deutsche Ju-Jutsu Verband entwickelt seine Leistungspalette, indem er sich am Lebens-gefühl moderner Menschen ausrichtet. Er realisiert dadurch Marketingorientierung und zielgerichtetes Handeln. In diesem Sinn betrachtet er es als permanente Aufgabe, eine gemeinsinnige Verbandskultur zu entwickeln und auszubauen, die ein hohes Maß an mitmenschlicher Orientierung mit einer konsequenten Zielerreichungslogik verbindet. Ein Teil der verbandskulturellen Arbeiten ist die Pflege des Jiu-Jitsu, einer der traditionellen Wurzeln des Deutschen Ju-Jutsu Verbands.
Jugend im DJJV
Die Deutsche Ju-Jutsu Jugend ist die Jugendorganisation des JJ-Sports in Deutschland und des DJJV. Sie wird gebildet durch die Jugendorganisationen der Landesverbände und vertritt die Interessen von jungen JJ-ka bis 21 Jahre in ganz Deutschland. Die Jugend im DJJV ist Mitglied der Deutschen Sportjugend (DSJ) und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe sowie der außerschulischen Jugendbildung.
Aus der Jugendordnung
(vollständig unter www.ju-jutsu.de)
§ 1 Jugend im DJJV
(1.1) Die Jugend im Deutschen Ju-Jutsu Verband e.V. ist die Jugendorganisation innerhalb des Deutschen Ju-Jutsu Verband e.V. (im Folgenden DJJV). Sie bezeichnet sich als „Jugend im Deutschen Ju-Jutsu Verband e.V. (Jugend im DJJV)“.
(1.2) Mitglieder sind die Jugendorganisationen der Mitgliedsverbände (Landesverbände) des DJJV.
(1.3) Die eigenständige Arbeit der Jugend in den Landesverbänden bleibt davon unberührt.
[…]
§ 2 Zweck
[...]
(2.4) Die Jugend im DJJV will junge Menschen zu Toleranz, Eigenverantwortlichkeit und zu sportlicher Fairness führen und damit unter anderem einen aktiven Beitrag zur Integration leisten.
(2.5) Die Jugend im DJJV will durch körperliche, geistige und sittliche Erziehung zur Persönlichkeitsbildung junger Menschen beitragen und dadurch Lebensbejahung und Freiheitsliebe fördern.
(2.6) Die Mittel zum Erreichen dieser Zwecke sind die Weckung des Leistungsstrebens im Breitensport und im sportlichen Wettbewerb sowie die Anleitung zum sozialen Verhalten und gesellschaftlichem Engagement durch sportliche Betätigung und Schaffung von Verbindungen zur Jugend anderer Nationen. Dies geschieht im olympischen Geiste mit dem Ziel der Pflege sportlicher Beziehungen, auf der Grundlage gegenseitiger Achtung und Verständigung.
[…]
Leistungen des DJJV für Vereine, SportlerInnen und die Gesellschaft:
Der DJJV garantiert die Mitgliedschaft im zuständigen Landessportbund (LSB) und im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).
Der DJJV vertritt im DOSB Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu und artverwandte Kampfkünste bzw. Kampfsportarten. International ist der DJJV in die Ju-Jitsu International Federation (JJIF) eingebunden, die als Mitglied der Sportaccord/GAISF und der International World Games Association (IWGA) die weltweite Vertretung sicherstellt. Da es für jede Sportart nur einen Spitzenverband in DOSB und JJIF gibt, hat der DJJV das Alleinvertretungsrecht für JJ in Deutschland.
Mit ca. 52 000 Mitgliedern zählt der DJJV zu den mittelgroßen Verbänden im DOSB. In ca. 1.000 Dojos sind Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu und Bra-zilian Jiu-Jitsu bundesweit im DJJV repräsentiert.
Der DOSB hat nur seinen Spitzenfachverbänden das Aus- und Fortbildungswesen für die jeweilige Sportart übertragen. Diese haben ihre Landesverbände mit der durch die Landessportbünde anerkannten Trainer C, Breiten- und Leistungssport, Aus- und Fortbildung beauftragt. (Trainer C Breitensport wurde vor dem 01.01.2008 Fachübungsleiter C genannt.)
Gerade diese Ausbildungen können nur besucht werden, wenn man über einen Fachverband Mitglied in seinem Landessportbund ist. Hier werden durch die Bundesländer erhebliche Mittel zur Bezuschussung bereitgestellt. Vergleichbare Ausbildungen von kommerziellen Anbietern oder „freien“ Verbänden kosten ein Vielfaches des hier zu entrichtenden Teilnehmerbeitrags zuzüglich der Kosten für Unterbringung und Verpflegung, die auf den Sportschulen fast immer inklusive sind. Die Ausbildung zum Trainer ist eine staatlich anerkannte und geprüfte Lizenz. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit Schulen, öffentlichen Einrichtungen und Trägern der Jugendhilfe.
Über den Spitzenverband DJJV, in Zusammenwirken mit dem DOSB, können die höchsten deutschen Lizenzen für den Breiten- und Leistungssport, die Trainer B- und A-Lizenz, erlangt werden. Ausschließlich die offiziellen Lizenzen berechtigen zur Bezuschussung durch den organisierten Sport.
Wer in diesem System der Aus- und Fortbildung aktiv ist, erkennt automatisch die Rahmenrichtlinien des DOSB an, der die Durchführung nach diesen Qualitätskriterien auch überprüft.
Zusätzlich zu den Trainerlizenzen gibt es im Bereich Gewaltprävention die Lizenzen Kursleiter Frauen SV und Kursleiter „Nicht mit mir!“ (SV für Kinder). Hier werden überprüfte und erprobte Konzepte verwendet und an die Mitglieder des DJJV weitergegeben. Zum Teil werden diese Ausbildungen über die Deutsche Sportjugend durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert, was erst nach eingehender Qualitätskontrolle geschieht.
Die Lehrgänge im DJJV und seinen Landesverbänden und insbesondere das DJJV-Bundesseminar können jedem Vergleich in Qualität und Preis standhalten. Die Kosten für die TeilnehmerInnen liegen weit unter denen vergleichbarer Kampfkunstseminare.
Die Titel im Leistungssport haben eine offizielle, weltweit vergleichbare Wertigkeit. Über die World Games, die offiziellen Weltspiele der nicht bei Olympia vertretenen, aber durch Sportaccord/GAISF und IWGA anerkannten Sportarten, ist der DJJV weltweit vertreten. Diese internationalen Sportorganisationen arbeiten eng mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zusammen, und auch alle olympischen Disziplinen sind Mitglied der Sportaccord/GAISF. Dadurch wird ein Wildwuchs an Titeln verhindert und die Qualität der Wettkämpfe garantiert, was auch regelmäßig überprüft wird. Alle Welt- und Europameistertitel, die nicht in diesen Strukturen errungen worden sind, haben in der offiziellen Sportwelt keinerlei Bedeutung. Auch in den offiziellen, weltweiten Sportorganisationen besteht ein Alleinvertretungsrecht für die jeweilige Sportart. Die Ju-Jitsu International Federation (JJIF) repräsentiert Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu und Ju-Jitsu in den offiziellen weltweiten Sportorganisationen.
Der DJJV hat ein bundesweit einheitliches Prüfungssystem für die Gürtelgrade. Dieses unterliegt einer ständigen Fortentwicklung und wird regelmäßig dem Zeitenwandel angepasst. Diese Graduierungen sind auch durch die JJIF anerkannt. Im internationalen Austausch auf technischen Arbeitstagungen werden die nationalen Standards verglichen, wobei man bisher eine große Ähnlichkeit in den Prüfungsanforderungen feststellen konnte.
Über eine ständig fortgeschriebene Leitbildentwicklung bietet der DJJV eine planbare Sportsteuerung. Die Verbandsvision führt über Missionen zu klar formulierten Zielen. Das Mission Statement „DJJV – Mit SICHERHEIT Lebensgefühl“ ist das plakative Selbstverständnis des Verbandes.
Ju-Jutsu war in Deutschland von Anfang an auch für die Polizei die optimale Selbstverteidigungssportart für ihre Dienstanwendung. Zahlreiche Verbandsmitglieder arbeiten bei den verschiedensten Polizeibehörden, sind dort als Ausbilder tätig und garantieren so einen Realitätsbezug, was die Anwendung der Selbstverteidigung betrifft.
Übermaßverbote ergeben sich aus der deutschen Gesetzgebung. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit sind der Selbstverteidigung Grenzen gesetzt. Unbotmäßige Gewalt ist auch in Notwehrhandlungen bei uns gesellschaftlich nicht akzeptiert.
Der DJJV ist mit diversen Gewaltpräventionsprogrammen Kooperationspartner der Deutschen Sportjugend und bietet die Programme für Schulen, Sportgruppen, etc. an. Dadurch ist er in den Augen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Europäischen Kommission ein freier Träger der Jugendhilfe und berechtigt, staatliche Zuschüsse zu beantragen und zu empfangen. Die Vergabe dieser öffentlichen Mittel wird an strenge Qualitätskriterien geknüpft. Somit ist neben der finanziellen Zuwendung eine solche Anerkennung auch immer ein Gütesiegel für die geleistete Arbeit in der Jugendhilfe.
JJ-WETTKAMPFDISZIPLINEN
Neben der hauptsächlich auf Zweckmäßigkeit beruhenden reinen Selbstverteidigung wird JJ auch in verschiedenen Wettkampfformen ausgeübt.
Im Fighting kämpfen zwei Kontrahenten in ihrer gemeinsamen Gewichtsklasse, ausgestattet mit Hand-, Fuß- und Tiefschutz, gegeneinander. Dies ist ein sportlicher Wettkampf, bei dem im Leichtkontakt Schläge, Tritte und Stöße sowie Hebel-, Wurf-, Halte- und Würgetechniken gemäß der jeweiligen Altersklasse angewendet werden. Der Sportler muss in relativ kurzer Zeit (3 Minuten) seinen Gegner nach Punkten besiegen oder zur Aufgabe zwingen. Das Regelwerk schließt ernsthafte Verletzungen des Gegners weitestgehend aus. Über die Einhaltung der Wettkampfregeln wachen bei jedem Kampf drei Kampfrichter. Die Wettkämpfe sind unterteilt in Gewichtsklassen.
Paarweise wird im Duo gekämpft. Jedes Paar zeigt hochwertige Abwehrkombinationen gegen vorgegebene Angriffe. Die Angriffe werden in vier Gruppen mit jeweils fünf Angriffen gegliedert. Der Verteidiger kann seine Verteidigungstechniken vollkommen frei wählen. Mehrere Kampfrichter bewerten die zur Verteidigung gezeigten Techniken mit Punkten unter anderem nach Haltung, Effektivität, Dynamik, Realität, Kontrolle und Vielfältigkeit. Das Paar mit der höchsten Punktzahl gewinnt und kommt eine Runde weiter, bis das Siegerpaar feststeht. Ein Paar besteht entweder aus zwei Männern, zwei Frauen oder einem Mann und einer Frau (mixed).
Der sportliche Bodenkampf Brazilian Jiu-Jitsu/JJIF Ne-Waza startet im Stand und wird meistens nach einem Wurf oder Übergang zum Boden dort fortgesetzt und beendet. Es gibt Punkte für erfolgreiche Aktionen bzw. erreichte Positionen (z.B. Haltetechniken). Ferner kann ein Kämpfer den anderen durch eine Submission (Kampfaufgabe durch Abklopfen bei Würge- und Hebeltechniken) zur Aufgabe zwingen. Erreicht keiner der Kämpfer innerhalb der Kampfzeit eine Submission des Gegners, dann gewinnt der Kämpfer mit den meisten Punkten, die ein Kampfrichter auf der Matte festgestellt hat.
Die Wettkämpfer im Duo, Fighting und Brazilian Jiu-Jitsu/ JJIF Ne-waza qualifizieren sich zuerst auf der Landesebene und über die Gruppenebene zu den anschließenden Deutschen Meisterschaften. Besonders erfolgreiche Kämpfer erreichen die Europameisterschaften und/oder Weltmeisterschaften, um sich über eine Weltrangliste für die World Games zu qualifizieren.
Als weitere traditionelle Art des Technikvergleichs bietet der DJJV Kata-Wettbewerbe auf nationaler Ebene an. Hier präsentieren Paare unabhängig von Geschlecht traditionell festgelegte Abläufe von Techniken in Angriffen und Verteidigung. Die Wettkämpfer können zwischen den im Jiu-Jitsu Danprüfungsprogramm vorgesehenen Kata wählen:
- Kodokan-Goshin-Jutsu (Form der Selbstverteidigungstechniken)
- Kime-no-kata (Form der Entscheidung)
- Ju-no-kata (Form des Nachgebens / der Geschmeidigkeit)
- Itsutsu-no-kata (Form der Naturgesetze / 5 Symbole)
- Koshiki-no-kata (Form der antiken Techniken)
Die Wertungsrichter vergeben Punkte für Harmonie und Feinheit in den technischen Details, Genauigkeit und Korrektheit der geforderten Abfolgen sowie Flüssigkeit in der Bewegung und Rhythmus des Angreifers und des Verteidigers.
Wettkampferfahrung in jeder der im DJJV angebotenen Disziplinen trägt wesentlich zur Verbesserung des persönlichen Selbstverteidigungsprofils bei.
Die vollständigen Regeln der Wettkampfformen und weitere Informationen findet man im Internet unter www.djjv.de.
Duo-Angriffe
SERIE A: GRIFFATTACKEN
Jedem Angriff muss eine Pre-attack vorausgegangen sein.
Jeder Angriff kann rechts oder links ausgeführt werden. Hände und Griffe müssen geschlossen sein.
Angriff 1: Ein Handgelenk wird mit beiden Händen gefasst
Uke ergreift Toris Arm mit beiden Händen. Eine Hand fasst das Handgelenk, die andere den Unterarm.
Absicht: zu drücken oder zu ziehen, Toris Hand zu kontrollieren oder ihn zu fixieren.
Angriff 2: Einhändiger Griff ins Revers (diagonal)
Uke ergreift ein Revers von Toris Gi mit einer Hand.
Absicht: Tori zu ziehen, zu drücken oder zu fixieren um (theoretisch) danach zu schlagen .
Angriff 3: Würgen mit beiden Händen von vorne oder von hinten
Uke umschließt mit beiden Händen von vorne oder von hinten Toris Hals.
Absicht: zu würgen, dabei Tori nach hinten zu drücken / ziehen oder ihn zu fixieren.
Angriff 4: Würgen von der Seite mit beiden Händen
Uke umschließt von der Seite mit beiden Händen Toris Hals.
Uke kann Tori in die richtige Position bringen oder Tori kann sich selbst in die richtige Position stellen.
Absicht: zu würgen, dabei Tori zu drücken oder ihn zu fixieren.
Angriff 5: Griff in die Jacke (Schulterbereich) einhändig, von der Seite
Uke greift von Toris Seite an dessen Schulter. Hierbei greift er den Gi mit einer Hand. Griffart ist frei wählbar. Uke kann Tori in die richtige Position bringen oder Tori kann sich selbst in die richtige Position stellen.
Absicht: zu drücken, zu ziehen oder zu fixieren.
SERIE B: UMKLAMMERUNGSANGRIFFE
Jedem Angriff muss eine Pre-attack vorausgegangen sein.
Jeder Angriff kann rechts oder links ausgeführt werden.
Hände und Griffe müssen geschlossen sein.
Angriff 1: Umklammerung von vorne unter oder über den Armen
Uke umklammert Tori von vorne unter oder über seinen Armen.
Ukes Kopf liegt auf Toris Schulter und sein Blick ist zur Seite gerichtet.
Bevor der Angriff erfolgt, hält Tori seine Arme in einer natürlichen Position.
Angriff 2: Umklammerung von hinten unter oder über den Armen
Uke umklammert Tori von hinten unter oder über seinen Armen.
Ukes Kopf liegt auf Toris Schulter und sein Blick ist zur Seite gerichtet.
Bevor der Angriff erfolgt, hält Tori seine Arme in einer natürlichen Position.
Angriff 3: Schwitzkasten von der Seite
Uke umklammert Toris Hals mit seinem Arm von der Seite.
Absicht: zu würgen oder eine Wurftechnik anzusetzen.
Angriff 4: Schwitzkasten von vorne
Uke umklammert Toris Hals mit seinem Arm von vorne.
Absicht: zu würgen oder eine Wurftechnik anzusetzen.
Angriff 5: Würgen von hinten mit dem Unterarm (Hadaka-jime)
Uke setzt Hadaka-jime mit seinem Arm an. Uke kann Tori in die richtige Position bringen oder Tori kann sich selbst in die richtige Position drehen.
Absicht: zu würgen oder das Gleichgewicht zu brechen.
SERIE C: SCHLAG-, STOß- UND TRITTANGRIFFE
Jedem Angriff muss eine Pre-attack vorausgegangen sein.
Jeder Angriff kann rechts oder links ausgeführt werden.
Die Angriffe müssen treffen, wenn Tori nicht ausweicht.
Tori muss den Angriff abwarten und darf erst dann reagieren.
Angriff 1: Fauststoß zum Kopf oder zum Körper
Stoß von vorne mit der Faust zum Kopf oder zum Körper (Jodan-tsuki oder Chudan-tsuki)
Ziel: Solar Plexus, Bauch oder Gesicht.
Angriff 2: Aufwärtshaken
Aufwärtshaken mit der Faust (Ago-tsuki).
Ziel: Kinn.
Angriff 3: Schwinger
Halbkreisförmiger Schlag mit der Faust (Mawashi-tsuki).
Ziel: Kopfseite.
Angriff 4: Fußstoß vorwärts
Gerader Stoß vorwärts mit dem Fuß (Mae-geri).
Ziel: Solar Plexus oder Bauch.
Angriff 5: Halbkreisfußtritt vorwärts
Halbkreisförmiger Tritt mit dem Fuß (Mawashi-geri). Tori darf ein Bein zurücksetzen und den Körper leicht eindrehen.
Ziel: Solar Plexus oder Bauch.
SERIE D: WAFFENANGRIFFE
Jedem Angriff muss eine Pre-attack vorausgegangen sein.
Jeder Angriff kann rechts oder links ausgeführt werden.
Die Angriffe müssen treffen, wenn Tori nicht ausweicht.
Tori soll während und nach der Verteidigungshandlung volle Kontrolle über die Waffe haben.
Angriff 1: Messerstich von oben
Messerangriff von oben in Dolchhaltung.
Ziel: seitlicher Halsansatz.
Angriff 2: Messerstich geradlinig zur Körpermitte
Geradliniger Stoß mit dem Messer in Messerhaltung von vorne.
Ziel: Bauch.
Angriff 3: Messerstich von außen oder innen
Halbkreisförmiger horizontaler oder diagonal nach unten verlaufender Messerangriff in Dolchhaltung von außen oder von innen.
Ziel: Körperseite.
Angriff 4: Stockschlag von oben
Stockangriff geradlinig von oben.
Ziel: Oberseite des Kopfes oder Stirn.
Angriff 5: Stockschlag von außen
Stockangriff von außen horizontal oder diagonal von oben nach unten.
Ziel: Schläfe oder Kopfseite.
Der DJJV dankt Jan William Haste für die Bilder zu A4 (Würgen von hinten), B2 (beide Bilder), C2, C3, D3 (beide Bilder), sowie Robert Perc (alle anderen Bilder) für die freundliche Genehmigung zur Nutzung der Illustrationen.
NOTWEHR
Den Begriff „Notwehr“ kennt jedermann. Aber gerade diesem Umstand ist es zu verdanken, dass Notwehr oft falsch angenommen wird, ohne dass die juristischen Voraussetzungen vorliegen, was im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass man sich strafbar macht.
Das Prinzip des Notwehrrechts lässt sich auf zwei Gedanken zurückführen, die anschaulich die Grundlagen der gesetzlichen Regelung darstellen und erklären:
► Individualrechtliche Grundlage: Niemand muss sich gegen seinen Willen verletzen lassen!
► Sozialrechtliche Grundlage: Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen!
Der Gesetzgeber formuliert im Strafgesetzbuch und im Bürgerlichen Gesetzbuch die Notwehr wie folgt:
§ 32 StGB: Notwehr (Nothilfe)
(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.
Vereinfachende Erklärung
...erforderlich... ist diejenige Verteidigung, die eine sofortige Beendigung des Angriffs erwarten lässt. Bei mehreren Möglichkeiten muss man das mildeste Mittel einsetzen, welches geeignet erscheint, den Angriff sicher zu beenden.
...gegenwärtig... bedeutet, dass Notwehr nur möglich ist, solange der Angreifer aktiv ist. Wer erst Hilfe holt oder sich Mut antrinkt, bevor er zurückschlägt, begeht selbst eine Straftat.
...rechtswidrig... bedeutet, dass der Angreifer eine Straftat begeht oder versucht. Da wir diesem Angriff nicht zugestimmt haben, ist dieser rechtswidrig. Handlungen, die zwar einen Angriff darstellen, jedoch gesetzeskonform sind, berechtigen hingegen nicht zur Notwehr (zum Beispiel ist eine Festnahme durch die Polizei in der Regel hinzunehmen). Angriffe können gegen die körperliche Unversehrtheit/Gesundheit (Angriffe durch Schläge, Tritte, etc.), gegen die Freiheit (Festhalten), gegen das Eigentum (eigene Gegenstände), die Ehre (andauernde Beleidigungen) oder gegen das Leben gerichtet sein.
...von sich und anderen... bedeutet, dass man auch anderen Personen, die sich in Not befinden oder sich in Notwehr verteidigen, helfen darf. In der Regel muss man sogar helfen, was jedoch sehr unterschiedlich aussehen kann. Niemand muss sich selbst in Gefahr bringen – Helfen heißt auch Hilfe holen. Einer in Not befindlichen Person mit Selbstverteidigungstechniken zu helfen, ihre Selbstverteidigung wahrzunehmen, nennt man „Nothilfe“.
Die rechtlichen Grundlagen für die Anwendung von Ju-Jutsu und Jiu-Jitsu werden im Training und auf Lehrgängen eingehend behandelt.