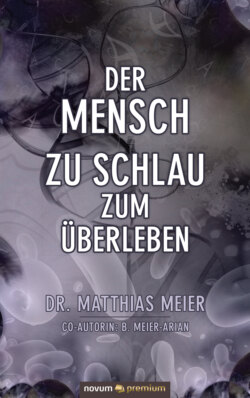Читать книгу Der Mensch – zu schlau zum Überleben - Dr. Matthias Meier - Страница 21
Kapitel 3 Mineralien, die heimlichen Helden Das Wissen um unsere Physiologie hat sich in den letzten Jahrzehnten um ein Vielfaches vermehrt. Die Grundlagen wurden vor allem im 19. Jahrhundert gesetzt, als die technologischen Fortschritte auch die Medizinwelt veränderten. Chemie, Biochemie und Physiologie wurden zunehmend wissenschaftlich methodisch untersucht und erforscht. Die Idee wurde geboren, dass einige Erkrankungen vielleicht nur einen Mangel an irgendeinem vitalen Nährstoff darstellten und der Ersatz des richtigen Elements wieder zur Gesundheit führen würde. Das ist ein gänzlich anderer Ansatz als die Theorie, dass Erkrankungen durch ein „Zuviel“ an äußeren Einflüssen entstehen, beispielsweise Bakterien oder Gifte. 1755 wurde ein Bericht von Gaspar Casal publiziert, der einen Fall von „Pellagra“ beschrieb, damals eine nicht bekannte Erkrankung in Spanien, die durch Hautveränderungen, Durchfall und eine dementielle Entwicklung charakterisiert war, und sich interessanterweise im Frühling deutlich häufte. Die Opfer waren meist arm und ernährten sich von Maismehl/Maisgries ohne Zugang zu Milch oder Fleisch. In Italien wurden ähnliche Berichte öffentlich gemacht, auch hier waren vor allem die Armen betroffen. Zunächst wurde zu viel Mais als Ursache vermutet, da Mais in Europa erst durch die Spanier importiert wurde, nachdem sie Süd- und Mittelamerika kolonialisiert hatten. In diesen Ländern führte der Mais jedoch nicht zu den gleichen Symptomen, obwohl die Landbevölkerung ebenfalls wenig Zugang zu Milch und Fleisch hatte. Der Unterschied wurde in der Verarbeitung des Mais gefunden. Die Mexikaner tränkten den Mais in einer Holzaschenmischung, während die Europäer den Mais zu Polenta verarbeiteten, was zu einer Kontaminierung mit Pilzen oder Toxinen führen konnte. Weitere Theorien kursierten, bis ein Joseph Goldberger in den USA den erkrankten Menschen Milch und Eier verabreichte und damit die Symptome zum Verschwinden brachte9. Dies konnte in verschiedenen Ländern in Europa und in den USA reproduziert und verifiziert werden, sodass klar wurde, dass Pellagra einen Mangel an einem vitalen Nährstoff (Nikotinsäure – Niacin – „Vitamin B3“) darstellte. 9 Joseph Goldberger and Pellagra, M. G. Schultz, The American Society of Tropical Medicine and Hygiene, Volume 26, Issue 5, Part 2, 1 Sep 1977 1849 berichtete Thomas Addison von einer Blutarmut, die „perniziöse Anämie“ genannt wurde und fatal enden konnte. Die roten Blutkörperchen waren reduziert, aber vergrößert. Später wurde Vitamin B12 als das fehlende Element identifiziert, jedoch ist die Aufnahme im Darm nur durch einen im Magen vorkommenden „Intrinsic Factor“ sowie intakte Magensäure möglich, beides Produkte von intaktem Magenzellstoffwechsel. Beriberi war eine nicht selten auftretende Erkrankung in den reishaltigen asiatischen Kulturen im 19. Jahrhundert, die sich durch Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Zittern, Bauchschmerzen, Brennen an den Füßen bis hin zu Lähmungen und Herzinsuffizienz auszeichnen kann. Auf längeren Seereisen erkrankten bis zu 60 % der Crew und 25 % starben. Sowohl Todesfälle als auch das Auftreten der Erkrankung konnten durch das Einführen von Gerste, Milch, Rindfleisch und Tofu gänzlich verhindert werden. Erst wurde gemutmaßt, die Erhöhung der Proteinzufuhr habe den Unterschied ausgemacht. In weiteren Untersuchungen wurde der Zusammenhang zwischen weißem und braunem Reis hergestellt. 70 % von Gefängnisinsassen erkrankten mit weißem Reis als Hauptnahrungsquelle, während nur 3 % der Insassen mit braunem Reis in der Ernährung erkrankten. 1906 fand der norwegische Bakteriologe Axel Holst heraus, dass die Symptome in Hamstern allein durch Füttern von Kohl und Zitronensaft verschwanden. Im gleichen Jahr führte Frederick Gowland Hopkins ein Experiment an Ratten durch mit 2 Gruppen, die verschieden ernährt wurden. Die eine Gruppe erhielt Casein, Fett, Stärke, Zucker und Salz (bis dahin bekannte essenzielle Nährstoffe), die andere Gruppe wurde zusätzlich mit Milch gefüttert. Nur die Gruppe mit Milch Supplementierung gedieh. Daraufhin wurde auch für diese Erkrankung ein fehlender Stoff angenommen. 1912 erforschte Casimir Funk die Stoffe, die für die verschiedenen Erkrankungen als ursächlich in Frage kam, und nannte sie „vitale Amine“. Das Wort Vitamin entstand 1920, als bekannt wurde, dass nicht alle Vitamine Amine enthalten10. Funk konnte die einzelnen Vitamine den verschiedenen Erkrankungen zuordnen, sodass nun die wissenschaftliche Erklärung für die Entstehung von Erkrankungen durch fehlende Nährstoffe gegeben war. Weitere Erkrankungen wie Skorbut (Vitamin C Mangel) und Rachitis (Vitamin D Mangel) konnten nun erklärt werden. Vitamin D Mangel herrschte gerade in den Städten während der Industrialisierung, als Menschen, insbesondere die Armen und Kinder, in Kohlekraftwerken und unter der Erde arbeiten mussten. Vitamin A wurde zunächst als Faktor identifiziert, der die Erkrankung auslöste, jedoch wurde 1922 entdeckt, dass das ursprünglich als Vitamin A bezeichnete Molekül aus einem zweiten Co-Faktor besteht: Vitamin D. 10 Movers and Shakers: A Chronology of Words that shaped Our Age, John Ayfo, p. 54 1922 identifizierten 2 Wissenschaftler von der University of California Vitamin E als Fertilitätsfaktor bei Ratten und benutzten grünes Gemüse und Weizenkeime als Quelle (Evans et al., 1922). Skorbut war eine Epidemie bei den Matrosen, die monatelang ohne frisches Obst oder Gemüse auf hoher See waren. 1919 wurde allgemein akzeptiert, dass ein isolierter Faktor aus Zitrusfrüchten Skorbut heilen konnte. 1932 wurde dieser Faktor als Vitamin C hergestellt und 1933 zu Ascorbinsäure („Anti-Skorbut-Säure“) umbenannt. 1971 empfahl Linus Pauling (doppelter Nobelpreisträger) die Supplementierung von Vitamin C in hohen Dosen, sowohl um Erkältungen als auch Krebs- und Herzerkrankungen vorzubeugen und zu behandeln. Viele Vorteile von Vitamin C wurden seiner Rolle als Cofaktor in der Herstellung von Bindegewebe (Kollagen) zugeschrieben, welches in Knochen-, Haut- und Gefäßstoffwechsel vorkommt. Die Dosis wurde auf 10–12 Gramm pro Tag festgelegt. Um Arteriosklerose (Arterienverkalkung) rückgängig zu machen, empfahl er 3–5 Gramm Vitamin C pro Tag und 2 Gramm L-Lysin pro Tag. Aber er ging noch weiter und empfahl Vitamin C auch zur Krebstherapie. Pauling hielt die für Erwachsene als ausreichend angesehene Dosierung von 50 bis 100 Milligramm pro Tag für zu gering, um eine optimale Wirkung zu entfalten. Seine Ansichten und seine Vitamin C-Studien wurden allerdings von der Wissenschaft nicht ernst genommen, da die von ihm vermuteten Wirkungen in mehreren klinischen Studien nicht nachgewiesen werden konnten. Eine 2015 in der Zeitschrift „Science“ publizierte Untersuchung ließ aber auf Grund neuer molekular-biologischer Befunde vermuten, dass Vitamin C tatsächlich eine anti-tumoröse Wirkung aufweist (1–5). Vor einigen Jahren konnte an der John Hopkins Universität gezeigt werden, dass das Wachstum von Dickdarm Krebszellen (und auch andere Arten) durch Mutationen in zwei Genen getrieben wird, was die Bildung von ungewöhnlich vielen Membrantransportproteinen für Glucose, also Zucker, förderte. Glucose und Glutamin sind die hauptsächlichen Nährstoffe für Krebszellen, daher werden in ihnen auch mehr Transportproteine genau dafür gebraucht. Vitamin C führt in den Zellen zu einer Hemmung des Glucosestoffwechsels, die Krebszellen erleiden sozusagen Hunger, da ihnen die Energiequelle versagt bleibt. Die Gabe von Vitamin C zur Tumortherapie hat eine kontroverse Geschichte. Während in einigen klinischen Studien ein Nutzen nachgewiesen werden konnte, konnte dieser in anderen Studien nicht bestätigt werden11. Diese Diskrepanz kann zumindest teilweise auf die Art der Vitamin C-Zuführung zurückgeführt werden. Bei der oralen Vitamin C-Therapie können im Gegensatz zur parenteralen (in die Venen oder Muskeln gespritzt) Therapie keine für die Krebszellen tödlichen Konzentrationen erreicht werden. Die intravenöse Therapie kann mit Dosierungen von 7,5–45 Gramm pro Infusionen eine deutlich höhere Konzentration im Blut erreichen. 11 Cancer and Vitamin C: a discussion of the nature, causes, prevention, and treatment of cancer with special reference to the value of vitamin C (1979), Cameron, Ewan Pauling, Linus Carl, The National Agricultural Library Es gibt weitere Studien, die nahelegen, dass Vitamin C eine positive Rolle bei Krebserkrankten spielen könnte, bisher wurden die Daten bei Tieren ausgewertet und nicht in die Standards der klinischen Behandlung von Menschen aufgenommen12 13. 12 Vitamin C and cancer prevention: the epidemiologic evidence, G. Block, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 53, Issue 1, January 1991, Pages 270S-282S 13 Vitamin C selectively kills KRAS and BRAF mutant colorectal cancer cells by targeting GAPSH, J. Yun et al, Science 11 Dec 2015, Vol. 350, Issue 6266, pp. 1391–1396 Pauling selbst soll jahrelang 18 Gramm Vitamin C zu sich genommen haben und wurde 93 Jahre alt, er starb allerdings an Krebs. Die Einsicht, dass ein Mangel an einem bestimmten Nährstoff zu einer Erkrankung führen kann, ist seit nun über 100 Jahren bekannt und akzeptiert. Allerdings bilden die Vitamine nur einen Teil der insgesamt 90 essenziellen Nährstoffe für Menschen, die täglich gebraucht werden:
Оглавление1 Vitamine: Vitamin A, B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niacin), B5 (Pantothensäure), B6 (Pyridoxin), B12 (Cyanocobalamin), C, D, E, K, Biotin, Cholin, Flavonoide und Bioflavonoide, Folsäure und Inositol. Weitere essenzielle Nährstoffe sind
2 Aminosäuren: Valin, Lysin, Threonin, Leucin, Isoleucin, Tryptophan, Phenylalanin, Methionin, Histidin, Arginin, Taurin und Tyrosin (die letzten drei werden zwar nicht als essenziell bezeichnet, können aber bei einem Mangel bestimmte Erkrankungen verursachen).
3 Fettsäuren/Cholesterin: Linolsäure, Linolensäure, Arachidonsäure und Cholesterin (Cholesterin kann auch vom Körper hergestellt werden, ein Mangel resultiert einigen Wissenschaftlern zufolge in Alzheimer Demenz, Diabetes mellitus Typ II, erektile Dysfunktion, Burn-out u. a.)