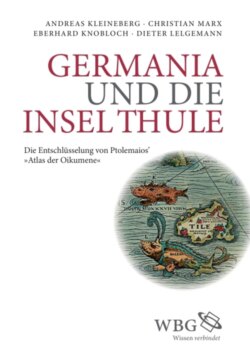Читать книгу Germania und die Insel Thule - Eberhard Knobloch - Страница 10
1.2.1.3 Ptolemaios’ Verfahrensweise zur Ermittlung der geographischen Koordinaten
ОглавлениеIn der Einleitung der ”Geographie“ schreibt Ptolemaios, dass das Ziel seiner Arbeit eine proportionsgenaue Abbildung der oikumene sei. Während er nun die Methoden einer planimetrischen Darstellung der oikumene unter Wahrung der Proportionen auf der Kugeloberfläche der Erde ausführlich beschreibt, bleiben die Verfahren, nach denen er die im Ortskatalog verzeichneten Koordinatenangaben gewonnen hat, weitgehend im Dunkeln. Die Hauptschwierigkeit bestand dabei darin, dass die meisten Materialien, denen Ptolemaios geographische Informationen entnehmen konnte, nicht für wissenschaftliche Zwecke, sondern für praktische Bedürfnisse konzipiert waren, d. h. sie dienten vor allem der Orientierung im militärischen und zivilen Straßen- und Schiffsverkehr. Somit enthielten sie Beschreibungen von Land- und Seerouten, jedoch keine geographischen Koordinaten in Form von Längen- und Breitenangaben. Diese Koordinaten musste Ptolemaios für seinen Ortskatalog in den meisten Fällen also erst ermitteln. Die Darstellung von Verkehrswegen hingegen spielt für ihn keine Rolle.
Zur Ermittlung der Koordinaten ist es, wie Ptolemaios ausführt, zunächst wichtig, durch sichere Beobachtungen gewonnene Daten als themelioi (”Grundpfeiler“) zugrunde zu legen, an die dann die aus anderen Quellen stammenden Daten angepasst werden (GH I, 4, 2). Als derartige themelioi könnten die sog. poleis episēmoi (”bedeutende Städte“) gedient haben, die nicht nur im achten Buch der ”Geographie“ verzeichnet sind, sondern auch in den Procheiroi kanones (”Handtafeln“). Diese Tafeln bilden eine Sammlung von Tabellen mit meist astronomischen Angaben, die allerdings nur in einer Bearbeitung des Theon von Alexandria (4. Jh.) erhalten ist. Jedoch dürften die Koordinaten dieser etwa 360 poleis episēmoi nur zum Teil durch astronomische Messungen bestimmt worden sein (zu den Meßmethoden der Antike s. LELGEMANN 2010, S. 179ff.). Für die außerhalb des römischen Reiches liegenden Städte sind sie sogar unwahrscheinlich. Ferner geht Ptolemaios davon aus, dass die Angaben zu den öfter besuchten Orten wegen ihrer kontinuierlichen und in der Regel übereinstimmenden Übermittlung der Wirklichkeit weitaus näher kommen als die Angaben zu den seltener bereisten Plätzen (GH II, 1, 2).
Obwohl Ptolemaios den durch astronomische Beobachtung gewonnenen Daten gegenüber den Angaben anderer Quellen den Vorrang einräumt, haben ihm also derartige Daten nur für wenige Orte der oikumene vorgelegen. Abgesehen von den erwähnten Einzelkarten und den Verzeichnisse von Orten gleicher geographischer Breite oder gleicher geographischer Länge, die Marinos von Tyros erstellt hat (vgl. 1.2.1.2), enthielten die meisten der von Ptolemaios ausgewerteten Quellen durch terrestrische Verfahren gewonnene Streckenangaben, aus denen Ptolemaios erst mittels mathematischer und sicherlich auch zeichnerischer Verfahren geographische Längen- und Breitenwerte ableiten musste. Dabei können sich mehrere Schwierigkeiten ergeben haben:
Unterschiedliche Maßeinheiten:Entfernungsangaben lagen nicht nur in Stadien vor, sondern auch in Form von Tagesreisen, die in Stadien umgerechnet werden mussten.In den Quellen wurden unterschiedliche Stadienmaße verwendet.Römische Quellen geben Entfernungen in Meilen an, im keltischen Gallien wurde außerdem die Leuga verwendet, Materialien zu entfernten Gebieten können auf anderen Maßeinheiten basieren wie dem indischen Yojana (vgl. HERRMANN, S. 74).
Lagebestimmung mittels Entfernungsangaben:In Itinerarien werden zwar die Entfernungen zwischen den Orten genannt, sie enthalten aber keine Richtungsangaben bzw. Aussagen über die gegenseitige Lage der Orte zueinander.In Itinerarien sind die Entfernungen zwischen den Orten entlang des Straßenverlaufs, nicht als geradlinige Distanzen verzeichnet.
Genauigkeit und Zuverlässigkeit:Die Genauigkeit der Angaben kann in den verwendeten Quellen aufgrund unterschiedlicher Methoden der Raumerfassung variieren.Die Quellen können widersprüchliche oder falsche Angaben zu einem Ort enthalten.In den verwendeten Quellen können bereits Schreibfehler enthalten gewesen sein.
Die Folge davon sind systematische und grobe Fehler in den Koordinaten des ptolemäischen Ortskataloges, welche die Identifizierung der antiken Orte erschweren.
Trotz der beschriebenen Problematik hinsichtlich der ptolemäischen Ortsangaben ist es möglich, einen großen Teil der antiken Orte zu lokalisieren. Dies erfordert jedoch ein interdisziplinäres Vorgehen, denn einerseits müssen die auftretenden Verzerrungen der antiken Koordinaten untersucht werden, wofür in der vorliegenden Arbeit erstmals moderne mathematisch-geodätische Methoden angewendet wurden (vgl. Abschnitt 1.2.2), andererseits gilt es, die Ergebnisse dieser Analyse mit möglichst vielen weiteren Informationen zur Geschichte und Archäologie, aber auch zur Topographie des betreffenden Gebietes zu vergleichen. Hinzu treten ortsnamenkundliche Betrachtungen.
Grundsätzlich gilt die bereits von REISMANN-GRONE (S. 41) getroffene Feststellung hinsichtlich der Identifizierung der ptolemäischen Orte: ”Nach mehreren Fehlschlägen der Deutung schien es richtig, so vorzugehen, wie in der Politik vorzugehen ist, nämlich die Dinge möglichst einfach zu sehen, jede Frage für sich ohne festgelegte Thesen zu behandeln.“ Dies bedeutet, dass jedes Gebiet seine eigene Problematik aufweist und deshalb eine entsprechende Betrachtungsweise erfordert. Dennoch zeigen die bisher durchgeführten Untersuchungen, dass die Ortsangaben des Ptolemaios oft eine bemerkenswert hohe Genauigkeit aufweisen.