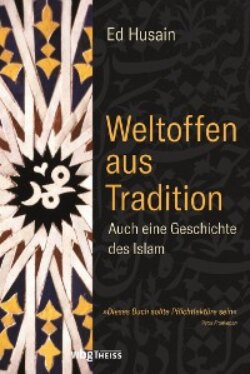Читать книгу Weltoffen aus Tradition - Ed Husain - Страница 12
Kapitel 2 Die Ursprünge des Koran
ОглавлениеAls Mohammed nach Mekka zurückkam, nahm Chadidscha ihn in die Arme.
„Deck mich zu“, flehte er. Trotz der Hitze Arabiens fror er, vom Fieber erhitzt, und stellte sich selbst ernsthaft infrage. War das wirklich Gottes Engel gewesen oder spielte der Teufel ihm einen Streich? Mohammed zweifelte an seinen Erlebnissen, nicht aber seine Frau. Sie war die erste, von der er Zuspruch erhielt. Er schade niemandem, meinte sie, und daher werde ihn auch kein Unheil befallen. Um ihn weiter zu besänftigen, rief sie ihren Cousin herbei, den Christen Waraqa ibn Naufal.
Als Mohammed Waraqa erzählte, was geschehen war, veränderte sich dessen Gesichtsausdruck.
„Er ist es, wahrhaftig. Es ist Gabriel, der Gesandte Gottes an seine Auserwählten.“
Mit der Bestätigung Waraqas, Mohammed sei in der Tat Gottes Prophet, rief Chadidscha an Ort und Stelle aus: „Niemand ist der Verehrung würdig außer Allah, und du, Mohammed, bist Allahs Prophet.“ Es war ungefähr das Jahr 610 und mit diesem kurzen Ausspruch wurde Chadidscha zur ersten Konvertitin des Islam.
Kurz darauf, am selben Tag, verspürte der Prophet, wie die Offenbarung erneut schwer auf ihm lastete. Es war, als drückte ihn ein Gewicht nach unten, und wieder begann er zu rezitieren:
„Oh der du dich bedeckt hast … Erhebe dich und überbringe deine Warnung. Und deinen Herrn, den preise. Und deine Kleider halte unbefleckt. Und meide alle Gräuel. Erwarte beim Spenden keinen Lohn für dich selbst. Stattdessen sei für die Sache deines Herrn beharrlich und geduldig.“1
Auf Arabisch reimen sich diese Verse und treten grammatikalisch in Reinform in Erscheinung. In den nächsten 23 Jahren sprach Gott durch Gabriel in eben dieser poetischen Sprache zu Mohammed. Aus diesen Offenbarungen wurde der Koran, die Heilige Schrift des Islam.
Al-Quran, arabisch für „die Rezitation“, begleitet Muslime durch das Leben. Seine Verse werden Neugeborenen ins Ohr geflüstert. Die kürzeren Abschnitte werden für die täglichen Gebete auswendig gelernt. Bei Hochzeitszeremonien werden Muslimen ihre ehelichen Pflichten im poetischen Arabisch des Koran verlesen. In den letzten Momenten des Lebens spendet das heilige Buch Trost, wenn Familienmitglieder daraus am Totenbett rezitieren. Die meisten Muslime betrachten den Koran als das unmittelbare Wort Gottes, welches dem Propheten offenbart wurde, doch hat es stets Debatten darüber gegeben, ob Gott die Verse tatsächlich ‚sprach‘. Einige Muslime glauben, dass die Melodie des Arabischen von Gott eingegeben und anschließend von Gabriel und dem Propheten artikuliert wurde.
Hatte Mohammed Fragen, erschien Gabriel mit Antworten. Der Koran bildet einen Dialog, ein Gespräch zwischen dem Propheten und Gott. Vers für Vers gibt er wieder, was der Prophet an Offenbarungen von Gabriel verkündete: „Sprich, Er ist Gott, Der Eine und Einzige. Gott, der Ewige, Absolute. Er zeuget nicht, Noch ist Er gezeuget worden. Und niemand ist Ihm gleich.“ (Sure 112)
Auf vielfältige Weise unterscheidet sich der Koran vom Alten und Neuen Testament. Nicht immer ist er thematisch kohärent, sondern springt von einem Sujet zum nächsten in einer Art, die dem unbedarften Leser unzugänglich erscheinen mag. Absätze sind nicht voneinander getrennt, es gibt keine festgelegten Satzanfänge oder logischen Schlusspunkte. Am nächsten kommen dem vielleicht die biblischen Bücher der Propheten, wie zum Beispiel das Buch Jesaja.
Diesen Kontext zu fassen, gestaltet sich für diejenigen schwierig, die noch nie mit etwas Derartigem konfrontiert waren. Im 8. Jahrhundert spottete Johannes von Damaskus, einer der wenigen Chronisten und Augenzeugen des frühen Islam, über den Koran und warf den Muslimen vor, bloß Geschichten von nicht-orthodoxen Christen zu sammeln. Tausend Jahre später tat der französische Aufklärer Voltaire den Koran als unwissenschaftlich und voll von Widersprüchen ab. Der schottische Denker Thomas Carlyle, der den Propheten als einen der „großen Männer“ verehrte, die Geschichte machten, hatte ebenfalls seine Schwierigkeiten mit dem Koran. Für ihn war er „mühsame Lektüre“, „unausstehliche Albernheit“ und ein „lästiges verworrenes Durcheinander, roh, wüst; endlose Wiederholungen, Weitschweifigkeit, Verstrickungen“.2 Trotz seines mangelnden Verständnisses stellte er fest, „Aufrichtigkeit, in jedem Sinne, scheint mir das Verdienst des Koran“.3 Carlyle las den Koran auf Englisch, ihm entging daher der poetische Reichtum des Arabischen, nichtsdestotrotz erfasste er die Wahrhaftigkeit des Propheten.
Napoleon sammelte Koranmanuskripte in Kairo, als er 1798 in Ägypten einfiel, und schickte die arabischen Originale nach Frankreich. Die Wörter haben sich nie verändert. Es gibt nicht wie von der Bibel eine ‚King-James-Version‘ beziehungsweise eine eigene Fassung des osmanischen Sultans alternativ zum arabischen Text. Sunniten und Schiiten, in so vielen Fragen gespalten, sind sich im Koran allesamt einig. Die Spezialisten der Universität Birmingham haben das von Napoleon beschaffte Material aus dem 18. Jahrhundert eingehend untersucht. Sie datieren die Koranmanuskripte ins 7. Jahrhundert, auf die Zeit dreizehn Jahre nach dem Tod des Propheten. Mohammeds enger Vertrauter Amr ibn al-ʿAs, der Eroberer Ägyptens, hatte die Koranausgaben höchstwahrscheinlich aus Medina mitgebracht, jener Stadt, in der sich der Prophet niedergelassen hatte und wirkte. Für Muslime kommen die Erkenntnisse aus Birmingham weder überraschend, noch dienen sie ihnen als neuerlicher Beweis. Denn von Anfang an haben sie keinerlei Zweifel daran gehegt.
Der Koran, so glauben die Muslime, entstand aus dem Wunder, das Gott auf den Propheten Mohammed herabsandte, im Zusammenspiel mit einer Gesellschaft, die ganz in der Kunst des Wortspiels und der Poesie aufging. Ebenso wie Moses die Magier des Pharaos ausstach und Jesus die Heiler von Jerusalem übertraf, so stellte Mohammed die Dichter Mekkas in den Schatten. Niemand war in der Lage, vergleichbare Verse hervorzubringen. Vierzehn Jahrhunderte später sind sie noch immer unübertroffen. Von den ersten Gläubigen auswendig gelernt, von den Gefährten des Propheten, den ersten Muslimen, auf Pergament und Papier niedergeschrieben, behielt der Koran seine Form seit der Zeit des Propheten unverändert bei.
Gewalttätige Extremisten berufen sich heutzutage im Namen ihrer Sache auf den Koran, doch für die meisten Muslime ist ihr heiliges Buch alles andere als ein Zeugnis von Gewalt. Außer einer beginnen alle 114 Kapitel mit „Bismillahi al-Rahman al-Rahim – Im Namen Gottes, des Barmherzigsten, des Gnädigsten“. Dieser tägliche Ausspruch, der an die Gnade und Barmherzigkeit Gottes erinnert, soll sich im Verhalten des Gläubigen spiegeln. Ein beliebter Abschnitt des Koran heißt al-Rahman, der Barmherzigste, aber keine der Kapitelüberschriften beschwört Krieg, Gewalt, Kampf oder das Töten. In Wirklichkeit machte der Prophet sogar mit der Abschaffung der unter den Arabern bei ihren Neugeborenen verbreiteten Namensgebung harb, was „Krieg“ bedeutet, von sich reden. Das Hauptanliegen des Koran spiegelt den Charakter und die Berufung des Propheten wider: freundlich und barmherzig zu sein. Über den Propheten sagt der Koran aus: „Wir entsandten dich allein als Barmherzigkeit für alle Geschöpfe.“ (Sure 21:107) In einem Zeitalter, das von Krieg und Feindschaft zwischen den Stämmen geprägt war, rief der Koran zum Frieden auf.
Die 6236 Verse des Koran sind grob in zwei Teile aufgeteilt: Jene Kapitel, die dem Propheten in Mekka offenbart wurden, und in der Folge des Jahres 622 dann jene, die ihm in Medina eingegeben wurden. Die mekkanischen Abschnitte sind reich an Vergleichen, Allegorien und erhabener Prosa, welche die Herrlichkeit des Jenseits wachrufen, jene vortreffliche Belohnung für die Versuchungen und Entbehrungen in dieser Welt. Im Vergleich dazu beziehen sich die Passagen aus Medina auf die Umstände und Bedingungen in dem Stadtstaat, dem der Prophet fortan als weltliches Oberhaupt vorstand.
Auf diesen Kontext der einzelnen Kapitel im Koran beziehen sich die muslimischen Gelehrten mit dem Begriff asbab al-nuzul: die Gründe der Offenbarung. In der Vergangenheit hätte ein Muslim niemals auf die Bedeutung von Versen geschlossen, ohne vorher einen Gelehrten hinsichtlich der Motive und Gründe des jeweiligen Abschnitts zu konsultieren. Diese Vorgehensweise verändert sich im Informationszeitalter zunehmend, da Google ebenso wie frei zugängliche Bücher den Einzelnen genauso gut dazu in die Lage versetzen. Der Koran wird, wie andere Bücher auch, zu einem Handbuch. Genau genommen geht der Kontext des Koran verloren, weil jeder Gläubige direkt auf den Text zugreifen und zum ‚Experten‘ werden kann. Sich mit einer solch modernen Unbedarftheit Zugang zur Schrift zu verschaffen, höhlt den einstmaligen Respekt vollkommen aus.
Meine Eltern haben mir beigebracht, dass der Koran stets auf das oberste Regal gelegt gehört, gerade außerhalb der Griffweite. Zu Hause war unser Koran in teurem Samt eingeschlagen. Meine Eltern waren fromme Muslime und die Ehrerbietung, die sie dem Koran sowohl als handfestem Buch als auch der darin enthaltenen Botschaft entgegenbrachten, war die gelebte Realität eines Islam, der auf das Leben der Gläubigen großen Einfluss hatte. Vor kurzem erzählte mir Erzbischof Justin Welby in einem Gespräch, wie sehr er die älteren Muslime, die er in abgeschiedenen Gegenden Afrikas kennengelernt hatte, dafür bewundere, wie sie diesen Brauch bis heute pflegten. Um die gleiche Verehrung des Göttlichen zum Ausdruck zu bringen, so sagte der Erzbischof mir, habe er sich angewöhnt, seine Bibel nun ebenfalls auf das oberste Regalbrett zu legen.
In gewisser Weise verkörpert dieses Wechselspiel von innerer Überzeugung und äußerer Hingabe die zentrale Botschaft des Koran. In dem heiligen Buch wird der Glaube selten ohne den Bezug auf gute Taten erwähnt. Zu den größten und frühesten Kommentatoren gehören Imam Ali (gest. 661) sowie Dschaʿfar al-Sadiq (gest. 675). Beide betonten die vielfältigen Bedeutungen des Koran und warnten davor, den Text wortwörtlich zu nehmen und die darin verfügten Bestimmungen buchstabengetreu umzusetzen. Ebenso wie Gott zahir und batin, außen und innen zugleich, sei, so habe Sein Buch innen- und außenliegende Bedeutungen. Dieser Aspekt des historisch betrachtet mehrdimensionalen Koran kommt vielen Muslimen langsam abhanden. Das Haus des Islam verliert seine Verbundenheit mit dem Koran.