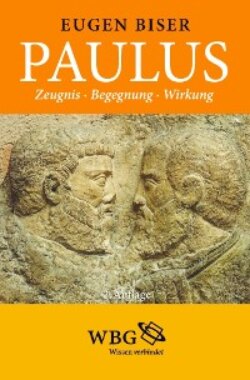Читать книгу Paulus - Eugen Biser - Страница 17
Der Inbesitz
ОглавлениеWas Paulus mit dem Bildwort vom Schatz im Tongefäß umschreibt, bringt er in Gedanken an das von ihm durchlittene Lebensdrama nochmals mit dem bekenntnishaften Wort zur Ausdruck:
Wenn unser äußerer Mensch auch aufgerieben wird, erneuert sich doch unser innerer von Tag zu Tag (2Kor 4, 16)83.
Das ist so sehr aus existentieller Erfahrung gesprochen, dass sich die Hypothese einer „Übernahme der Metapher vom inneren Menschen“ aus platonischer Tradition (Heckel) auf den Gedanken einer allenfalls verbalen Anleihe reduziert84. Hier gilt dasselbe wie im Fall der Anrufung Gottes durch Jesus mit der ehrfürchtig-kindlichen Anrede „Abba–Vater“, die unbestreitbar eine Reihe von Entsprechungen in der alttestamentlichen Gebetssprache hat und dennoch in seinem Mund die Qualität einer geradezu revolutionären Innovation gewinnt. Die Analogie beweist keine Genealogie. Bei Paulus ist die Rede vom „inneren Menschen“ eben nicht Ausdruck einer Selbstwahrnehmung im Gefolge des Aufstiegs zum Ideenhimmel, sondern Bezeichnung des „Innenraums“, der in ihm durch den göttlichen „Einbruch“ bei seinem Damaskuserlebnis aufgestoßen wurde. Damit ihm der Gottessohn ins Herz gesprochen werden konnte (Gal 1, 16), bedurfte es der „Eröffnung“, die für ihn gleichbedeutend war mit dem Empfang des neuen Lebensinhaltes im Gefolge des himmlischen Zuspruchs. Gleichwohl bezeichnet der „innere Mensch“ bei ihm mehr noch den Ort der Auf- und Entgegennahme des empfangenen Inhalts als diesen selbst, dies jedoch so, dass beide nicht adäquat voneinander unterschieden werden können. Doch was ist mit dem in ihm verborgenen „Schatz“ gemeint?
Bei dieser Ausdrucksweise dürfte es sich um einen der relativ seltenen Fälle handeln, bei denen die Bildsprache Jesu auf seine Sprachwelt durchschlägt. Denn auch Jesus gebraucht im Gleichnis vom glücklichen Schatzfinder (Mt 13, 44) dieselbe Metapher, und zwar als Verbildlichung seines Zentralanliegens, des mit und in ihm anbrechenden Gottesreichs. Der Rückbezug zu Paulus wird noch stärker, wenn man sich mit einer auf Origenes, vermutlich sogar auf Markion zurückgehenden Tradition vergegenwärtigt, dass „Reich Gottes“ als die soziale Selbstdarstellung Jesu zu gelten hat und deshalb mit ihm und seinem Heilswirken identisch ist85. Dann wird deutlich, dass mit dem „Schatz“ der ihm zugesprochene Gottessohn gemeint ist, der in seinem „inneren Menschen“ Wohnung nimmt, um dort, wie er im Galaterbrief versichert, den Herzens- und Identitätstausch mit ihm zu vollziehen.
Was es mit der „Eröffnung“ auf sich hat, wird höchst beziehungsreich in den Briefen deutlich, die sein Damaskuserlebnis bezeugen. Noch am wenigsten gilt das von seinem akustischen Zeugnis, da der es beinhaltende Galaterbrief weithin auf einen polemischen Grundton gestimmt ist, der die dafür erforderliche Stimmung nicht aufkommen lässt. Wenn er jedoch darüber Klage führt, dass er nicht bei den angefochtenen Adressaten sein könne, um ihnen „mit anderer Stimme“ zuzureden, und ihnen gesteht, dass er „nochmals um sie Geburtswehen“ erleide (Gal 4, 19f.), wird etwas von der „Seinserweiterung“ deutlich, die auf die gesuchte Spur führt. Fündig wird man dann umso mehr in der Korrespondenz mit Korinth und Philippi. Dort im Zusammenhang mit dem optischen Osterzeugnis (2Kor 4, 6), wenn Paulus erklärt:
Unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden; denn ihr habt keinen engen Raum in uns (2Kor 6, 11f.),
und wenn er dem mit dem für seinen Zug zur Ekstase aufschlussreichen Geständnis vorgreift:
Sind wir von Sinnen gekommen, so geschah es für Gott; redeten wir vernünftig, so geschah es für euch (2Kor 5, 13)86.
Das steigert sich im Fortgang des Briefes zu der für den Sozialbezug des Apostels höchst beredten Zusicherung:
Gebt uns Raum! Niemandem haben wir Unrecht getan, niemanden zugrunde gerichtet, niemanden übervorteilt. Das sage ich nicht, um zu verurteilen, da ich euch doch erklärt habe, dass ihr in unseren Herzen wohnt, mit uns auf Leben und Tod verbunden (2Kor 7, 2f.).
Im Philipperbrief, der sein haptisches Ostererlebnis enthält (Phil 3, 12), entspricht dem das von dem innigen Verhältnis zu seiner Lieblingsgemeinde eingegebene Eingangswort:
Gott ist mein Zeuge, dass ich mich im Herzen Christi nach euch sehne (Phil 1, 8).
Indessen überschreitet diese Stelle die vorige dadurch, dass sie den „geweiteten“ Sozialbezug auf das Intimverhältnis Pauli zu Christus zurückführt. Dass der Apostel fähig war, die Gemeinde in sein Selbstverhältnis einzubeziehen, hatte seinen Grund darin, dass er sich selbst in das „Herz Christi“ aufgenommen und darin über jede subjektive Identifikation hinaus zu sich selbst gebracht wusste87. Doch damit hatte auch schon die exzeptionelle, zur durchschnittlichen gegensinnig verlaufende Identitätsfindung Jesu auf ihn übergegriffen. Denn der, der (nach Mk 10, 45) nicht gekommen ist, „um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen“, findet seine Identität nicht in Akten der Abgrenzung und Unterscheidung, sondern in Erweisen der Selbstübereignung und Hingabe. Indem er andern, mit Kierkegaard gesprochen, zum Helfer zur Selbsthilfe wird, findet er in ihnen zu sich selbst88. In diesen Kreislauf wurde Paulus einbezogen; und im Maß, wie er darin zu sich selbst gelangte, entstand in ihm jene kristallene Mitte, die er als den aus seiner Zerbrechlichkeit hervorleuchtenden Schatz empfand.
Der von dem glücklichen Schatzgräber Paulus ans Licht gehobene Fund besteht somit in seinem (nach 2Kor 5, 13; 6, 11f.; 7, 2f.) emphatisch umkreisten und dadurch gegen alle Irritationen gewahrten Inbesitz, der seinerseits nur durch die ihn überwältigende Einwohnung Christi zustande gekommen war. Dass dieser Inbesitz einer Selbstvergegenwärtigung des Apostels gleichkam, wird an einer der prekärsten, auf die Ächtung des korinthischen Blutschänders bezogenen Stellen der Paulusbriefe deutlich, zu der sich der Apostel mit den Worten erhebt:
Was mich betrifft, so habe ich, obwohl dem Leib nach abwesend, im Geist jedoch anwesend, das Urteil über den, der das getan hat, bereits gesprochen, ganz so, als wäre ich persönlich anwesend. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus sollt ihr euch, zusammen mit meinem Geist und der Kraft unseres Herrn Jesus Christus, versammeln und diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist am Tag des Herrn gerettet werde (1Kor 5, 3ff.)89.
Sosehr diese exorbitante Positionierung der wiederholt bekundeten „Milde“ (1Kor 4, 21) und Rücksichtnahme (2Kor 11, 29) des Apostels widerspricht, weckt sie doch gleichzeitig die Erinnerung an seine Himmelsreise (12, 2f.), die in vertikaler Richtung dieselbe Selbstüberschreitung imaginiert, die Paulus hier in horizontalem Sinn vollzieht. Beides aber setzt voraus, dass er sich auf exzeptionelle Weise zu sich selbst gebracht weiß und dass er gerade in der Erweiterung seines Individuationsraumes zum Besitz seiner selbst gelangte.