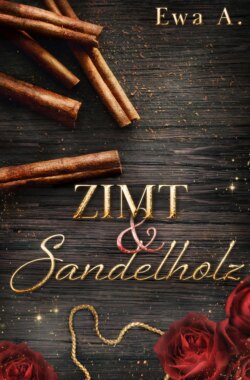Читать книгу Zimt und Sandelholz - Ewa A. - Страница 9
6. Absichtliche Verletzungen
ОглавлениеNichts als Finsternis umgibt mich - ein Gespinst, gewoben aus alptraumhafter Schwärze. Sie legt sich auf meine Seele - lässt mir kaum Luft zu atmen. Und doch weiß ich genau, wo ich bin und was geschehen wird, weil es nämlich immer geschieht. Immer und immer wieder.
Ich schaue an mir hinab und kann das, was nur ein Träumer vermag: Trotz der Dunkelheit, die um mich herrscht, sehe ich, dass ich wieder das gleiche Nachthemd trage, wie jedes Mal in meinem Traum. Und wie jedes Mal bin ich jung - ein kleines Mädchen. Mein Körper ist schmächtig und meine zierlichen Füße sind nackt. Es ist kalt. Ein Frösteln überzieht mich und meine Glieder beginnen, ungewollt zu zittern. Um mich warmzuhalten presse ich die Arme an meine Brust. Doch es hilft weder gegen die Kälte noch gegen die Angst, die mich überfällt.
Ich kann den Teppich weich unter meinen Zehen spüren. Obwohl es mich erschreckt, weil es sich stets gleich anfühlt, beruhigt mich auch diese Vertrautheit.
Fortwährend ist es dasselbe: Ich finde mich in der Dunkelheit wieder, die sich früher oder später zum Flur, im Haus meiner Eltern transformiert. Denn egal, ob ich stehenbleibe oder gehe, egal, für welche Richtung ich mich entscheide, irgendwann taucht hinter mir dieses altbekannte Flurfenster auf und vor mir der leuchtende Türspalt. So absehbar, so beständig, wie das Ticken eines Uhrwerks, schreitet der Traum voran.
Immer wird die Dunkelheit zu einem Sumpf, der vom Scheitel bis zu den Fußsohlen an mir zerrt. Immer muss ich mit dem gesamten Körper durch ihn hindurch waten.
Mit diesem Wissen, das meinen Magen in einen Klumpen Blei verwandelt, setze ich einen Fuß vor den anderen und begebe mich in die Lichtlosigkeit. Schlagartig erblinde ich und der schwarze Morast versucht, mich zurückzuhalten. Doch ich kämpfe dagegen an. Trotz meiner Furcht, trotz der Tränen, die in mir aufsteigen, strebe ich weiter in die Düsternis hinein. Beharrlich wühle ich mir einen Weg durch sie hindurch, werde schneller und schneller in der Hoffnung, mein Ziel zu erreichen. Bald erscheint der blendende Spalt in der Ferne und als ich einen Blick über die Schulter werfe, erkenne ich das Flurfenster. Wieder schaue ich nach vorn, suche den schmalen Lichtstreifen, renne und renne. Denn vielleicht schaffe ich es diesmal, die Tür zu erreichen. Aber jäh muss ich wieder einmal einsehen, dass es mir nicht gelingen wird. Wie immer. Die Tür bleibt ein unerreichbares Ziel in weiter Ferne. Ganz gleich, wie sehr ich mich bemühe, danach sehne, die Entfernung wird und wird nicht geringer. Hoffnungslos. Zutiefst verzweifelt bleibe ich eine Gefangene der Dunkelheit in einem ewig wiederkehrenden Traum des Versagens.
Hastig schloss ich die Badezimmertür hinter mir. Mit der Messingklinke in der Hand verharrte ich an Ort und Stelle im dämmrigen Flur. Es war kurz nach sieben Uhr morgens und ich war froh, dass die Lampe brannte, auch wenn sie nur wenig Licht abgab. Ich atmete tief durch. Endlich bekam ich wieder genügend Luft in meine Lungenflügel. Eine ungeahnte Erleichterung stellte sich ein.
Warum bereitete mir das Badezimmer ein solches Unwohlsein? Weshalb glaubte ich, in dem Raum keine Luft zu bekommen? Oder bildete ich mir das bloß ein? Machte lediglich mein Kreislauf schlapp? Aber wieso überkamen mich diese Erstickungsängste ausgerechnet jedes Mal an diesem Ort? Ich hatte dieses Bad früher schon nicht gemocht. Allerdings konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, was zu dieser Abneigung geführt hatte. Vielleicht gab es dafür gar keinen Grund, wie es auch keinen dafür gab, dass mir Wasser unangenehm war. Möglicherweise hielt ich mich beide Male nur rein zufällig im Bad auf, als die Atemnöte einsetzten. Das fehlte mir noch. Als wären die vergangenen Nächte mit dem ewig gleichen Traum nicht beunruhigend genug gewesen, musste nun auch noch mein Körper streiken. Seit ich beschlossen hatte, zu meiner Mutter zurückzukehren, suchte er mich öfter und viel intensiver heim als jemals zuvor. Der Traum hatte mich schon immer verängstigt, doch letzte Nacht erreichte meine Furcht ein neues Level. Schweißgebadet war ich im Bett aufgeschreckt und hatte im ersten Moment nicht gewusst, ob ich schlief oder wach war. Erst, nachdem ich Joans grau-schwarze Silhouette im Dunkeln neben mir bemerkt und ihre regelmäßigen Atemzüge gehört hatte, wurde mir klar, dass es real war. Was war nur mit mir los?
Nachdenklich strich ich mir die losgelösten Strähnen aus der Stirn und überprüfte automatisch gleich den Sitz meiner Frisur. Ich schüttelte den Kopf, um die trüben Gedanken zu vertreiben, und machte mich auf den Weg zur Küche ins Untergeschoss.
Da ich vermutete, dass Joan mittlerweile mit ihrem Outfit zufrieden sein würde und wir gleich zur Schule fahren konnten, öffnete ich schwungvoll die Türe. Die Synthesizer von OMDs Maid of Orleans dröhnten mir entgegen. Meine Tochter saß bereits tatsächlich am Küchentisch und bewegte zur Melodie den Kopf im Takt. Allerdings war sie nicht allein. Lennhart Karlson lehnte wie selbstverständlich am Küchenschrank, wippte rhythmisch mit einem Fuß und hielt eine Tasse in den Händen. Offenbar trank er den Kaffee, den ich zuvor aufgesetzt hatte. Abrupt stoppte ich meine Bewegung.
Er hatte sein verrissenes Hemd vom Vortag gegen einen abgetragenen Norweger-Pulli und seine löchrige Jeans gegen eine mit Farben besprenkelte eingetauscht. Zwar wirkte er darin einen Tick gepflegter, aber immer noch wie ein skandinavischer Blockhüttenbewohner, der weder Schere noch Rasierklinge kannte, sondern sich als Maler versucht hatte. Mir fielen seine feuchten Haarsträhnen auf, die sich aus seinem Zopf gelöst hatten und ihm ins Gesicht baumelten. Daraus folgerte ich, dass er sich zumindest wusch. Auch sein Parfum, der zitronenartige Pfeffer, schwebte wieder in der Luft und übertrumpfte sogar das Aroma des Kaffees, was auf ein gewisses Maß an Körperpflege hinwies.
»Nanu, was ist denn mit Ihnen passiert? Haben Sie Ihr Kostüm verlegt und den Lockenstab nicht gefunden?« Lennharts übertrieben gespielte Verwunderung, die sich in seinen erhobenen Augenbrauen darstellte, wischte mir nachhaltig das Lächeln aus dem Gesicht. Erneut musterte er mich vom Scheitel bis zur Sohle.
War ja klar, dass von ihm ein doofer Kommentar zu meinem Aussehen kommen musste. Als dürfte nur er salopp in Jeans und mit einem Pferdeschwanz herumlaufen.
Zynisch feixte ich ihm zu. »Anscheinend genauso, wie Sie Ihre Manieren verloren haben. Guten Morgen. Was wollen Sie eigentlich um diese Uhrzeit schon wieder hier? Haben Sie kein eigenes Zuhause, wo Sie Ihren Kaffee trinken können?«
Mit hocherhobenem Haupt schritt ich an ihm vorbei, behielt in jedoch heimlich im Blick. Denn seine bloße Anwesenheit machte mich sowohl unsicher als auch wütend. Einer von Lennharts Mundwinkeln verzog sich auf verächtliche Weise.
»Guten Morgen, Frau Vanderblant. Tut mir ehrlich leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich bin nicht wegen Ihnen hier. Ich hole Sophie ab. Wie immer.« Zögernd fügte er hinzu: »Und, haben Sie sich heute schon auf die Fliesen gelegt?«
»Haha, sehr witzig, Herr Karlson«, keifte ich zurück. »Nein, schließlich waren Sie nicht in meiner Nähe, um mich galant durch die Gegend schleifen zu können.« Neugierig geworden, wegen seines geheimnistuerischen Hinweises, konnte ich mir nicht verkneifen, nachzuhaken. »Sie holen meine Mutter ab? Weshalb?«
Während sich Lennhart einen extra langen Schluck aus der Tasse genehmigte, vermutlich bloß, um mich zu ärgern, wandte ich mich letztlich an Joan, die unsere Unterhaltung stumm verfolgt hatte. »Bist du eigentlich soweit?«
»Ja«, erwiderte sie und erhob sich mit einem Seufzer. Sie griff nach ihrer Schultasche und ich wartete, innerlich wutschnaubend, auf Lennharts Antwort. Er ließ sich Zeit und rührte behäbig den Löffel in seiner Tasse herum.
»Och, ich fahr sie zur Krankengymnastik.« Seine Blicke, die zuvor noch den Löffel in seiner Tasse verfolgt hatten, trafen mich nun mit eisiger Wucht. »Wie ich es jede Woche tue, was Sie wüssten, wenn Sie sich nur ein kleines Bisschen um Ihre Mutter gekümmert hätten. Aber das war wohl zu viel verlangt, von einer Anwalts-Ehefrau, die von einer Party zur anderen eilen muss.«
Der Stich saß und im ersten Moment wunderte ich mich über den Schmerz, den meine Brust traf. Ich schluckte und sog tief die Luft ein. Meine Stimme bebte. »Anscheinend ist es auch für einen Schmarotzer, wie Sie einer sind, zu viel verlangt, seinen Kaffee in den eigenen vier Wänden zu trinken.«
»Was redest du da für einen Unsinn?«, donnerte es plötzlich von der Tür her. Es war meine Mutter, die mit einem Stock herein gehumpelt kam und mich finster anstarrte. »Eine Tasse Kaffee ist das Mindeste, das du Lenn anbieten solltest. Letztlich kostet es ihn Zeit und Benzin, mich zu meinen Terminen zu fahren.« Leise krächzend fuhr sie fort. »Verstehe gar nicht, wie du so kleinlich sein kannst. Sonst bist du ja recht freizügig mit deinen Angeboten.«
Und auch diese Stiche verfehlten weder Ziel noch Wirkung. Tapfer überging ich die verletzenden Angriffe meiner Mutter und Lennharts hämisches Grinsen.
Um die Situation nicht eskalieren zu lassen, versuchte ich, keinen vorwurfsvollen Ton anzuschlagen. »Warum hast du mir nicht gestern beim Abendessen gesagt, dass du zur Krankengymnastik musst?«
Geschäftig begann sie, das benutzte Geschirr vom Tisch zur Spüle zu räumen. »Ich habe es vergessen.«
Sie wusste es und ich wusste es: Es war eine Lüge. Denn den ganzen Abend hatte ich mich bemüht, mit ihr ins Gespräch zu kommen, etwas über ihr jetziges Leben zu erfahren. Doch egal, was ich probiert hatte, andauernd ließ sie mich abblitzen. Stets hielt sie Joan und mich auf Distanz. Selbst als ich ihr beim Zubereiten des Abendbrots zur Hand hatte gehen wollen, um das Eis zu brechen, erhob sie Einwände. Zwar hatte ich mich über diese hinweggesetzt, jedoch nichts dadurch erreicht. Sie blieb wortkarg, sowohl in der Küche als auch beim Essen. Nachdem wir gemeinsam den Tisch abgeräumt hatten, verbarrikadierte sie sich im Wohnzimmer. Allerdings wies sie uns zuvor unumwunden darauf hin, dass jener Raum seit ihrem Schlaganfall ihr Schlafzimmer und für uns somit Sperrbezirk sei. Mir war klar, dass dieser Umstand und vor allem unsere Anwesenheit nicht leicht für sie waren. Deswegen trat ich nun an sie heran und erwiderte mit so viel Güte, wie mir möglich war: »Mutter, ich kann dich fahren. Ich mach das gern, wirklich. Wir bringen erst Joan zur Schule und dann ...«
»Denk doch erstmal nach, bevor du redest«, fuhr sie mir über den Mund. »Ich habe um acht Uhr meinen Termin bei der Krankengymnastik, danach muss ich zum Arzt, anschließend zur Apotheke und dann noch den wöchentlichen Einkauf erledigen. Wie willst du das alles bewältigen, wenn du Joan erst in der Schule anmelden und hinterher auf Jobsuche gehen musst.« Mit abweisender Miene schüttelte sie den Kopf. »Nein, mach dir bloß keine Mühe. Ich habe deine Hilfe bis jetzt nicht gebraucht und werde sie auch in Zukunft nicht brauchen.«
In meinem Hals schwoll schlagartig ein Kloß an und in meinen Augen drängelten sich Tränen. »Gut, wie du meinst«, japste ich und schaute fahrig umher. »Joan, komm. Es wird Zeit.«
Hastig verließ ich mit meiner Tochter die Küche und vermied jeglichen Blick auf meine Mutter und Lenn. Ich wollte nur noch flüchten. Vor ihrem Hass. Ihren Worten. Und ihr.