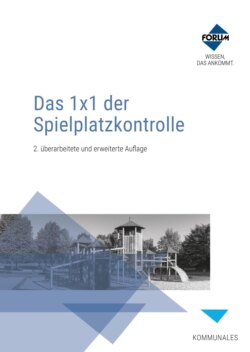Читать книгу Das 1x1 der Spielplatzkontrolle - Forum Verlag Herkert GmbH - Страница 4
ОглавлениеSpielplätze sind keine Erfindung der Neuzeit: Pieter Brueghel d. Ä. zeigt auf seinem um 1560 entstandenen Gemälde „Die Kinderspiele“ ein „Wimmelbild“ mit weit über 200 Kindern und vielen Erwachsenen. Alle Kinder machen mit, und eine Aufsicht scheint es nicht zu geben. Gespielt wird mit Kreiseln, Steckenpferden und Puppen; Fässer und Fassreifen wurden zum Spielen umfunktioniert. Einen entwickelten Gleichgewichtssinn erfordert das Stelzenlaufen, auf Teamgeist kommt es beim Tauziehen an. Im Rollenspiel wird schon einmal ein Brautzug nachgestellt.[1] Alle sind aktiv. Spielplatzgeräte vermissten die Kinder zu dieser Zeit noch nicht.
Einer der Ersten, der sich mit dem Kinderspiel wissenschaftlich auseinandersetzte, war Friedrich Fröbel. Von ihm stammt der Ausspruch:
Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.
Erstmals wurde damit das Spielen nicht nur als Lernerfahrung akzeptiert, sondern als effektivste Lernform in der Kindheit schlechthin. 1839/40 richtete Fröbel in Bad Blankenburg den ersten Kindergarten mit einem Spielplatz ein.
Ein weiterer Wegbereiter für die öffentlichen Spielplätze war der als „Vater der Kleingärten“ bekannte Leipziger Arzt Dr. Schreber. Er verlangte für die Jugend in den Städten „große freie Spielplätze und gemeinsame, planmäßig eingerichtete und überwachte Spiele“.[2] Umgesetzt wurde das erstmals vom Leipziger Lehrer Hauschild, der nicht nur den ersten Schreberverein gründete, sondern dort auch den ersten öffentlichen Kinderspielplatz Deutschlands anlegte.
Trotzdem blieben öffentliche Spielplätze noch lange Zeit eine Seltenheit. Erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs begannen innovative Stadtplaner, Spielplätze zu berücksichtigen und auch zu realisieren. In Hamburg entstanden so mehr als 120 öffentliche Spielplätze.[3]
Leider hielt diese Entwicklung nicht lange an: Während und nach dem Zweiten Weltkrieg waren Spielplätze nicht überlebenswichtig, und viele wurden auch durch Kriegseinwirkungen beschädigt oder völlig zerstört. Erst nachdem die dringlichsten Grundbedürfnisse der Menschen befriedigt waren, wurde auch wieder begonnen, Spielplätze zu errichten. Allgemeinverbindliche Regeln gab es zu dieser Zeit noch nicht.
Erst Anfang der 1970er-Jahre, also vor fast 50 Jahren, wurde mit der Normung begonnen: Als Erstes erschien 1971 die deutsche Norm DIN 18034 „Spielplätze für Wohnanlagen, Flächen und Ausstattungen für Spiele im Freien, Planungsgrundlagen“. Diese an sich unverbindliche Norm wurde sogar von einigen Bundesländern in den Status einer bauaufsichtlich eingeführten Richtlinie erhoben und damit für verbindlich erklärt. In Bayern galt sie bis 1991.[4] Eine Fortschreibung dieser Norm in den 1980er-Jahren stieß auf den Widerstand der Bundesländer, die keine Eingriffe in ihre Planungshoheit wollten. Herausgekommen ist einerseits DIN 18034:1988, die nur noch Planungshinweise enthielt. Die Festlegungen zum Freiflächenbedarf wurden andererseits abgetrennt und in den Mustererlass der Arge Bau „Freiflächen zum Spielen“ aufgenommen. Soweit bekannt, wurde dieser Erlass in keinem Bundesland in Landesrecht umgesetzt. Trotzdem wurden die Inhalte in vielen kommunalen Konzeptionen und Satzungen festgeschrieben. Leider wurde bisher DIN 18034 nicht in die Liste der eingeführten technischen Baubestimmungen aufgenommen.
Von grundsätzlicher Bedeutung ist die UN-Kinderrechtskonvention.[5] Sie legt in Art. 31 Abs. 1 fest:
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an […] auf Spiel […].
Die Konvention ist 1992 als Bundesrecht in Kraft getreten. Direkte Auswirkungen auf Planung und Betrieb von Spielplätzen sind nicht bekannt.
Intensiver verlief die Entwicklung bei den Normen zu Spielplatzgeräten: Im Dezember 1976 erschien mit der Normenreihe DIN 7926 „Kinderspielgeräte“ die erste deutsche Norm zu Spielplatzgeräten. In insgesamt fünf Teilen wurden Regelungen getroffen zu allgemeinen sicherheitstechnischen Anforderungen, Schaukeln, Rutschen, Seilbahnen und Karussells. Es handelte sich dabei durchweg um Produktnormen mit sicherheitstechnischen Anforderungen i. S. d. damals geltenden Gerätesicherheitsgesetzes.
Zur Verbesserung des innereuropäischen Warenverkehrs wurde, 1997 beginnend, die deutsche Normenreihe DIN 7926 durch die europäische Normenreihe DIN EN 1176 „Spielplatzgeräte“ in Verbindung mit DIN EN 1177 „Stoßdämpfende Spielplatzböden“ abgelöst. Nach drei Überarbeitungen liegt nun die vierte Edition vor.
Die Produktnormen nach DIN EN 1176 wurden in das Verzeichnis 2 zum Produktsicherheitsgesetz[6] übernommen und lösen die Vermutungswirkung aus. Das heißt, es darf vermutet werden, dass Produkte, die nach diesen Normen gefertigt wurden, die Anforderungen des ProdSG erfüllen.
Für die Spielplatzprüfer,[7] aber auch für Planer, Betreiber und sonstige Interessenten sind sowohl die Normenreihe DIN EN 1176 als auch DIN 18034 von essenzieller Bedeutung. Sie müssen die dort enthaltenen sicherheitstechnischen Anforderungen genau kennen und die Prüfmethodik beherrschen. Da als Prüfgrundlage der Stand der Normung zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens ist, betrifft das praktisch alle Ausgaben.
Mit diesem Werk wurde der Versuch unternommenen, all dieses Wissen alphabetisch geordnet und übersichtlich zusammenzufassen. Aufgrund des handlichen Formats passt das Buch in jede Tasche. Es kann und soll die Originalausgaben der Normen nicht ersetzen, über die jeder Spielplatzprüfer verfügen sollte.
Niemand ist fehlerfrei. Auch der Autor dieses Buches nicht. Das Manuskript wurde mit Stand der Normung zum 01.06.2020 erarbeitet. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für inhaltliche Fehler, Irrtümer oder Fehlinterpretationen. Sollten Sie so etwas feststellen, wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Wir wünschen Ihnen allzeit sichere Spielplätze!
Schneeberg, im August 2020
GAO – Gesundheits- und Arbeitsschutz Onischka UG (haftungsbeschränkt)
Fußnoten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kinderspiele.
Autorenkollektiv, Spielanlagen, S. 9 ff, VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1979.
Kammeyer, Der Kinderspielplatz, Deutscher Bauernverlag, Berlin, 1953.
Agde u. a., Spielplätze und Freiräume zum Spielen, Ein Handbuch für Planung und Betrieb, Beuth Verlag, Berlin, 3. Auflage 2008,
Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Convention on the Rights of the Child, CRC).
Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG).
Als Spielplatzprüfer werden hier sachkundige Personen zur Durchführung der Inspektion nach der Installation und der jährlichen Hauptinspektion bezeichnet.