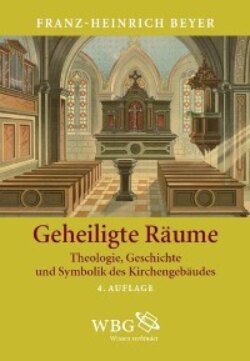Читать книгу Geheiligte Räume - Franz-Heinrich Beyer - Страница 29
3.2 Sakralbauten in Jerusalem zwischen Islam und Christentum
ОглавлениеJerusalem und der Tempelplatz wurden 638 von den Moslems eingenommen. Dabei kam es nicht zur Zerstörung von Kirchen. Im Mittelpunkt moslemischer Baumaßnahmen stand der Tempelplatz, der in byzantinischer Zeit nicht bebaut worden war.50 Sehr bald wurde auf dem Haram as-Sharif (Tempelplatz) – und zwar an seinem Rand – eine hölzerne Moschee errichtet, die dann 705 als steinerne Aqsa-Moschee fertiggestellt wurde. Zugleich entstand 691 im Zentrum dieses Platzes die Quabbat as-Sakhra (der Felsendom). Dabei handelt es sich um ein Bauwerk, für das es in der islamischen Tradition kein Vorbild gibt. Es folgt in der Baugestalt den monumentalen christlichen Zentralbauten, insbesondere der Rotunde der Grabeskirche. Dieses Bauwerk umfasst den heiligen Felsen, mit dem in jüdischer Tradition sowohl das Opfer Abrahams (Gen 22) wie auch das Brandopfer Davids (1 Sam 6,15), nun aber auch in islamischer Tradition die Himmelfahrt des Mohammed verbunden sind. Die Funktion eines gottesdienstlichen Raums wird hingegen von der Aqsa-Moschee erfüllt. Daher kann die Quabbat as-Shara mit guten Gründen als „Memoria“ und ebenso als monumentaler Ausdruck der Dominanz des Islam gesehen werden. Das wird auch in dem Schmuck des Gebäudes deutlich – mehr als 160 monumentale Inschriften –, die das Monument zu einer besonderen Form eines Glaubensbekenntnisses im Gegenüber zum Christentum machen.51 Mit diesem Bauwerk wurde sowohl die Kontinuität des herausgehobenen religiösen Ortes unterstrichen als auch die Absicht einer Überbietung des jüdischen Tempels zum Ausdruck gebracht. Zum anderen stellte dieser Bau eine symbolische Antithese gegenüber den Christen mit der Grabeskirche (und insbesondere mit der Ölbergkirche und dem dortigen Felsen) dar.
Abb. 4: Jerusalem, Felsendom, um 700, Grundriss und Schnitt.
1099 nahmen die Kreuzfahrer Jerusalem ein. Der Felsendom wurde in eine christliche Kirche umgewandelt und erhielt den Namen „Templum Domini“. Rechtlich war hier nun die Kirche des Kollegiatstifts St. Marien. Weitere Chorherrenstifte wurden an der Grabeskirche, an St. Maria in Monte Sion sowie an der Himmelfahrtskirche eingerichtet. Die Aqsa-Moschee, als „Templum Salomonis“ bezeichnet, wurde zunächst Palast des Königs von Jerusalem, 1118 dann Hauptquartier des Templerordens.52 Bauliche Veränderungen an beiden Bauwerken wurden nur in geringem Maße vorgenommen. Dementsprechend konnten beide Bauten 1187 mit der moslemischen Rückeroberung von Jerusalem leicht wieder zu moslemischen Heiligtümern werden. Dabei blieb es auch in den fünfzehn Jahren vertraglich geregelter christlicher Herrschaft (1229–1244) über Jerusalem.
In dieser Zeit wurde auch über dem zerstörten Heiligen Grab ein ziboriumartiger Aufbau innerhalb der Rotunde errichtet. Der Golgathafelsen wurde in die Kirchenanlage einbezogen und überbaut. Diese Konzentration der heiligen Orte beförderte die endgültige Übertragung von jüdischen und christlichen Überlieferungen, die ursprünglich am Tempelberg hafteten, auf die Grabeskirche. Die Grabeskirche wurde in der Nachfolge des Tempels gesehen, als Ort von Abrahams Opfer und vom Grab des ‚Priesterkönigs‘ Melchisedek (Gen 14,18). Ferner wurde der Felsen Golgatha natürlich als Ort der Kreuzigung, aber auch als Ort des Grabes von Adam verehrt. Golgatha wurde als Mitte, als Nabel der Welt gesehen.53 Auf den Weltkarten und Stadtplänen des Mittelalters ist dann Jerusalem in idealer kreisrunder Darstellung in der Kartenmitte lokalisiert.