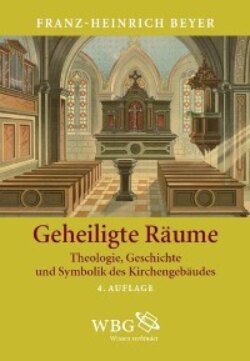Читать книгу Geheiligte Räume - Franz-Heinrich Beyer - Страница 21
1. Synagogen – Aspekte der frühen Baugeschichte
ОглавлениеDie Frage nach Ursprung und früher Entwicklung der Synagoge (griech.: = Versammlung; später Begriff für den Ort der Versammlung) ist offensichtlich unlösbar. Ihre Entstehung in der Zeit des Exils, in der Situation der Unerreichbarkeit des Jerusalemer Tempels, lässt sich nicht nachweisen.
Die Synagoge in hellenistischer Zeit ist ein öffentliches Gebäude; es ist eine neutrale Gemeindeeinrichtung mit umlaufenden Sitzbänken und Säulen, ohne weitere Verzierung. Die Synagoge diente als Zentrum eines beachtlichen Teils des öffentlichen Lebens. Ein wichtiger Teil davon waren die Gottesdienste, die regelmäßig in der Synagoge gefeiert wurden.37 Höhepunkt des Gottesdienstes war und ist das Vorlesen eines Abschnitts aus der Torarolle. Bis zum späten 3. Jahrhundert wurden dazu die Torarollen aus einem Nebengebäude in die Synagoge hereingebracht. Danach erhielten die Torarollen einen festen, herausgehobenen Platz in der Synagoge.
Vom 3. Jahrhundert an wurde die Ausrichtung der Synagoge nach Jerusalem bei allen Neubauten durch die Gestaltung einer Ädikula berücksichtigt. Hier war fortan der Ort für den Toraschrein.
Synagogen waren vom 3. bis zum 6. Jahrhundert mit Bildprogrammen, insbesondere mit Fußbodenmosaiken versehen. „Diese Bilder sind Narrative, die den Ort als ‚Hagios Topos‘ definieren, als ‚Heiligen Ort‘, der den zerstörten Tempel ersetzt. Dargestellt wird in den palästinensischen Synagogen immer ein tempelähnlicher Torah-Schrein mit dem davor befindlichen Torah-Vorhang und dem Ewigen Licht. Auch die Menora, der siebenarmige Leuchter und andere Einrichtungsgegenstände aus dem Tempel sind zu sehen. Diese Bildkompositionen sollten dem Betenden erklären, daß der Ort, an dem der Gottesdienst nun verrichtet werden muß, von mit dem Tempel vergleichbarer Bedeutung ist.“38 Einen Höhepunkt in der Entwicklung der Synagoge gab es in der Zeit vom 4. bis 7. Jahrhundert. Auf künstlerischem Gebiet wurde viel der byzantinischen Umwelt entlehnt. Teilweise wurden wohl auch dieselben Handwerker und Musterbücher herangezogen, die bei Kirchenbauten verwendet wurden.
Die jüdischen Gemeinden in Palästina und in der Diaspora hatten wohl alle ihre Synagoge. Es muss Hunderte oder sogar Tausende von Synagogen gegeben haben. In der Diaspora war die Synagoge wohl das einzige Gebäude der lokalen jüdischen Gemeinde. Gemäß rabbinischer Überlieferung musste die Synagoge an der höchsten Stelle des Ortes gebaut werden. Beim Bau der Synagoge war in der Regel der höchste Punkt des Ortes bereits bebaut. Im spätrömischen Palästina wurden Synagogen in einer die anderen Bauten überragenden Größe errichtet oder auf ein künstliches Podium gestellt. Eine kunstvoll gestaltete Fassade war dem Synagogenbau in der Spätantike eigen.
Spätantike Diasporasynagogen konnten ihren Ort sowohl im Stadtzentrum wie auch an der Peripherie haben. In Ägypten folgten die Synagogen topographisch oft heidnischen Vorbildern mit der Lage an einem Hain etc. Allen Synagogen gemeinsam war die Ausrichtung nach Jerusalem, die Permanenz von Toraschrein, Ädikula, Nische sowie der Bima. Gemäß römischer Rechtsauffassung wurden Synagogen als „religionum loca“ vor Einquartierung u.Ä. geschützt.
Die Einführung des Christentums als Staatsreligion im Römischen Reich (380) hatte auch Einfluss auf die Situation der jüdischen Gemeinden. Im 5. Jahrhundert war in Teilen des Reichs der Bau von Synagogen ganz untersagt. Zahlreiche Synagogen wurden – analog zu heidnischen Tempeln – in christliche Kirchengebäude umgewandelt.39 An dieser Praxis änderte auch nicht, dass solche gewaltsamen Umwandlungen mehrfach von kirchlichen Autoritäten verurteilt wurden.