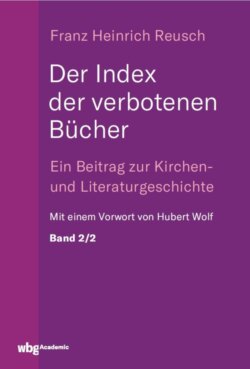Читать книгу Der Index der verbotenen Bücher. Bd.2/2 - Franz Reusch - Страница 11
88. Aufhebung des Jesuitenordens.
ОглавлениеAuffallender Weise sind unter Clemens XIII. (1758—69) von den zahlreichen Schriften gegen die Jesuiten nur ganz wenige in den Index gekommen. In einem Breve an die sechs französischen Cardinäle vom 8. Sept. 1762 (Bull. 2, 196) sagt er, er habe in dem am 3. gehaltenen Consistorium die Edicta sive Arresta Parlamentorum gegen die Jesuiten verdammt und für null und nichtig erklärt; im Index haben aber diese Arrêts nicht, wie mehrere ältere, einen Platz erhalten. 1763 liess er durch die Inquisition einen Hirtenbrief des Bischofs Fitz-James von Soissons über die im Auftrage des Pariser Parlaments zusammengestellten Extraits des assertions pernicieuses verbieten, — diese selbst stehen nicht im Index, — und 1766 zwei Schriften über die von ihm 1765 zu Gunsten der Jesuiten erlassene Bulle Apostolicum. Unter Clemens XIV. (1769—74) wurden keine Schriften über die Jesuiten verboten, unter Pius VI. (1775—99) von den zahlreichen über seinen Vorgänger erschienenen Schriften eine der unbedeutendsten und zwei von Jesuiten herausgegebene anonyme Denkschriften über die Aufhebung des Ordens, beide durch Breven vom 13. Juni 1781 und 18. Nov. 1788.
1. Von den Arrêts des Pariser Parlaments verdienen zwei, vom 6. Aug. 1761 und vom 6. Aug. 1762, besonders erwähnt zu werden, weil sie Indices enthalten. In dem ersten werden 24 Bücher von Jesuiten, mit Sa’s Aphorismen von 1590 beginnend und mit der Moral von Lacroix schliessend, verzeichnet, die als aufrührerisch, die christliche Moral zerstörend, eine mörderische und abscheuliche, die Sicherheit und das Leben nicht nur der Bürger, sondern auch der geheiligten Personen der Fürsten gefährdende Lehre enthaltend, vom Henker zerrissen und verbrannt werden sollten. Das zweite enthält ein solches Verzeichniss von 163 Nummern (beide bei Rocquain p. 512). — Die in dem Arrêt von 1761 stehende Moral von Lacroix, war schon 1757 zu Toulouse auf Befehl des dortigen Parlamentes verbrannt worden. Der Titel der betreifenden Ausgabe ist: Hermanni Busembaum … Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta a Claudio Lacroix … Ed. novissima diligenter recognita .xk . ab uno ejusdem S. J. sacerdote, Lugd. 1757. Die Medulla theologiae mor. von Busembaum war seit 1645 etwa 50mal gedruckt, die Bearbeitung von Lacroix zuerst Col. 1710—14 erschienen. Die Jesuiten zu Toulouse desavouirten die neue Ausgabe und erklärten, da das Verbot derselben hauptsächlich durch die schon im Anfange des 17. Jahrh. in Frankreich verdammten Lehren (S. 341) hervorgerufen war, ihr Einverständniss mit den gallicanischen Grundsätzen. Dieselbe Erklärung gaben 1762 die Jesuiten zu Paris ab. Zaccaria aber schrieb eine anonyme Apologie de la théol. mor. des PP. Busembaum et Lacroix, Jésuites, contre les arrêts des parlements qui ont condamné cet ouvrage, 1758, die das Pariser Parlament 10. März 1758 verbrennen liess1).
Die Extraits des assertions pernicieuses et dangereuses en tout genre que les soi-disants Jésuites ont dans tous les temps soutenues, verifiés et collationés par les commissaires du Parlement, … Par. 1762 * 4. (5. Ed. Amst. 1763, 3 vol. 8.), — sie sollen hauptsächlich von den Abbés Goujet und Minard und dem Parlamentsrathe Roussel de la Tour zusammengestellt worden sein, — werden im Index nur erwähnt in dem Verbote: Ordonnance et instruction pastorale de Mgr. l’Evêque de Soissons au sujet des Assertions extraites par le parlement des livres, thèses, cahiers, composés, publiés et dictés par les Jéuites, 1762, von der Inq. verb. Fer. IV. 13. Apr. 1763. Der Bischof von Soissons, François Duc de Fitz-James (geb. 1709, ein Sohn des Herzogs von Berwick, eines natürlichen Sohnes Jacobs II., seit 1738 Bischof, † 1764) hatte sein umfangreiches Mandement gegen Hardouin und Berruyer (S. 812) 1759 mit einem Briefe an Clemens XIII. gesandt. Der Papst liess ein anerkennendes Breve für ihn abfassen; dieses lag längere Zeit auf seinem Pulte und verschwand dann. Der Bischof, der davon gehört, beklagte sich in einem zweiten Briefe vom 8. März 1762, dass er keine Antwort erhalten. Er erhielt nun ein Breve vom 26. Mai, worin aber die scharfen Aeusserungen über die Jesuiten in dem zweiten Briefe getadelt wurden. Er antwortete 8. Jan. 1763 und übersandte dem Papste zugleich die oben erwähnte Ordonnance, 24 S. 4. Das Verbot derselben wird in dem Decrete der Inq. nicht motivirt, ist aber wahrscheinlich nicht bloss wegen der Angriffe auf die Jesuiten, sondern auch wegen der Vertheidigung der gallicanischen Artikel erfolgt. Wenigstens klagt der Papst auch darüber in dem Briefe, mit welchem er das Decret dem König von Frankreich übersandte (er ersuchte auch die französischen Cardinäle, seine Klage gegen den Bischof bei dem Könige zu unterstützen). Das Decret der Inq. wurde von dem Parlamente unterdrückt; erst nachdem dieses geschehen war, antwortete der König dem Papste, beklagte es, dass dieser übereilt und einseitig vorgegangen sei und die in ganz Frankreich anerkannten vier Artikel verdamme, versprach aber, die Sache des Bischofs untersuchen zu lassen. Die mit der Untersuchung beauftragten vier Bischöfe sprachen sich günstig für Fitz-James aus und der König nahm ihn in einem Briefe an den Papst vom 25. Juli 1763 in Schutz2). Mehrere gegen ihn und die Extraits gerichtete bischöfliche Erlasse wurden gleichfalls vom Parlamente unterdrückt. Zwei andere Ordonnanzen über die Extraits, von Joachim de Grasse, Bischof von Angers, und von J.-L. du Buisson de Beauteville, Bischof von Alais († 1776), wurden von Clemens XIII. in Breven vom 19. Sept. und Dec. 1764 getadelt (Bull. cont. 3, 17), aber nicht in den Index gesetzt, obschon die des Bischofs von Alais (163 S. 12.) umfangreicher ist als die des Bischofs von Soissons. Der Papst spricht in verschiedenen Breven in starken Ausdrücken von den von Feinden der Kirche oder von den untreuen Händen der Jansenisten hinterlistig zusammengestellten Extraits (Bull. 3, 17. 23), sie wurden auch von einer Reihe von französischen Bischöfen censurirt, — aber im Index stehen sie nicht1), auch nicht Hist. générale de la naissance et des progrès de la Comp, de Jésus, 1761, 4 vol. 12., und Supplément, 1764, 2 vol., von Abbé Christophe Coudrette, † 1773 (N. E. 1774, 198); Annales de la société des soi-disants Jésuites par Emmanuel-Robert de Philibert [J.-A. de Gazaignes], ancien chan. de Toulouse, 5 vol. 4. (übersetzt: Annali della Società dei se-dicenti Gesuiti, 1780, 2. vol. 4.), und andere ähnliche Sachen.
2. In Portugal wurde die Aufhebung des Jesuitenordens eingeleitet durch die Untersuchung seines Verhaltens in Paraguay, mit welcher noch Benedict XIV. durch ein Breve vom 1. Apr. 1758 den Card. Saldanha beauftragte. Die im Auftrage der portugiesischen Regierung geschriebene Relaçaõ abbreviada da republica, que os religiosos Jesuitas … estabeleceraõ nos dominios ultramarinos …, welche Benedict XIV. durch den Gesandten Franc, de Almeda überreicht worden war, liess dieser auch in Rom drucken; der Drucker Pagliarini wurde aber verhaftet. Der Druck des Urtheils des Card. Saldanha vom 12. Jan. 1759 wurde in Rom nicht gestattet2). Wie Cordara (Döllinger, Beitr. 3, 22) berichtet, überreichte der Jesuiten-General Ricci in der ersten Audienz, die er bei dem neuen Papste Clemens XIII. hatte, eine Bittschrift bezüglich des Verfahrens Saldanha’s. Der Papst überwies sie der Inquisition, beschränkte sich dann aber darauf, Saldanha durch den Nuncius sein Missfallen aussprechen zu lassen. Almeda liess die Bittschrift, die ihm in die Hände gekommen, mit Anmerkungen von dem Piaristen Urbano Tossetti drucken. Der Drucker Pagliarini wurde zu den Galeren verurtheilt, von dem Papste aber begnadigt. Verboten wurde die Schrift in Rom nicht. Es erschien auch noch eine Appendix dazu mit scharfen Anklagen gegen die Jesuiten, zu denen angeblich Card. Marefoschi Material aus dem Archiv der Propaganda lieferte. — Die spanische Inquisition verbot durch ein Edict vom 15. Mai 1759 strenge: Memorial presentado por el P. General de los Jesuitas a S. S. 31. Julio 1758, Parecer que dió la Congregacion sobre el contenido del Memorial …, und zwei andere auf die Jesuiten in Portugal bezügliche Schriften (Carta, Causas).
1761 liess Pombal den Jesuiten Gabriel Malagrida durch die Inquisition als Ketzer verurtheilen, — die Verurtheilung stützte sich auf seine (nicht gedruckten) Schriften: Vida da gloriosa Santa Anna und Tractatus de vita et imperio Antichristi, — und hinrichten1). Auch von den über diese Sache erschienenen Schriften steht keine im Index, wie überhaupt keine von den zahlreichen damals in Portugal veröffentlichten Büchern, die in Rom grossen Anstoss erregen mussten, nicht einmal: Petitio recursus Majestati Domini nostri Regis in publica audientia praesentata a Dr. Jos. de Seabra Sylvio… Procuratore Regiae Coronae . . super ultimum et criticum statum hujus monarchiae, ex quo Societas Jesu nuncupata expulsa proscriptaque est de regnis Galliae et Hispaniae. Latinitate donavit . . professor quidam Olisiponensis, 1767,* 16 und 78 S. 8., und die 1767 von Seabra portugiesisch veröffentlichte, 1771 von Ant. Pereira Figueiredo übersetzte Deductio chronologica et analytica. P. I., ubi instituta serie minime interrupta horrendae manifestantur clades a Jesuitica Societate Lusitaniae ejuscoloniis . . illatae … P. II., ubi manifestantur ea, quae sub diversis ecclesiae epochis contigerunt occasione censurae, prohibitionis et impressionis librorum2), zwei starke Octavbände, ein Werk, von dem Card. Pacca (Denkw. 6, 96) sagt, es sei schlimmer als die Extraits des assertions, und von dem Theiner (Clemens XIV. 1, 70) berichtet, die Nuncien in Madrid und Paris hätten es, „vielleicht das bedeutendste Werk gegen die Jesuiten,“ nach Rom geschickt.
In Spanien wurde Retrato dos Jesuitas feito ao natural 1764 verb., aber schon 1768 erschien eine Uebersetzung: Retrato de los Jesuitas formado al natural por los mas doctos y mas ilustres cato licos … Ed. 2., con superior permiso, (142 S. 4.), und Continuacion del Retrato … (278 S. 4.; Pelayo 3, 217). Als 1768 strenge verb. stehen im span. Index Papeles, Estampas, Satiras, Libelos etc, über das Verfahren des Königs und seiner Minister bei der Vertreibung der Jesuiten, speciell ein in America gedrucktes Papel: Quis nos separabit? und eine Estampa des h. Josaphat, und als 1772 verb. gedruckte und geschriebene Papeles, Estampas, Inscripciones etc., in denen Bibelstellen missbräuchlich angewendet werden oder boshafte Anspielungen auf die Vertreibung der Jesuiten vorkommen. Anderseits wurde 1769 auch Hist. impartiale des Jésuites, 1768, 2 vol., von dem Advocaten Linguet, verb. (Crét.-Joly 2, 57).
3. Die Bulle Apostolicum vom 7. Jan. 1765 (Bull. 3, 38), — von der Clemens XIV. in dem Aufhebungsbreve sagt: has literas apost. a Clemente XIII. extortas potius quam impetratas fuisse, — durfte in Genua, Florenz, Turin, Mailand, Neapel, Frankreich, Portugal und Oesterreich nicht gedruckt werden; das Parlament von Aix liess sie 26. Jan. 1765 verbrennen1). Die beiden von der Inq. verbotenen Schriften sind: Lettera prima, 2. e 3. intorno la Bolla che comincia: Apostolicum, verb. 4. Sept. 1765, — von dem Venetianischen Theatiner Tom. Ant. Contini, Prof. in Padua; im span. Index, Carta primeira …, als 1766 strenge verb. verzeichnet; französisch: Lettres d’un célèbre canoniste d’Italie sur la B. Apost., 163 S. 12. (N. E. 1766, 57); die Bulle wird darin als erschlichen und nichtig bezeichnet; — Brevi di S. S. Clemente XIII. emanati in favore dei RR. PP. Gesuiti colle osservazioni sopra i medesimi e sopra la bolla Apostolicum, Ven. 1766,* 72 S. 8., verb. Fer. IV. 12. März 1766, als nefarium opus, welches wegen des vorausgeschickten Monitum und der Anmerkungen zu den Actenstücken noch während der Sitzung der Inquisition auf dem Platze vor der Minerva von dem Henker zu verbrennen sei2). Die Fortsetzung, Aggiunta alla raccolta de’ brevi di S. S. Clemente XIII… con osservazioni importanti sopra Ii medesimi, Ven. 1766,* 52 S. 8., steht nicht im Index.
4. Von den zahlreichen über Clemens XIV. erschienenen Schriften steht im Römischen Index nur Esprit de Clement XIV., mis au jour par le R. P. B…, confesseur de ce souverain pontife et dépositaire de tous ses secrets, trad. de l’italien par l’abbé C…, Moudon (Amst.) 1775, 12., verb. 1775, weder aus dem Italienischen übersetzt, noch von dem Beichtvater des Papstes verfasst, sondern von Joseph de Lanjuinais, der früher Benedictiner war, Protestant wurde und als Vorsteher einer Erziehungsanstalt zu Moudon in der Schweiz um 1808 starb; er hatte vorher, gleichfalls anonym, Monarque accompli ou prodige de bonté, de savoir et de sagesse, qui font l’éloge de S. M. I. Joseph II., Lausanne 1774, geschrieben; das Pariser Parlament liess 1776 dieses Buch verbrennen (Rocquain p. 351. Hist.-pol. Bl. 3, 129); der später zu erwähnende Jean-Denis Lanjuinais war sein Neffe. Im span. Index steht als im J. 1789 verb. eine Ausgabe: Lo spirito etc. Amst. 1777, 2 vol. Ferner werden hier expurgirt: Vida del P. Clemente XIV. por el Marq. Caracciolo, trad. al castellan por D. Fr. M. Nipho, Madr. 1776 (es wird nur eine Stelle gestrichen) und Lettres du P. Clement XIV. (Ganganelli) précédées de la vie de ce Pape et suivies de l’oraison funèbre prononcée a Fribourg, Liége 1777, 4 vol. (drei Stellen gestrichen)1). — 1845 ist noch in den Röm. Index gekommen: Gangan elli. Der Kampf gegen den Jesuitismus. Ein Charaktergemälde für unsere Zeit von H. M. E. Karlsruhe 1845.
Grosses Aufsehen erregte im J. 1780 die Schrift Memoria cattolica da presentarsi a Sua Santità. Opera postuma. Cosmopoli 1780,* 189 S. 8., in welcher in sehr scharfer Weise zu zeigen versucht wird, das Aufhebungsbreve sei null und nichtig, weil erschlichen, erzwungen, ungerecht und für die Kirche schädlich. Der Verfasser ist, wie später herauskam, der Ex-Jesuit Carlo Borgo, † 1794; gedruckt war die Schrift zu Rom2).Sie wurde dort Ende 1780 confiscirt; drei Ex-Jesuiten, der Abate Buccinelli, der sie in Rom verbreitet hatte, und der Drucker Perego aus Mailand, ein früherer Laienbruder der Jesuiten, und ein Jude aus Livorno, der das Manuscript nach Rom gebracht und drei Druckern angeboten, wurden verhaftet. Am 8. Jan. 1781 wurde das Buch von dem Mag. S. Pal. als ein boshaftes und durchaus verwerfliches verboten. Am 13. Juni erschien dann ein Breve Pius’ VI., worin er sagt: er habe sich von mehreren unparteiischen Theologen, von jedem einzeln, Gutachten abgeben lassen, und auf Grund derselben verdamme er das Buch als resp. für fromme Ohren verletzende, ärgernissgebende, temeräre, irrige, aufrührerische, der Ketzerei verdächtige und das Schisma begünstigende Sätze enthaltend, und verordne, es als eine für den h. Stuhl und katholische Fürsten injuriöse Schmähschrift zu verbrennen (N. E. 1781, 149). Trotz des Verbotes erschien noch in demselben Jahre eine 2. Ausgabe mit noch stärkeren Zusätzen. Die Memoria ist abgedruckt in den Anecdoti interessanti di storia e di critica sulla Memoria cattolica. Insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina. 2 Tim. 4., 1787, 413 S. 8. (nicht im Index). — Einige Jahre später erschien Seconda Memoria cattolica contenente il trionfo della fede e chiesa, de’ monarchi e monarchie e della Compagnia di Gesú e sue apologie collo sterminio de’ loro nemici, da presentarsi a Sua Santitá ed alli principi cristiani: opera divisa in tre tomi e parti e postuma. Sie wurde in einem langen und sehr scharfen Breve vom 18. Nov. 1788 (Bull. 8, 247) als ein wahrer Libellus infamatorius, noch verwegener und schlechter als die erste Memoria, als ein Gewebe von Lügen und Schmähungen gegen den Papst, Könige, Cardinäle und Minister verdammt. Unter demselben Datum verbot der Gouverneur von Rom und Vice-Camerlengo des h. Stuhles für den Kirchenstaat das Behalten und Verbreiten des Buches bei Todesstrafe, unter Berufung auf die Bestimmungen des Bando generale über Hochverrath, und setzte einen Preis auf die Anzeige des Verfassers und der Verbreiter. Die Schrift, angeblich schon 1783—84 gedruckt, wurde übrigens nur ganz heimlich vertheilt; der spanische Gesandte Azara verschaffte sich mit Mühe für 60 Scudi ein Exemplar (N. E. 1789, 55). Sie ist nicht von C. Borgo, sondern, wie in der 2. Auflage von dessen Memoria angegeben wird, von einem spanischen Ex-Jesuiten, nach Backer 2. Ed. 2, 1109 von Bruno Marti. — In Spanien wurden beide Memorie 1789 verb., schon 1785: Sensa Rom. Pontificum Clementis XIV. praedecessorum cum animadv. circa ejus Breve, Amst. 1776, 467 S. 8., von dem Ex-Jes. Casimir Bedekowics.
Während des Conclave’s nach dem Tode Clemens’ XIV. erschien Il Conclave dell’ anno 1774. Dramma per musica da recitarsi nel teatro delle dame nel carnevale del 1775. Dedicato alle medesime dame. In Roma per il Cracas all’ insegna del Silenzio, con licenza e approvazione. Die Cardinäle des Conclaves liessen „dieses ruchlose Drama mit anderen Satiren und Pasquillen zu Rom von dem Henker verbrennen und beauftragten die Nuncien, die Regierungen zur Unterdrückung desselben aufzufordern“ (Theiner 2, 527). Nach Cantù, Storia degli Ital. 6, 134 wurde der Verfasser, Abate Sertori, sogar zum Tode verurtheilt, aber auf den Wunsch des Card. Zelada, gegen den das Pasquill hauptsächlich gerichtet war, begnadigt.Es steht nicht im Index1).
5. Unter Pius IX. sind bekanntlich über Clemens XIV. und die Aufhebung des Jesuitenordens zwei grössere Werke erschienen: J. Crétineau-Joly, Le Pape Clément XIV. et les Jésuites, Par. 1847 u. s., und Aug. Theiner, Hist. du Pontificat de Clément XIV., Par. 1852 (deutsch 1853, dagegen von Crét.-Joly zwei Lettres au Père Theiner, 1853). Crét.-Joly hat von den Jesuiten Material erhalten, sie aber durch die Weise, wie er es verarbeitete, in Verlegenheit gebracht und auch die Unzufriedenheit Pius’ IX. erregt. In dessen Auftrage hat Theiner 1847 sein Buch begonnen; mit der Ausführung des Auftrages aber war der Papst nichts weniger als zufrieden. J. B. Leu, der 1853 einen Auszug aus Theiners Buch herausgab (Clemens XIV. und die Jesuiten) sagt (Warnung vor Neuerungen, 1853, S. 61): „Crét.-Joly’s Werk ist in den Index gesetzt und vom letztverstorbenen Jesuiten-General in Folge dessen desavouirt worden. M. Brühl legt dieses Lügenwerk seiner Geheimen Geschichte der Wahl Clemens’ XIV. und der Aufhebung des Jesuitenordens zu Grunde und die Sion 1852, Lit.-Bl. 14, empfiehlt diese mit dem Beisatze: »Das dem Schriftchen zu Grunde gelegte Buch von Crét.-Joly ist zwar als der Persönlichkeit eines Papstes und somit der päpstlichen Würde beleidigend in den Index gesetzt worden; aber der Wahrheit, welche leider gegen Clemens XIV. und einen Theil der Cardinäle ein hartes Zeugniss gibt, ist in dem Buche des gelehrten und frommen Franzosen kein Abbruch geschehen.« Von dem Werke Theiners nimmt man, wie es scheint, wenig Notiz; dagegen kündigt die Mechitaristen-Congregation in Wien 1853 eine deutsche Uebersetzung jenes Werkes an, welches der h. Stuhl zu lesen verboten hat.“ Anderseits wird in der Schrift P. Theiner und die Jesuiten von Theiners Privatsecretär H. Gisiger, Mannh. 1875, S. 231, und im Foreign Church Chronicle 1881, 215 behauptet: „Kaum war Theiners im Auftrage Pius’ IX. geschriebener Clemens XIV. erschienen, als er in den Index gesetzt wurde und alle Exemplare, deren die Jesuiten habhaft werden konnten, verbrannt wurden.“ In Wirklichkeit steht weder das eine noch das andere Buch im Index; vielmehr ist nur der Verkauf beider im Kirchenstaate zeitweilig verboten gewesen. Unter dem 30. Jan. 1848 schreibt der Jesuit Janssen von Rom an Crét.-Joly: „Auch ich habe den Verdacht ge habt, dass man Ihren Clemens XIV. in den Index setzen wolle; aber jetzt habe ich Gründe zu glauben, dass man den Gedanken aufgegeben hat. Es ist aber möglich, dass das Verbot des Verkaufes noch nicht aufgehoben ist“1). Ueber Theiners Buch erliess Card. Mertel als Minister des Innern 28. Sept. 1853 folgendes geheime Circular: „Der Magister S. Pal. hat mir gesagt, es sei zu Mailand der erste Band der Geschichte Clemens’ XIV. von A. Theiner mit einer Vorrede des Uebersetzers Fr. Longhena erschienen und er habe nach einer Anfrage höhern Orts in Rom den Verkauf der Uebersetzung als geeignet, Missstimmung und Beunruhigung zu befördern, verboten; er hat mir auch bemerkt, dass es nöthig sei, den Import und Verkauf im ganzen Kirchenstaate zu verbieten“ u. s. w. A. Gennarelli (Governo Pontif. 1, 546), der dieses Actenstück mittheilt, verzeichnet eine Reihe von Büchern, die nicht im Index stehen, aber 1850—55 durch den Minister des Innern verboten wurden, darunter z.B. auch Lettere di Gladstone su Napoli.
Von der Wiederherstellung des Jesuitenordens handelt ein Buch von J. L. Chaillot, Pie VII et les Jésuites d’après des documents inédits, Rome 1879*, 494 S. 8. Er sucht nachzuweisen, Pius VII. habe den Jesuitenorden nicht in der Gestalt, die er zur Zeit der Aufhebung gehabt, wiederhergestellt, sondern in seiner ursprünglichen Gestalt, wie er von Paul III. bestätigt worden, und ohne die Privilegien, welche ihm die Päpste von Gregor XIII. an verliehen; von diesen habe ihm erst Leo XII. einige wieder bewilligt. Das Buch war schon 1879 gedruckt, wurde aber erst 1882 veröffentlicht und dann gleich 3. Apr. verboten. Der Verfasser schrieb darauf an den Secretär der Index-Congr.: das Decret sei ihm zwar nicht zugestellt worden; er erkläre aber seine völlige Unterwerfung unter dasselbe. In dem nächsten Decrete, vom 10. Juli 1882 (Acta S. S. 15, 39) steht demgemäss: Auctor se subjecit. Dass nicht gesagt wird: laudabiliter se subjecit et opus reprobavit, ist nicht zufällig Die Civ. 11, 11, 699 constatirt: er habe sich zwar unterworfen und sein Buch aus dem Buchhandel zurückgezogen, aber es nicht reprobirt1).
1) Rocquain p. 206. N. E. 1757, 165; 1758, 6. Backer s. v. Lacroix und Zaccaria, n. 25. Deutscher Merkur 1881,139. — Angejo Franzoja, Prof. in Padua, schrieb damals Theologia morum ab H. Busembaum primum tradita, tum a Cl. La Croix et Fr. A. Zaccaria aucta, nunc demum juxta saniores et praesertim D. Thomae Aq. doctrinas ad trutinam revocata, Bononiae 1760. Zaccaria fügte dann seiner Ausgabe des Busembaum, Ravenna 1761, eine Amica expostulatio gegen Franzoja bei (Hurter 3, 423).
2) Die Actenstücke in Oeuvres de Mgr. le Duc de Fitz-James, Ev. de Soissons, Avignon 1769*, 2 vol. 12. (Die Oeuvres sind edirt von P.-E. Gourlin, der auch die beiden oben erwähnten Mandements verfasst hat). Zum Folgendem vgl. Fleur. 85, 99.
1) Die Réponse au livre Extraits … 1769—73, 3 vol. 4., wurde unter der Leitung des P. Sauvage meist von P. Grou angefertigt; Backer 6, 606. Andere Verteidigungen der Jesuiten ib. 2, 269. Der Jesuit J. A. Cerutti, der 1762 die Apologie générale de l’institut et de la doctrine des Jés. herausgab, erbot sich 1767, den von dem Parlament verlangten Eid abzulegen, da ihm die Augen aufgegangen seien, und schrieb später im Sinne der Revolution (Picot 4, 522). In Trier liess der Erzbischof Joh. Phil. v. Walderdorff 1764 die Apologia instituti et regularum S. J. confisciren und die Jesuiten, die sie herausgegeben, von der Universität entferneu; Fleur. 85, 363.
2) Schäfer, Gesch. v. Port. 5, 287. Die Relaçaõ steht bei Seabra 2, 437. Sie erschien übersetzt als La république des Jés. au Paraguay renversée, ou relation authentique …, Haye 1758, 70 S. 8. N. E. 1758, 46. 100. 157. 188.
1) Fleur. 84, 461. Cantù 3, 435. Revue hist. 1882, 18, 323. Hier wird p. 331 gesagt: die beiden Schriften würde jeder moderne Richter für das Werk d’un pauvre fou erklärt haben.
2) Vol. II p. 117 steht Petitio recursus … de ruinis huic regno ejusque coloniis illatis per clandestinas introductiones Bullae Coenae et Expurgatoriorum Indicum Romano-Jesuiticorum, p. 183 Regia lex de supprimendis . . Bulla Coenae ceterisque Bullis, quibus superstructi sunt Indices exp., vom 6. Apr. 1768, und das gleichzeitig publicirte Gesetz über die Curia censorum regiorum.
1) Brosen, Gesch. des K.-St. 2, 117. Sitzungsber. der W. Ak. Ph.-hist. Cl. 84, 430. Crét.-J. 5, 226 sagt: Clemens XIII. habe als juge supréme en matière de foi, en morale et en discipline du haut de la chaire infaillible gesprochen. Vgl. Theiner 1, 36.
2) Das Decret ist dem Münchener Exemplar der Quart-Ausgabe des Index von 1758 beigebunden. Eine Uebersetzung der Schrift wird sein Recueil contenant la Constitution et les brefs . . précédé d’un avertissement et de notes, 56. S. 12. N. E. 1765, 57. 185.
1) Die Briefe sind von dem Marchese Caracciolo herausgegeben. Sie sind nicht unterschoben (Picot 4, 607. Theiner, Clemens XIV., I, S. XIV), aber interpolirt; Reumont, Ganganelli S. 40. Italienische Ausgaben erschienen 1829, 1831 und 1845. Die Biographie erschien zuerst französisch 1775, italienisch: Vita di Fra Lor. Ganganelli, P. Clemente XIV. Nuova Edizione illustrata da scritti importanti intorno i Gesuiti, Roma e Losanna 1847. Im Röm. Index steht keine Ausgabe beider Werke.
2) Auf dem Titelblatte steht das Motto: Tu scis quoniam falsum testimonium tulerunt contra me: et ecce morior, cum nihil horum fecerim, quae isti malitiose composuerunt adversum. me. Exaudivit autem Dominus vocem ejus. Dan. 13, 43. 44. Der 1. Theil ist italienisch, der 2. deutsch abgedr. bei Le Bret, Mag. 8, 139—375. Eine Uebersetzung, „Katholische Denkschrift Seiner Heiligkeit zu überreichen“, erschien zu Frankfurt und Leipzig 1784, 264 S. 8. Dass Borgo der Verfasser ist, wird von Backer anerkannt (er sagt 2. Ed. 1, 767, sein eigenhändiges Manuscript sei früher in der Jesuiten-Bibliothek zu Genua aufbewahrt worden), von Hurter 3, 313 nicht erwähnt. Die Memoria wird auch in Eerzans Gesandtschaftsberichten (Seb. Brunner, Theol. Dienerschaft S. 56) erwähnt. Es erschien dagegen eine Memoria cattolica von einem Dominicaner. — Der Jesuit Magnani schreibt in einem in dem Nürnberger Journal pour l’histoire, XIII. abgedruckten Briefe: Als Pius VI. die Memoria zuerst gelesen, habe er sie gebilligt und geweint; nachdem sie gedruckt worden, hätten einige Gesandte ihn genöthigt, den Verkauf zu verbieten und sie prüfen zu lassen. Die Prüfung sei zwei Feinden der Jesuiten übertragen worden, die auch als die Concipienten des Aufhebungsbreves bezeichnet würden. Auf ihr Gutachten hin habe er dann das Buch verbieten müssen.
1) Nach Melzi war es in Florenz gedruckt, angeblich unter den Auspicien di altissimo personaggio. Es erschien nochmals zu Mailand 1797. Es gibt auch einen Nachdruck mit deutscher Uebersetzung, 155 S. 8. In der Vorrede heisst es: La poesia è in gran parte dal celebre abate P. Metastasio. Es ist ein Cento von Versen Metastasio’s. Der Verfasser schrieb auch un memoriale in sua disculpa, gleichfalls in Versen von Metastasio.
1) Die in Rom erscheinende Speranza verglich damals Cret.-Joly mit Paul Jovius und Aretino und der Contemporaneo brachte einen Artikel gegen ihn, den anfangs der Censor zurückwies, den aber dann der Mag. S. Pal. Modena nach Weglassung einiger Stellen passiren liess, um, wie er sagte, das durch Cret.-Joly gegebene Aergerniss zu mildern. Der Jesuiten-General Roothaan veröffentlichte, eine Erklärung vom 24. Dec. 1852, die mit dem Satze schliesst: „Ich protestire laut in der ganzen Aufrichtigkeit meines Gewissens in meinem und aller Meinigen Namen gegen alles, was in den Schriften des Herrn Cret.-Joly die dem h. Stuhle gebührende Ehrfurcht verletzt, und erkläre, dass zwischen diesem Schriftsteller und den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu keine Solidarität existirt.“ Als Cret.-Joly 1857 mit Pius IX. Frieden schloss, wurde in den Brief, den er diesem schreiben musste, von Card. Villecourt im Auftrage des Papstes der Satz eingeschoben: „Ich verpflichte mich, fortan nichts mehr zu veröffentlichen, was den Statthalter Jesu Chr. betrüben oder verletzen könnte, und werde diesem gern alle Schriften, von denen er es wünscht, vorher vorlegen.“ U. Maynard, Jacques Cretineau-Joly, 1875. A. v. Druffel, Cretineau-Joly, Hist. ZtS. 1884, 16, 1. Die Streitschriften für und gegen Theiner bei Roskovany 4, 1300.
1) Chaillot gab 1869—70 die Zeitschrift L’avenir catholique heraus und nannte sich damals Monsignore. Der Jesuit Seb. Sanguineti schrieb gegen ihn La Compagnia di Gesú e la sua legale esistenza nella Chiesa. Risposta agli errori di G. L. Chaillot nel libro …, Rom 1882*, 279 und 174 S. 8. Vgl. Civ. a. a. O. Das einzige Werthvolle in beiden Büchern, — auch das von Chaillot ist wenigstens jetzt im Buchhandel, — sind die Actenstücke aus der Zeit der Wiederherstellung des Ordens.