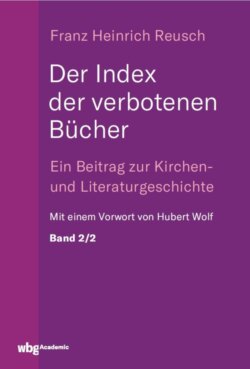Читать книгу Der Index der verbotenen Bücher. Bd.2/2 - Franz Reusch - Страница 13
90. Deutsche kirchenrechtliche Schriften 1750—1800.
ОглавлениеDas Buch, welches der Trierer Weihbischof Hontheim unter dem Namen Justinus Febronius 1763 veröffentlichte, wurde gleich einer Anzahl von unbedeutenderen Schriften durch ein einfaches Decret der Index-Congregation verboten, allerdings gleich nach dem Erscheinen und durch ein besonderes Decret; ebenso die 2. Auflage und der 2. und 3. Band. Dass man dem Buche eine grössere Bedeutung beilegte, zeigen aber nicht nur die zahlreichen Gegenschriften curialistischer Theologen1), sondern auch die Thatsachen, dass Clemens XIII. 1764 und 65 durch mehrere Breven die deutschen Bischöfe zur Unterdrückung des Werkes aufforderte und dass, nachdem Hontheim zur Unterzeichnung eines Widerrufs sich hatte bewegen lassen, Pius VI. dieses in einem eigens zu diesem Zwecke am Weihnachtsfeste 1778 gehaltenen Consistorium feierlich verkündete. — Im J. 1784 wurde die Einleitung in das Kirchenrecht von J. V. Eybel von der Index-Congregation, dagegen sein Schriftchen über die Ohrenbeichte durch ein langes Breve Pius’ VI. verboten, seine schon früher, 1782, unmittelbar vor der Ankunft des Papstes in Wien erschienene Broschüre „Was ist der Papst?“ erst 1786, gleichfalls durch ein langes Breve. Auch von den zahllosen anderen deutschen Broschüren, die in jener Zeit erschienen und von denen nur eine kleine, ganz planlos ausgewählte Zahl im Index steht, würdigte Pius VI. noch eine, Allgemeines Glaubensbekenntniss aller Religionen, 1784 eines besondern langen Breves. — Die Emser Punctation von 1786 veranlasste Pius VI. iu einer umfangreichen Responsio, die 1789 gedruckt erschien. In dieser werden nicht nur die mit der Punctation und den Nunciatur-Streitigkeiten zusammenhangenden Actenstücke der vier Erzbischöfe, sondern auch viele darauf bezügliche Schriften ausführlich kritisirt, und der Papst sagt (c. 9 n. 7), er habe eine besondere Congregation von Cardinälen und Bischöfen beauftragt, die Actenstücke und Schriften zu prüfen, um sie einer schärfern Verurtheilung zu unterwerfen. Es stehen aber, — und das ist für die Systemlosigkeit, die in der Index-Congregation herrschte, charakteristisch, — nur zwei auf diese Sache bezügliche Schriften, von denen man nicht sagen kann, dass es die bedeutendsten waren, im Index. Auch von Hedderich und anderen Bonner Professoren, deren Schriften der Papst gleichfalls der besondern Congregation überwiesen und über die er sich auch sonst sehr scharf ausgesprochen, sind nur einzelne Sachen in den Index gekommen.
1. Joh. Nic. Hontheim, geb. 1701, wurde 1748 Weihbischof und Generalvicar des Kurfürsten von Trier, Franz Georg Graf von Schönborn (Generalvicar blieb er nur bis 1764). Im Sept. 1763 erschien zu Frankfurt: Justini Febronii JCti de statu ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber singularis, ad reuniendos dissidentes in religione christianos compositus, Bullioni apud Guil. Eccardum 1763, 621 S. 4. Hontheim wurde schon 1764 als Verfasser genannt, liess dieses aber in der Köln. Zeitung dementiren. Das Buch wurde sofort von den Nuncien in Köln und Wien nach Rom geschickt und 27. Febr. 1764 von der Index-Congr. verb. Unter dem 14. März erliess Clemens XIII. drei Breven an die Kurfürsten von Mainz und Köln, an den Kurfürsten von Trier und mehrere Bischöfe und an den Fürstbischof von Würzburg, mit der Aufforderung, das Buch zu unterdrücken (Bull. 2, 450). Der Kurfürst von Trier und mehrere Bischöfe verboten das Buch, der Erzbischof von Wien und die Bischöfe von Basel wurden noch 1764, der Fürstbischof von Würzburg im Febr. 1765 ermahnt, dasselbe zu thuen, die Universität Köln durch ein Breve vom 19. Oct. 1765 für ihre Censur das Febronius (und der Utrechter Synode) belobt (Bull. 3, 1. 16. 51. 140). — Die Editio altera priore emendatior et multo auctior, Bullioni 1765, 816 S. 4., wurde 3. Febr. 1766 verb. Die daraus besonders abgedruckten Vindiciae Febronianae seu refutationes nonnullorum opusculorum, quae adv. J- Febronii tractatum … nuper prodierunt, Turici (Frankf.) 1765, wurden nicht ausdrücklich verb., aber die vier Appendices der 2. Auflage werden in dem Decrete einzeln aufgeführt (in allen seit 1806 erschienenen Indices steht falsch das Datum 27. Febr. 1764 hinter der 1. und 2. Auflage und den 3 ersten Appendices, 3. Febr. 1766 nur hinter App. 4.).
Schon 1764 erschien eine deutsche Bearbeitung, 1766 eine italienische, spanische und portugiesische Uebersetzung. Der Rath von Castilien liess auf den Antrag von Campomanes 1767 auch das Original nachdrucken. Die in Venedig erschienene Uebersetzung von Franc. Rossi wurde im Kirchenstaate bei Galerenstrafe verb. In Wien wurde das Buch anfangs freigegeben, im December 1764 gleichzeitig mit der deutschen Bearbeitung verb., 1769 erga schedam freigegeben1). — Als der Jesuit Franc. Ant. Zaccaria, Bibliothekar des Herzogs von Modena, gegen dessen Verbot seinen Anti-febronio ossia apologia polemico-storica del primato del Papa contro la dannata opera di Giustino Febronio, Pesaro 1767, 2 vol. 4., veröffentlichte, wurde er von dem Herzog abgesetzt, von Clemens XIII. zum Professor an der Sapienza ernannt.
Unter dem 14. Oct. 1769 forderte Clemens XIV. den Kurfürsten von Trier, Clemens Wenceslaus Herzog von Sachsen, auf, das Erscheinen einer neuen Ausgabe des Febr., die dem Vernehmen nach jetzt in Frankfurt gedruckt werde, zu hindern, eventuell dieselbe zu verbieten (Bull. 4, 72). 1770 erschien, nicht eine neue Ausgabe, sondern Tomus secundus, ulteriores operis vindicias continens, Francof. et Lipsiae 1770. Es folgten noch T. 3., ulteriores …, 1772; T. 4., ulteriores … Pars I., 1773, P. II., 1774. Der 2. Band wurde 14. Mai 1771 verb. (steht aber in keinem Index), der 3. 3. März 1773; der 4. wurde nicht verb., auch nicht Justinus Febronius abbreviatus et emendatus, i. e. de statu eccl. tractatus ex s. scriptura, traditione et melioris notae catholicis scriptoribus adornatus, ab auctore ipso in hoc compendium redactus, Col. et LipS. 1777, 4.
Im J. 1778 gelang es dem Kurfürsten, Hontheim zu einem Widerruf zu bestimmen. Derselbe wurde an Pius VI. gesandt. Dieser erklärte aber in Breven vom 22. Aug. und 22. Sept. 1778, Hontheim müsse an seinem Widerruf noch einige Aenderungen, die genau angegeben wurden, vornehmen und den so geänderten Widerruf als den ersten, von ihm freiwillig verfassten (tanquam a se suaque sponte elucubratam) wieder einsenden. Hontheim nahm die Aenderungen an mit Ausnahme des Satzes: ut proinde merito monarchicum Ecclesiae regimen a catholicis doctoribus appelletur. Pius VI. erklärte sich mit diesem vom 1. Nov. datirten Widerruf in Breven an den Kurfürsten und an Hontheim vom 19. Dec. 1778 zufriedengestellt, theilte diesem mit, er lasse ihm alle canonischen und geistlichen Strafen nach, und forderte ihn auf, seine Schriften selbst zu widerlegen. Hontheim scheint eine Veröffentlichung seines Widerrufes nicht erwartet zu haben; aber Pius VI. hielt 25. Dec. 1778 ein Consistorium, um in einer Allocution den Widerruf Hontheims zu verkünden und die Actenstücke vorlesen zu lassen, und liess dann die Acta in Consistorio secreto habito etc. drucken1) und dem Kurfürsten übersenden. Auf dessen Verlangen publicirte Hontheim diese Acta mit einem (von dem Kurfürsten stark abgeänderten) Hirtenbriefe vom 3. Febr. 1779.
Hontheim äusserte um diese Zeit mündlich: „Ich habe einigermassen meine Schrift widerrufen, so wie ein viel gelehrterer Prälat, Fenelon, widerrief, um Zänkereien und Widerwärtigkeiten zu entgehen. Aber mein Widerruf ist der Welt und der christlichen Religion nicht schädlich und dem Römischen Hofe nicht nützlich und wird es auch niemals sein. Die Sätze meiner Schrift hat die Welt gelesen, geprüft und angenommen; mein Widerruf wird denkende Köpfe so wenig bewegen, diese Sätze zu verwerfen, als so manche Widerlegung, welche dagegen Theologaster, Mönche und Schmeichler des Papstes geschrieben haben.“ Im Frühjahr 1781 erschien in Frankfurt: Justini Febronii JCti commentarius in suam retractationem Pio VI. P. M. Kai. Nov. a. 1778 submissam, worin er in vorsichtiger Weise zu zeigen sucht, er habe mit seinem Widerrufe die Meinung in allem Wesentlichen nicht geändert. Er übersandte die Schrift dem Papste als die von diesem gewünschte Widerlegung seiner früheren Schriften, und mit der Erklärung, wenn ihm an diesem seinem literarischen Testamente etwas missfalle, sei er bereit, es in einem Supplemente, welches er dann als Codicill beifügen werde, zu verbessern. Pius VI. gab die Schrift dem Präfecten der Index-Congregation, Card. Gerdil, der allerdings Verbesserungen für nöthig erklärte. Der Papst befahl, Gerdils Animadversiones in Commentarium a J. Febronio in suam retract. editum als vorläufige Privatschrift gegen Febronius zu drucken; sie wurde aber erst 1792, nach dem Tode Hontheims, † 1790, veröffentlicht. Der Commentarius kam nicht in den Index.
Durch Hontheims Widerruf ist ein Buch von Zaccaria veranlasst: Theotimi Eupistini de doctis catholicis viris, qui Cl. Justino Febronio in scriptis suis retractandis ab anno 1580 laudabili exemplo praeiverunt, liber singularis, Rom 1791,* XXXII und 133 S. 4., worin u.a. M. Baius, E. Richer, P. de Marca, Fénélon, Card, de Noailles, Giannone, Montesquieu, Helvétius und M. A. de Dominis als Vorgänger Hontheims dargestellt werden. Das Buch war schon 1779 mit Approbation des Mag. S. Pal. Schiara gedruckt; der Papst verbot aber damals, wie es scheint, auf Grund von Vorstellungen einiger Gesandten, bis auf weiteres die Veröffentlichung. Schiara bemerkte in einem Briefe an Card. Albani, dem das Buch gewidmet ist und der sich für die Veröffentlichung interessirte, der Papst werde wohl aus Gründen der Klugheit, namentlich um die Franzosen nicht zu verletzen, die Veröffentlichung beanstanden, und rieth Zacc., einige Stellen wegzulassen. In dem Briefe kommen die merkwürdigen Aeusserungen vor: man müsse die Franzosen nicht zwingen wollen, ihre Ansicht von der Superiorität des allgemeinen Concils über den Papst zu Gunsten der richtigen, aber doch nicht von der Kirche definirten Ansicht aufzugeben; man dürfe auch nicht Appellanten und Jansenisten identificiren, sonst werde man fast alle Franzosen zu Jansenisten machen, und wenn man früher die sog. Jansenisten con più sincerità, e con minore acrimonia behandelt hätte, würde es gar keine Jansenisten geben. Zacc. remonstrirte gegen die verlangten Aenderungen, und das Buch scheint unverändert ausgegeben worden zu sein1).
2. Die Principia juris ecclesiastici catholicorum ad statum Germaniae accommodata in usum tyronum, Frcf. und Lpz. 1746, 4., verb. 1750, nach dem Verbote wiederholt gedruckt, in Oesterreich noch 1754 amtlich für die Vorlesungen empfohlen (Schulte 3, 2, 317), sind verfasst von Georg Christoph Neller, einem Freunde Hontheims, seit 1748 Prof. des canonischen Rechtes in Trier, † 1783. Neller wurde wegen dieses Grundrisses, der übrigens sehr massvoll ist, auch in Trier von den Jesuiten angegriffen; P. Jos. Gauthier schrieb 1750 Animadversiones dagegen. Auch von seinen zahlreichen Dissertationen wurden einige von den Jesuiten angegriffen (Schulte S. 213); im Index steht nur (unter Neller) Apologia hist.-canonica pro sancta provincia Romana, Johannem XII. Papam ut apostatam a. 963 reprobante et coram Ottone M. Imperatore … Leonem VIII. canonice eligente, 1766, verb. 1767.
Joh. Caspar Barthel, geb. 1697, gest. 1771 als Prof. des canonischen Rechts und Dechant des Stifts im Haug zu Würzburg, der einige Zeit in Rom bei dem Secretär der Congregatio Concilii, Prosper Lambertini gearbeitet und von diesem 1727 ein günstiges Zeugniss erhalten hatte, auch in Rom Doctor beider Rechte geworden war, wurde in Rom denuncirt, dass in seinen Collegienheften, die in Abschriften Verbreitung fanden, bedenkliche und für die päpstliche Autorität gefährliche Sätze vorkämen. Er schickte darauf 29. Dec. 1751 an seinen alten Lehrer, der jetzt als Benedict XIV. Papst war, ein Promemoria, worin er sich darauf beruft, dass in seinen gedruckten Schriften nichts Anstössiges vorkomme, bemerkt, dass er in seinen Vorlesungen nicht dictire und für die Nachschriften der Studenten nicht verantwortlich sei, dann aber über 10 einzelne Puncte Erklärungen gibt, die allerdings nicht ganz mit den curialistischen Ansichten übereinstimmen, von Benedict XIV. aber als genügend angesehen zu sein scheinen, da er nicht weiter belästigt wurde. Von seinen gedruckten Schriften steht keine im Index; seine Abhandlung De pallio, 1753, wurde in Rom nachgedruckt1). — Von den zahlreichen, meist anticurialistischen Dissertationen von Joh. Bapt. Horix, 1755—66 und 1776—89 Prof. in Mainz, † l7922) steht im Index nur Tractatiuncula de fontibus juris canonici germanici, qua praelectiones suas academicas ad 13. Nov. 1758 publice indicit … Mog., 46 S. 4., von der Inq. verb. 1759. (Der Name wird in den Indices Norix oder Herix gedruckt). Seine Concordata nationis germanicae integra praemissa introductione historica, 1765—73, werden in der Responsio Pii VI. p. 165 als Collectio maxime infensa S. Sedi bezeichnet, stehen aber nicht im Index.
Am 16. Febr. 1764 verdammte die Inquisition vier Hefte Theses, die im J. 1761 und 63 unter dem Präsidium von Benedict Oberhaus er zu Fulda vertheidigt worden waren (ex historia de processu judiciali antiquo, de legum materia, ex hist. juris ecclesiastici de usu sacrae potestatis maxime in Germania) und desselben Praelectiones canonicae juxta titulos l. I., II. et III. decretalium, ex monumentis, auctoribus et controversiis melioris notae … hodierno eruditionis genio et studio accommodatae (Salzb. 1761, Antw. 1762), 3 vol.3). Das Verbot wurde aber nicht gleich publicirt (es steht nicht in der bis zum 27. Febr. 1764 gehenden Appendix des Index von 1770), sondern dem Verfasser mit einer Retractations-Formel übersandt, die er 25. Juni 1764 unterschrieb (N. E. 1765, 126). Darauf wurde das Verbot 7. Jan. 1765 von der Index-Congr. publicirt mit dem Zusatze: quas theses ac praelect. juxta decretum S. Off. 16. Febr. 1764 proscriptas auctor ipse errore agnito laudabiliter et solemniter retractavit reprobavitque. Oberhauser, Benedictiner in Lambach, war seit 1760 Professor des Kirchenrechts und geistlicher Rath in Fulda, wurde wegen seiner anticurialistischen Richtung bei dem Nuncius in Köln denuncirt und dieser untersagte ihm das Dociren (er wird also auch seine Schriften in Rom denuncirt haben). Oberhauser kehrte nach Lambach zurück, wo er 1786 starb. Von seinen späteren anticurialistischen Schriften, — seine Grabschrift bezeichnet ihn als Ultramontanistarum malleus (Schulte S. 224), — steht keine im Index, auch nicht Z. B. van Espen Jus eccl. in epitomen redactum, 1782, 2 vol. In den N. E. 1778, 135 wird berichtet, der Nuncius in Wien habe erwirkt, dass sein Tractatus de primatu, specimen cultioris jurisprudentiae canon. ad justas ideas divini primatus in Rom. Eccl. evolvendas, Salzb. 1777, nur erga schedam verkauft werde. — 1764 wurde eine Schrift von Adam Franz Kollar, damals Scriptor an der Hofbibliothek zu Wien (er war 1738—48 Jesuit gewesen), verb.: De originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae circa sacra Apostolicorum Regum Hungariae, Wien 17641), — 1766: Positiones ex jure universo, quas sine praeside publicae disputationi submittit Ign. Jos. Andr. S. R. I. Comes de Tannenberg, Societatis lit. Roboretanae socius, wahrscheinlich die N. E. 1767, 104 besprochenen, im Passauer Seminar (unter Bischof Firmian) vertheidigten gemässigt gallicanischen Thesen.
3. In einem Breve vom 17. Sept. 1765 (Bull. 3, 220) belobt Clemens XIII. den Bischof von Freising und Augsburg, Clemens Wenceslaus von Sachsen, für ein Edict gegen schlechte Bücher, namentlich gegen eins, dessen Verfasser die Kirche ihrer Immunitäten zu berauben suche. Es wird die pseudonyme Schrift von Peter von Osterwald sein: Veremunds von Lochstein Gründe sowohl für als wider die geistliche Immunität in zeitlichen Dingen, herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von F. L. W., Strassb. 1766, welche durch ein an allen Kirchenthüren zu München angeheftetes Patent des Bischofs vom 13. Aug. als ein gottloses Buch bei Strafe der Excommunication verboten wurde (das Patent wurde auf Befehl des Kurfürsten entfernt) und 1767 auch in den Index kam2). Am 3. Dec. 1770 wurde verb.: Briefe eines Baiern an seinen Freund über die Macht der Kirche und des Papstes, s. l. 1770, von Andreas Zaupser in München, der in strengkirchlichen Kreisen auch durch andere Schriften Anstoss erregte3). Veranlasst war das Verbot der Briefe durch den Erzbischof von Salzburg, Hieron. Franz Fürst Colloredo, an den Clemens XIV. (Epist. ed. Theiner p. 91) 6. Juni 1770 schreibt: er habe seinen Brief und die Censur seiner Universität über die Briefe erhalten; der Erzbischof möge die Briefe, als falsche, … sacrilegische, zu Ketzerei und Schisma führende und früher von dem apostolischen Stuhle verdammte Sätze enthaltend, in seiner Diöcese sogleich verbieten, aber kraft seiner bischöflichen Gewalt, nicht im Namen des Papstes, „damit Wir nicht Dingen ein Gewicht beizulegen scheinen, welche sich vielleicht manchmal, wenn man sie ignorirt, um so weniger halten können und wegen ihrer Unbedeutendheit untergehen, indem Wir Uns ein Eingreifen mit Unserer apostolischen Autorität nöthigen-falls für später vorbehalten.“
Mit ungewöhnlicher Milde wurde unter Clemens XIV. der Cistercienser Ulrich Mayr zu Kaisersheim behandelt. Er promovirte 1772 zu Ingolstadt bei Gelegenheit der Säcularfeier der Universität mit juristischen Thesen und einer Dissertatio historico-polit. de nexu statisticae cum jurisprudentia ecclesiastica, worin er Richer, de Marca, Sarpi, Febronius und protestantische Schriftsteller citirt und manche Sätze vorträgt, die in Rom Anstoss erregen mussten. Unter dem 24. Febr. 1773 schrieb der Papst an den Kurfürsten Clemens Wenceslaus von Trier als Bischof von Augsburg: die Inquisition habe die Dissertation geprüft und voll von Irrthümern gefunden; er übersende dem Kurfürsten das noch nicht publicirte Verdammungsdecret und bitte ihn, den Verfasser zu bestimmen, dass er eine neue Dissertation drucken lasse und in dieser non obscure erkläre, dass er die in der frühern ausgesprochenen Ansichten verwerfe. Der Kurfürst schrieb darauf an den Abt und erhielt von diesem die Antwort: die Dissertation habe allgemeinen Beifall gefunden; Mayr sei ein treuer Anhänger des Papstes und werde, sobald sich eine passende Gelegenheit finde oder der Papst es deutlicher verlange, für den h. Stuhl eintreten. Nach einiger Zeit berichtete der kurtrierische Gesandte in Rom: der Papst verlange nicht, dass Mayr seine Dissertation widerrufe, da er nicht eine Beschämung desselben, sondern nur Besserung seiner Gesinnung wünsche. Für jetzt werde es genügen, wenn man sich bemühe, die Exemplare der Dissertation zu unterdrücken. Mayr solle aber eine passende Gelegenheit ergreifen, um die vorgetragenen Ansichten bei dem Publicum zu entschuldigen und das gegebene Aergerniss zu beseitigen. Ueber die Zeit und die Art und Weise wolle der Papst nichts bestimmen, vielmehr das Weitere dem Kurfürsten und dem Abt überlassen. Es wird dann noch ausführlich angegeben, was Mayr etwa bei Gelegenheit der Vertheidigung von Thesen in Ingolstadt oder in seinem Kloster sagen könne (Walch, Neueste Rel.-Gesch. 5, 219). Mayr veröffentlichte 1774 zu Augsburg Biga dissertationum de nexu historiae literariae cum studio theol. ac de nexu statisticae cum jurispr. eccl., Ed. 2. (N. Bibl. Frib. 1, 46), und kam nicht in den Index. Die Schrift erschien auch deutsch: Ueber den Einfluss der Gelehrtengeschichte auf das Studium der Gottesgelehrtheit …. nebst Geschichte der Bewegungen des Röm. Hofes gegen diese Schrift, Augsb. 1778.
Die Inq. verbot 26. März 1767 Libellus germanica lingua editus qui sie latine redditur: Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Papae; Papae, wohl eine ältere Ausgabe der Schrift: Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und dem Papste, was des Papstes ist, Köln 1782, 80 S. (N. Rel.-Beg. 1783, 5). Eine französische Schrift mit einem ähnlichen Titel: Rendez à Cesar ce qui appartient à Cesar. Introduction à une nouvelle hist. des papes, 1783, 149 S. 8., wurde nicht verb., aber 1788 Rendete a Cesare ciò ch’e di Cesare, Si vende in Italia, 2 vol. 12., wogegen Zaccaria Rendete … Cesare, ma si a Dio rendete quel ch’è di Dio, 1788, schrieb (G. eccl. 3, 397).
4. Die anonyme Schrift des Luzerner Kleinraths Jos. Anton Felix von Balthasar, †1810, DeHelvetiorum juribus circa sacra, d. i. Kurzer historischer Entwurff der Freyheiten und der Gerichtsbarkeit der Eidsgenossen in sog. geistlichen Dingen, Zürich 1768, wurde von dem Nuncius denuncirt und 1. Febr. 1769 von der Inq. verb. Der Bischof von Constanz forderte die zu seiner Diöcese gehörenden Cantone auf, die Schrift zu verbieten; die meisten lehnten ab, aber in Zug wurde sie verbrannt. 1769 erschienen in gleichem Format und Druck wie Balthasars Schrift, aber s. l. Reflexionen eines Schweizers über die Frage: Ob es der catholischen Eidgenossschaft nicht zuträglich wäre, die regulären Orden gänzlich aufzuheben oder wenigstens einzuschränken, und bald darauf eine in demselben Sinne gehaltene Widerlegung der Reflexionen. Die Reflexionen (nicht die Widerlegung) wurden 13. Sept. 1769 von der Inq. verb. Beide Schriften wurden auch in Luzern verb. Valentin Meyer, der als Verfasser angesehen wurde, leugnete dieses ab und die Züricher Regierung nannte im Einvernehmen mit dem Verleger den Rathsherrn Heidegger als Verfasser der Reflexionen; die Widerlegung sei anonym eingesandt; sie ist von Meyer. Dass Balthasar der Verfasser der ersten Schrift war, blieb lange unbekannt. In einem Breve vom 27. Sept. 1769 belobt Clemens XIV. den Nuncius in Luzern, dass er dort das Verbot der Reflexionen erwirkt, und beauftragt ihn, den Pfarrer Gloggner und den Schultheiss Balthasar dafür zu beloben, dass sie ihn unterstützt hätten1).
5. Von Jos. Valentin Eybel (1741—1805) wurde Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum, 1777, 2. Ed. 1778ff., 4 vol. 8., 1784 von der Index-Congr. verb. Noch in demselben Jahre 21. Nov. erliess Pius VI. ein eigenes Breve (es füllt im Bull. 7, 339 sieben Spalten) gegen seine Schrift: Was enthalten die Urkunden des christlichen Alterthums von der Ohrenbeichte? Wien 1784, 88 S. 8. Der Papst sagt: er habe die Schrift ins Lateinische übersetzen (es erschien noch in demselben Jahre auch in Wien eine lateinische Uebersetzung) und durch mehrere Theologen und die Cardinäle der Inq. prüfen lassen, und verdamme sie, implorato divino lumine (diese Formel ist nicht gewöhnlich in solchen Breven) motu proprio etc. als resp. falsche, … ketzerische und von dem Trienter Concil für ketzerisch erklärte Lehren und Sätze enthaltend, bei Strafe der Excomm. 1. sent. (in anderen Breven wird Laien Excomm., Geistlichen Suspension angedroht)2). — Die schon 1782, unmittelbar vor der Ankunft Pius’VI. in Wien anonym, „mit Dispensation der k. k. Bücher-Censur-Commission wegen Beisetzung des Namens“ erschienene Broschüre Eybels: Was ist der Papst? 48 S. 8., wurde erst 28. Nov. 1786 durch ein Breve verdammt. Es heisst darin: Eybel, ein frecher und durch seine vorlängst verdammten Schriften nur zu sehr bekannter Mann, habe seine feindselige Gesinnung gegen Pius VI. und den apostolischen Stuhl dadurch bekundet, dass er, als er von der Reise des Papstes nach Wien gehört, jene Schrift mit dem unehrerbietigen Titel seinen Landsleuten aufzudrängen sich beeilt habe; der Papst habe dieselbe nicht gleich damals verdammt, um nicht zu dem Verdachte Anlass zu geben, als ob er das aus persönlicher Gereiztheit gethan, und weil er geglaubt habe, ein so unbedeutendes Product werde besser ignorirt; da er aber jüngst erfahren, dass die Schrift wiederholt gedruckt, auch in andere Sprachen, sogar in die neugriechische, übersetzt worden sei, glaube er einschreiten zu müssen. Schliesslich wird die Schrift nach Anhörung der Inq. verdammt als resp. falsche, . . schismatische, . . ketzerische und sonst von der Kirche verdammte Sätze enthaltend, bei Strafe der reservirten Excomm. resp. Suspension 1. sent. u. s. w. — Es bleibt doch auffallend, dass Eybels Schrift nicht einfach 1782 in den Index gesetzt, sondern erst 1786 durch ein so umfangreiches besonderes Breve verboten wurde, — dasselbe füllt im Bull. 7, 671 13 Spalten, — nachdem nicht nur viele deutsche, sondern auch einige lateinische und italienische Widerlegungen, u.a. eine von Zaccaria, erschienen waren. Der Ex-Jesuit Aloys Merz erhielt für sein Responsum cath. ad quaestionem: Quid est papa? Augsb. 1782, 75 S. 8., noch von Wien aus ein Belobungsbreve1). — Von den Vertheidigungen der Schrift steht keine im Index, auch keine von Eybels anderen Schrift: Was ist ein Bischof? Was ist ein Pfarrer? Was ist ein Ablass? u. s. w.
Der Freimüthige I, 545 sagt: die in Eybels Schrift über den Papst aufgestellten Grundsätze stimmten genau überein mit jenen, die seit mehreren Jahren auf k. k. Befehl in allen österreichischen Schulen nicht nur öffentlich gelehrt, sondern von allen Welt- und Ordensgeistlichen, von den Candidaten um Benefizien und die akademische Doctorwürde vertheidigt werden müssten, und beruft sich auf die amtliche Synopsis doctrinae quam candidati ad supremam in theologia lauream aspirantes in praestituto ex jure eccl. tentamine propugnabunt, Wien 1669 (von Stock entworfen, N. E. 1774, 43), und Synopsis juris eccl. quod per terras haereditarias Aug. Imp. Mariae Theresiae obtinet, Wien 1776, 77 S. (von Rautenstrauch, trotz eines ausführlichen Gutachtens des Erzbischofs Migazzi von Maria Theresia genehmigt; Arch. f. österr. Gesch. 50, 301; Kink, Gesch. der Univ. Wien 1, 535). Diese Synopses stehen nicht im Index.
Von den zahllosen schlechten Broschüren, die damals erschienen, würdigte Pius VI. noch eine eines besondern Breve’s vom 17. Nov. 1784 (Bull. 7, 330; 5 Spalten): Allgemeines Glaubensbekenntniss aller Religionen, dem gesunden Menschenverstände gewidmet; 1784, mit dem Motto: Erkenne Gott an und sei ein ehrlicher Mann. Der Papst bezeichnet die Schrift als zwar von geringem Umfange, aber mit schwarzer Galle und Gift gefüllt, führt speciell eine Stelle an, wo gesagt wird: es sei nirgend geboten und könne nicht geboten werden, recht zu denken, sondern recht zu handeln, und wenn einer dieses thue, komme es nicht darauf an, ob er ein Jude, Türke, Heide, Christ oder Naturalist sei, und verdammt sie als falsche, … ketzerische, und die ganze geoffenbarte Religion untergrabende Sätze enthaltend. — Der Erzbischof Migazzi beschwerte sich über diese „ärgerliche und elende Broschüre“ und die Censur-Hofcommission stimmte ihm bei; weil sich aber Migazzi auf das Römische Verbot berief, blieb die Schrift unangefochten. Auf die Beschwerde Migazzi’s, dass das „Glaubensbekenntniss eines nach Wahrheit ringenden Mannes“, 1785, freigegeben worden, wurde erwiedert, es sei ein dichterisches Werk und schildere die Lage eines im Glauben noch nicht befestigten Mannes (Archiv f. österr. Gesch. 50, 336). Es ist von Aloys Blumauer. „Glaubensbekenntniss eines mit dem Tode ringenden Mannes, Herrnhut 1785“, im Index seit 1786, wird dasselbe sein. Sonst stehen von Wiener Producten dieser Art noch im Index (zum Theil unter Libellus): Nichts Mehreres von Ehedispensen, als was Religion, Recht, Nutzen, Klugheit und Pflicht fordert. Melius est ut scandalum oriatur, quam ut veritas reticeatur. S. Greg. M. Wahrheitsthal bei den Gebr. von der Brust 1782; Heinr. Jos. Watteroth für Toleranz überhaupt und Bürgerrechte der Protestanten in kath. Staaten, 17811); Schreiben eines österreichischen Pfarrers über die Tolerantz nach den Grundsätzen der kath. Kirche, 1781, nach Roskovany 3, 922 von Wittola2), alle drei 1783 verb.; Die Unzufriedenen in Wien mit Josephs Regierung von J. B(iwanko), 1782, verb. 1784; Von der Appellation an den Röm. Stuhl, von Wenceslaus Grillparzer, 1785, verb. 1787. Das Mainzer Rel.-Journ. bemerkt zu der Schrift über die Ehedispensen 1783, 8, 384: „Wie viel würde die Römische Curie zu thun bekommen, wenn die sog. Wiener Reformationsschriften in lateinischer oder italienischer Sprache dort erschienen!“ Es scheint es also nicht für die Aufgabe der Curie gehalten zu haben, sich auch mit deutschen Schriften dieser Art zu thuen zu machen. Die „vollständige [?] Sammlung aller Schriften, die durch Veranlassung der kaiserlichen Toleranz- und Reform-Edicte … erschienen sind“, wovon 1784 schon 4 Bände zu Wien gedruckt waren (N. Rel.-Beg. 1784, 466), steht nicht im Index.
Joannis Phisiophili opuscula; continent: Monachologiam; Accusationem Phisiophili; Defensionem Phisiophili; Anatomiam monachi. Collegit, edidit et praefatus est P. Aloysius Martius. Aug. Vind. 1784, verb. 1784, ist die 2. vermehrte Auflage der bittern Satire auf die Mönche von dem Mineralogen Ignaz von Born, † 1791 (er war 16 Monate Jesuit gewesen), den Seb. Brunner, Theol. Die-nersch. S. 115 als den begabtesten unter dem Tross der Pamphletisten bezeichnet, und der auch deutsche Schriften der Art verfasst hat. Die Monachologia wurde auch ins Deutsche, Französische, Englische und Italienische (von Carlo Botta 1801) übersetzt. Migazzi bemühte sich ohne Erfolg bei dem Kaiser für die Unterdrückung des Buches1).
Jo. Nep. Bartholotti Exercitatio politico-theologica, in qua de libertate conscientiae et de receptarum in Imperio Romano Theutonico religionum tolerantia cum theologica tum politica disputatur necnon de disjunctorum statu graecorum tractatur, Wien 1782, 263 S. 8., verb. 1785, ist eine Verteidigung des Toleranz-Edictes von 1781; der Verfasser war Assessor des Censurcollegiums, früher Prof. der Theologie (N. E. 1783, 18). Gegen diese und ähnliche Schriften erschien: Della punizione degli eretici e del tribunale della S. Inquisizione. Lettera apologetica. 1789, 2 vol. 8. (G. eccl. 4, 247; 11, 1). 2. Ed. aumentata 1795. — 1777 wurden zwei juristische Dissertationes inaugurales von Fr. Bihl und Ant. Remiz (Carnio-lus de commenda S. Petri, Wien 1774) verb. — Von den von Robert Curalt, Cistercienser in Sittich, verfassten Genuina totius jurisprudentiae sacrae principia, Wien 1781, 2 vol., wurde nur die italienische Uebersetzung (von Tamburini) 1790 verb.: Principii genuini di tutta la giurisprudenza sacra, con nuovo, acconcio e facil metodo trattati . . coli’ aggiunta di nna prefazione e di alcnne note, Prato 1787, 3 vol. (Schulte S. 290). — Caspar Royko’s Geschichte der grossen und allgem. Kirchenversammlung zu Costnitz, 1. und 2. Band, Prag 1780. 83, wurde 1783 verb.1), der 3. und 4. Band, 1784. 85, nicht, Dannemayers Kirchengeschichte und andere Bücher aus dieser Zeit erst 1820.
6. Während bis zum J. 1763 eine Reihe von Hirtenbriefen französischer Bischöfe in den Index gesetzt wurde, ist dieses keinem der deutschen Hirtenbriefe begegnet, obschon man z.B. an mehreren nach dem Toleranzedict von 1781 erschienenen in Rom grossen Anstoss nahm. Ueber die Verhandlungen wegen eines derselben, des von dem Bischof von Laibach, Carl Joseph Graf von Herberstein, 1782 erlassenen, theilt Brunner S. 132 aus den Berichten Herzans vom J. 1786 folgendes mit: Der Papst erklärte in einem Briefe an den Kaiser, er sei bereit, Laibach zum Erzbisthum zu erheben, müsse dieses aber verschieben wegen der Irrsätze, die der Bischof in jenem Hirtenbriefe gelehrt habe (Herzan glaubte, derselbe sei von mehreren ausländischen Bischöfen denuncirt worden). Der Staatssecretär sagte Herzan, man nehme namentlich daran Anstoss, dass in dem Hirtenbriefe nicht bloss von politischer Toleranz der Akatholiken gesprochen, sondern gelehrt werde, dass ein jeder das Recht habe, sich einen Glauben zu wählen, welchen er wolle2). Herzan meinte, durch eine Erklärung des Bischofs über den eigentlichen Sinn der beanstandeten Stellen in einem ehrerbietigen und verbindlichen Briefe an. den Papst werde die Sache beigelegt werden können. Die von dem Bischof gegebene Erklärung missfiel aber in Rom; auch Herzan nannte sie seicht und dunkel und meinte, er hätte besser einfach sein Missvergnügen darüber ausgedrückt, dass durch eine unrichtige Uebersetzung einigen Stellen ein unrichtiger Sinn zugeeignet worden, und erklärt, dass er nur die civile, nicht die theologische Toleranz gemeint habe. Im J. 1787 übersandte dann der Papst dem Kaiser mit einem vertraulichen Schreiben ein Breve für den Bischof, — eine theologische Abhandlung von mehreren Bogen, von dem Prälaten Stay verfasst, von dem Card. Gerdil stark corrigirt; — als dem Papste die Antwort des Bischofs überreicht wurde, war er eben (7. Oct. 1787) gestorben. Der Papst sagte aber Herzan: die Antwort sei bei weitem nicht genügend; wenn der Bischof nicht widerrufen hätte, würde er seine Briefe sammt dem Breve mit einigen Anmerkungen haben drucken lassen, um sich vor der ganzen Kirche zu rechtfertigen. — Als andere Hirtenbriefe, an denen man in Rom Anstoss nehmen musste, von denen aber keiner im Index steht, nennt Brunner S. 324 noch einen lateinischen vom J. 1781 von dem Bischof Joh. Leop. von Hay von Königgrätz1) und einen deutschen vom J. 1782 von dem Fürstbischof Colloredo von Salzburg, beide über Toleranz (von dem Bischof von Mantua 1781 über Ehedispensen, von dem Bischof Morosini von Verona 1782 gegen Bruderschaften).
7. Die in der Responsio Pii VI. P. M. ad Metropolitanos Moguntin., Treviren., Colonien. et Salisburgen. super nuntiaturis apotolicis, Rom 1789, 336 S. 4.2), erwähnte Congregation (S. 941) kam, — wie Pacca angibt, in Folge der Invasion Roms durch die Franzosen, *— mit ihren Berathungen nicht zu Ende: wenigstens erfolgte keine weitere Verdammung. Die beiden einzigen auf diese Sache bezüglichen Schriften, die im Index stehen, sind: Betrachtung über das Schreiben des P. Pii VI. an den Fürstbischof von Freysingen vom 13. Oct. 1786, mit teutscher Freymüthigkeit entworfen von Jos. Hermann. Gedruckt zu Damiat 1787 (Pacca war Erzbischof von Damiata i. p.), verb. 1788, und: Gedanken über die Punktation des Embser-Congresses und die im Streit befangene päpstliche Nunziatursache im römischen deutschen Reiche von H. D. T. J. Gedruckt in Deutschland 1790*, 175 S. 4., verb. 1790. Der Titel der Schrift von Hermann steht im Index in italienischer Uebersetzung; auch in der Responsio werden die Titel der deutschen Schriften und sogar die Stellen aus denselben italienisch angeführt. Besonders auffallend ist, dass die schon 1785 zu Salzburg erschienene, auf Veranlassung eines Kurfürsten geschriebene Dissertatio hist. can. de legatis et nunciis, 102 S. (N. E. 1786, 85), nicht im Index steht, von der Pacca Denkw. S. 8 berichtet, er habe sie auf Zaccaria’s Vorschlag widerlegen sollen, und die in der Responsio ausführlich bekämpft wird.
Von den zahlreichen lateinischen Schriften des Minoriten Philipp (in saeculo Franz Anton) Hedderich, seit 1775 Lehrer des Kirchenrechts in Bonn (Schulte S. 267), wurden 1780 verb.: Dissertatio juris eccl. de potestate principis circa ultimas voluntates ad pias causas earumque privilegia, 1779, und Systema quo praefatione praemissa praelectiones suas publicas indicit, 1780. In einem Breve an den Kurfürsten vom 30. Aug. 1783 führt Pius VI. unter den Gründen, weshalb er die von ihm errichtete Bonner Universität nicht bestätigen könne, auch diesen an, dass bei dem Kurfürsten Hedderich in Ansehen stehe (isthic florere apud te audimus Hedderich), dessen durch den Druck bekannt gewordene Ansichten der Art seien, dass die jungen Leute bei ihm nichts Gutes lernen könnten. Bei Gelegenheit der Eröffnung der neuen Universität im J. 1786 veröffentlichte Hedderich De juribus et libertatibus Ecclesiae germanicae in conventu Emsano explicatis et de jure archiepiscoporum circa beneficia mensium inaequalium. Pacca, Denkw. S. 33, sagt, auch diese Schrift würde in den Index gekommen sein, wenn nicht, bevor das Urtheil gesprochen worden, in Folge der ersten Invasion Roms durch die Franzosen alle damals bei der Congregation anhängigen Sachen liegen geblieben wären. Am 24. bzw. 27. März 1790 schrieb Pius VI. an den Kurfürsten und das Kölner Domcapitel (Bull. 8, 400) über die schlechten Lehren, die in Bonn vorgetragen würden (pessimae notae doctrinae an den Kurfürsten, doctrinarum portenta et monstra an das Capitel). Hedderich, Spiegel, Spitz, Weimer, Froitzheim, P. Thaddaeus, Schneider und andere Lehrer der Universität hätten durch ihre Lehren solches Aergerniss gegeben, dass er letztere zu verdammen genöthigt sein werde; er habe die besondere Congregation, die für die Streitigkeit mit den deutschen Erzbischöfen bestellt sei, mit der Prüfung ihrer Schriften beauftragt. In dem Briefe an den Kurfürsten erwähnt der Papst eine gegen die Bonner gerichtete Schrift, die ihm zugesandt worden sei, Parallelismi inter Lovaniensium Bonnensiumque doctorum sententias specimen I. in bonum religionis cath. a Theodulpho Jos. van den Elsken, clerico Juliacensi nepote patruo suo scriptum, Düsseld. 17901). — Dass die besondere Congregation nichts zu Stande gebracht, mag ja in dem Einrücken der Franzosen seine Erklärung finden; aber dass Hedderichs erwähnte Dissertation nicht im Index steht, ist nicht so verzeihlich, wie Pacca es darstellt; denn 1792 wurde die jedenfalls harmlosere Dissertatio historico-ecclesiastica de arehidiaconatibus in Germania et Eccl. Coloniensi, speciatim de archidiaconatu majore Bonnensi, quam praes. Andrea Spitz … defendet Frid. Georg. Pape, Eccl. Praemonstr. Weddinghus. [Arnsberg] Can. cap., Bonn 1790, verb., und 1797 Hedderichs Elementa juris canonici quatuor in partes divisa ad statum Ecclesiae, Bonn 1791, 6 vol. (zuerst 1778. 85). In der Responsio Pii VI. wird er p. 194 als Auctor Apost. Sedi inter omnes infensissimus bezeichnet und auch gegen andere als die hier genannten Schriften polemisirt. Von P. Thaddaeus a S. Adamo (Anton Dereser) steht im Index nur Commentatio biblica in effatum Christi Mth. 16, 18. 19: Tu es Petrus etc., quam . . publico tentamini subjicit Adrianus ex Wipperfürth Ord. Capuc. Bonnae in aula acad. 1789, 31 S. 4., verb. 1790, von Eulogius Schneider, dem am wenigsten respectabeln aus diesem Kreise1), nur „Katechetischer Unterricht in den allgemeinsten Grundsätzen des praktischen Christenthums, 1791, verb. 1791 (noch heute steht im Index: Institutio catechetica … edita germanico idiomate). Jedenfalls konnten sich die Bonner über besondere Härte der Index-Congr. nicht beklagen. Wenn Hedderich sich schon 1783 als jam quater Romae damnatus bezeichnen liess (Rel.-Journ. 1783, 491), so war das eine übertreibende Renommage. — Jo. Weimer wollte 1787 in Köln anticurialistische Thesen über den Primat vertheidigen. Der Nuncius Pacca erwirkte ein Verbot und schickte die gedruckten Thesen nach Rom. Pius VI. belobte in einem Breve vom 14. Febr. 1787 die Universität, dass sie die Vertheidigung nicht gestattet (Pacca, Denkw. S. 35. 198); im Index stehen aber auch diese Thesen nicht.
Von einigen Büchern ist es auffallend, dass sie nicht im Index stehen, obschon sie in Rom nicht unbekannt waren: Die in Köln 1787 erschienene abgeänderte Ausgabe von M. v. Schenkls Juris eccl. syntagma wurde im G. eccl. 1789 recensirt (Schulte S. 286); gegen Aniani Eliphii Concordia juris can. cum edictis caesareo-regiis . . in materia dispensationum super impedimentis matrimonii ad Hungaricum clerum, Wien 1781, 75 S. (N. E. 1783, 15), schrieb Zaccaria 1789 eine besondere Dissertation (Schulte S. 521); Jos. Friedels Briefe aus Wien verschiedenen Inhalts an einen Freund in Berlin, 1784 (über die Gelder, die nach Rom fliessen), werden in Pacca’s Denkwürdigkeiten S. 208 ausführlich bekämpft; über Die Religion der ehrlichen Leute von dem polnischen Piaristen Stan. Konarski berichtete der Nuncius Durini 1769 nach Rom (Theiner, Clemens XIV. 1, 297.431); Ferd. Stögers Einleitung zur Kirchengeschichte, 1776, 196 S. 8., wurde von dem Erzbischof Migazzi und anderen Bischöfen angegriffen, und im Nov. 1777 schrieb Pius VI. darüber an den Kaiser (N. E. 1779, 21); der Nuncius Bellisomi bemühte sich 1778 vergebens, den Fürstbischof von Würzburg zu Massregeln gegen Michael Ignaz Schmidt wegen seiner Geschichte der Deutschen zu bestimmen2); auf Veranlassung Pacca’s cen surirten die Kölner Theologen in einem 1790 gedruckten Judicium die Opuscula de Deo uno et trino von dem Trierer Ant. Oehmbs und bezeichneten mehrere Sätze als ketzerisch (Brück, Die rationalist. Bestrebungen, 1865, S. 40). Herzan. berichtet 1777 (Brunner S. 37): der Papst habe ihm gesagt, das h. Officium habe zwei zu Wien gedruckte Katechismen geprüft; der von 1773 sei voll Fehler und könne nicht gestattet werden, der andere sei gut, obwohl bei einer neuen Auflage einige Wahrheiten klarer gesetzt werden sollten.
1) Anfangs wünschte Clemens XIII, man möge Febronius nicht direct bekämpfen, um nicht der Controverse eine grössere Ausdehnung zu geben. Die ersten Gegenschriften erschienen in Deutschland, — zuerst die nichts weniger als scharfe Justiniani Febroniani Epistola ad Justinum Febronium. von Eusebius Amort auf Veranlassung Ricchini’s geschrieben, — aber von 1766 an erschien eine ganze Reihe von Entgegnungen in Italien. Friedrich, Beitr. zur Kirchengesch. S. 43. O. Mejer, Febronius. Weihbischof J. N. v. Hontheim und sein Widerruf, 1880, S. 84.
1) Sitzungsber. der W. Ak. Ph.-Hist. Cl. 84, 432. In dem Wiener Index von 1780 stehen Zaccaria’s Antifebronio (auch die deutsche Uebers. von P. W. Reichenberger, 1768) und Antifebronius vindicatus, Frcf. 1773 (Rom 1772—73, 4 vol. 8.) und Viatoris a Cocaleo Italus ad Febronium, Frcf. 1773 (Lucca 1768, von dem Capuciner Viatore da Cocaglia). Mejer S. 87.
1) Abgedr. bei C. Brancadoro, Pii VI. Allocutiones…, 1792, p. 68 Bull. 6, 50.
1) Beilagen zum Mainzer Rel.-Journal (1780), 3, 9. N. E. 1779, 201. Milizia (s.u.) p. 111. 113 schreibt: der österreichische Gesandte Herzan habe die Veröffentlichung zu hintertreiben gesucht; der Papst sei dafür, der Cardinal Staatssecretär dagegen gewesen; dieser habe, als schliesslich der Mag. S. P. nach einer Berathung mit den Revisoren die Veröffentlichung gestattet, seufzend gesagt: Ah, voi altri claustrali ignorate la salsa delle conseguenze.
1) Schulte 3, 1, 183. Das Promemoria abgedr. im Chilianeum, 1862, 1, 499.
2) Schulte S. 241. Friedrich, Das päpstlich gewährleistete Recht der deutschen Nation etc., 1870, S. 1.
3) In den Indices von 1878 und 1881 steht vol. tres.
1) Das Buch wurde auf Betreiben der Ungarn in Wien 1764 verb., aber 1769 erga schedam frei gegeben. Arneth, Maria Theresia 7, 114. Sitzungsber. 84, 457.
2) Sicherer, Staat und Kirche S. 8. Annalen der baier. Lit. 1, 28.
3) Schulte S. 283. Rel.-Journal 1780, 5, 565. In München wurden 1780 Schriften von ihm, namentlich die Ode auf die Inquisition, 1777, strenge verb. Annalen 1, 223. Sicherer S. 14.
1) Theiner, Epistolae Clem. XIV. p. 31. Pfyffer, Gesch. von Luzern 1, 505. L. Snell, Gesch. der Einführung der Nunciatur in der Schweiz, 1847, S. IL. 92. Theiner, Clemens XIV., 1, 288 verwechselt die Reflexionen mit den Riflessioni von Pilati. Gegen diese erklärte sich die Conferenz der katholischen Stände zu Frauenfeld, die, wie Theiner S. 289. 427 sagt, anfangs eine unkirchliche Sprache führte und Asylrecht und Immunität aufheben wollte, aber von dem Nuncius und den Bischöfen von Chur und Constanz „eingeschüchtert“ wurde. 1823 ist erschienen: F, Balthasar, Kurzer hist. Entwurf… Neue, vom Verf. selbst noch verbesserte Auflage.
2) N. Rel.-Beg. 1784, 347. 379; 1785, 248. Eibels gottlose Lehre von der Ohrenbeicht enthüllt von Georg Feiner, 1784, 37 S. 8., angeblich zu Augsburg mit Approbation erschienen (diese erklärte das General-vicariat für unecht), ist wahrscheinlich von Eybel selbst. (Freimüth. 3, 392). Diese Schrift und Was ist der Papst? 2. verbesserte und von vielen Druckfehlern gereinigte Ausg. von G. Feiner, 1782, stehen im Wiener Index von 1816, In Pavia 1787 erschienen 1787 Osservazioni … di Lor. Aliprandi Dott. in Teol. sul libro del S. Eybel… 378 S. 8. (G. eccl. 3, 24).
1) Beil. zum Rel.-Journal 4, 23. Auch Fr. A. Denneville erhielt für die Uebersendung von Sechs Predigten, Strassb. 1784, ein Belobungsbreve, worin Pius VI. sagt, er habe sich, da er selbst kein Deutsch verstehe, von einem Gelehrten darüber berichten lassen, Sie erschienen dann auch italienisch als Prediche polemiche sopra S. Pietro e i Papi suoi successori, Fuligno 1784. Der Mag. S. Pal. Mamachi veröffentlichte unter dem Namen Pistus Alethinus 1787 zwei Bände Epistolae ad auctorem anon. opusculi Quid est Papa? — Das Breve gegen Eybel wurde mehrfach kritisirt, u.a. in Riflessioni sopra il Breve … (von P. Gabrielle da Bagno, im 14. Bande der zu Pistoja erscheinenden Raccolta) und in La voce della verita o sia rispettosa rimostranza di un teol. catt. al S. Pont, relativa alla condanna del libro Cosa e il Papa? 1787, 94 S. 8. (N. E. 1789, 62). Gegen diese Kritiken schrieb Card. Gerdil Confutazione di due libelli diretti contro il Breve Super soliditate, Rom 1789. 91. — Schulte 3, 1, 255. Roskovany 3, 872.
1) N. Rel.-Beg. 1782, 366; 1783, 226. Rel.-Journ. 1783, 8, 383. Auch über diese Schrift beschwerte sich Migazzi ohne Erfolg; Archiv 50, 327.
2) Bei Roskovany p. 925 noch ein 2. und 3. Schreiben, 1782, N. Rel.-Beg. 1783, 230.
1) Archiv 50, 326. N. Rel.-Beg. 1784, 385. Rel.-Journ. Beil. 5, 23. Wurzbach 2, 73. Die deutsche Ausgabe steht übrigens im Wiener Index von 1816. Die 1. Auflage heisst: Jo. Phisiophili Specimen monachologiae methodo Linnaeana tabulis tribus aeneis illustratum, cum adnexis thesibus ex pansophia P. P. P. Fast, Mag. Chori et Rectoris Eccl. Metrop. Vienn. ad S. Stephanum, quas praes. P. Capistrano a mulo S. Antonii, Lectore theol. ord., hora IV. post prandium in vestibulo refectorii conventus defendent P. Tiburtius a vulnere Theresiae et P. Theodatus a stigmatibus Francisci, fratres conventuales minorum. Aug. Vind. sumtibus P. Aloysii Merz, concionatoris eccl. cath. 1783, 6 B. 4. Es ist einigermassen auffallend, dass man hinter den Namen des Ex-Jesuiten Aloys Merz und des Chormeisters Fast (Brunner, Mysterien S. 131) nicht, wie sonst oft geschah, nomen ementitum beigefügt hat.
1) Im Index steht noch heute: Storia del grande … L e. germ. idiomate, quo editum est hoc opus: Geschichte …, latine: Historia … Eine italienische Uebersetzung des Buches gibt es nicht.
2) Die betreffende Stelle lautet (bei Brunner S. 339): Ob und wie weit die Akatholiken in Glaubenssachen der reinen Wahrheit zugethan sind, darüber wirft sich der Monarch nicht zum Richter auf; er überlässt es ihrer eigenen Einsicht, weil jeder das angeborene Recht hat, sich an die Religionspartei zu halten, die ihm nach seiner Einsicht und gewissenhaften Prüfung die wahre zu sein dünkt.
1) N. Rel.-Beg. 1782, 381. Deutscher Merkur 1875, 58. — Laibach wurde 8. März 1788 (Bull. 8, 124) Erzbisthum.
2) Pacca, Denkw. über Deutschland S. 92 sagt: Card. Garampi, Zaccaria und er selbst hätten das Material zu der Responsio geliefert, Card. Campanelli mit Hülfe des Advocaten Smith dieselbe redigirt; er ist aber mit der Redaction sehr unzufrieden. Ich citire nach dem Abdruck Florentiae 1790, 572 S. 8., der zu Mainz erschienen und dessen polemische Vorrede von Joh. Jung verfasst sein soll. — Die Schriften über die Nun-ciatur-Streitigkeiten verzeichnet Roskovany 3, 963—985. In der Resp. werden p. 32 14 Schriften aufgezählt mit der Bemerkung, sie seien alle auf Veranlassung oder mit Gutheissung der Erzbischöfe erschienen. Gegen Hermann wird besonders p. 482 polemisirt.
1) Der Verfasser ist der Pfarrer Anth in Köln; die Schrift erschien in Düsseldorf, weil sie in Köln, wo Hedderich Censor war, das Imprimatur nicht erhalten haben würde. Es erschienen noch einige ähnliche Schriften unter demselben Namen (K.-L. 2, 1103), namentlich Animadversiones criticae in R. P. Thaddaei a S. Adamo … Apologiam [gegen eine bei dem Kurfürsten von dem Domcapitel 20. Jan. 1790 eingereichte Klage], 1791* Die Diss. de arehidiaconatibus ist nach dieser Schrift p. 24 von Spitz. — Unter Bezugnahme auf die beiden Breven wurden 1817 Wassenberg Vorhaltungen darüber gemacht, dass er Dereser in Schutz genommen. Mastiaux, Lit.-Z. 1818, 3, 154. 179.
1) Hist. ZtS. 37, 257. Er floh 1791 nach Strassburg und wurde 1794 hingerichtet.
2) Walch, N. Rel.-Gesch. 8, 541. Später soll der Nuncius gesagt haben, es sei gut, dass Schmidt Würzburg verlassen habe (er wurde 1780 nach Wien berufen, † 1794); dort würde man ihn nicht mehr so frei haben schreiben lassen.Deutsche ev. Bl. 1884, 9, 225.