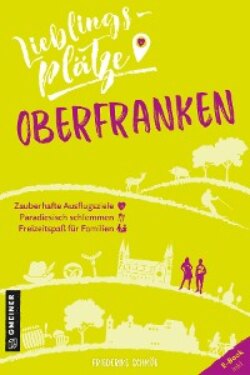Читать книгу Lieblingsplätze Oberfranken - Friederike Schmöe - Страница 15
Die Coburger – die besseren Bayern? Das Haus Sachsen-Coburg
ОглавлениеOkay, ein bisschen provokativ ist das schon gemeint. Denn die (Alt-)Bayern würden die Coburger kaum als Bayern bezeichnen; wenn schon nicht als Preußen (was wahrscheinlich ist), dann als Franken. Doch so richtige Franken sind sie auch nicht, wie der Coburger Dialekt verrät – sind sie nun Bayern oder nicht?
Womöglich sind sie die überzeugteren Bayern. Denn die Bürger des ehemaligen Herzogtums Sachsen-Coburg (seit 1826 Sachsen-Coburg und Gotha) entschieden sich 1919 in einer Volksabstimmung für den Anschluss Coburgs an Bayern – und nicht an Thüringen, was historisch gesehen naheliegend gewesen wäre. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Konsequenz dieser Entscheidung sichtbar: Bayern fiel in die amerikanische Besatzungszone und spätere Bundesrepublik, Thüringen dagegen in die sowjetische Zone und spätere DDR. Bis 1990 war Coburg an drei Seiten durch eine undurchdringliche Grenze von seinem angestammten Hinterland abgeschnitten.
Zuvor war Coburg ein ernestinisches Herzogtum gewesen. Das kleine Fürstenhaus mischte sich im 19. Jahrhundert durch seine clevere Heiratspolitik unter die großen Monarchien Europas: Königin Victoria von England etwa heiratete den Coburger Prinzen Albert. Dieser studierte britisches Staatsrecht und wurde zum Berater seiner Frau. Offiziell zum Prinzgemahl ernannt, ist der Coburger Albert der Erfinder der Weltausstellung. Auf ihn gehen Pläne für erste Arbeiterwohnungen in England zurück. Weitere verwandtschaftliche Bande bestehen mit Belgien, Portugal, Rumänien, Bulgarien und Schweden.
Zum Ende des Ersten Weltkriegs dankte Herzog Carl Eduard ab. Doch das Herzogliche sieht man der Stadt auf Schritt und Tritt an. Ab und zu kommen königliche Gäste aus anderen Teilen Europas. Dann gehört ein Spaziergang über den Marktplatz und ein Bratwurstsnack zum Besuchsprogramm.
Überhaupt – die Coburger Bratwurst! Die hellblauen Rauchschwaden über den Buden weisen den Hungrigen den Weg. Diese Bratwurst ist anders als die anderen: Sie ist gröber, länger, im Teig sind rohe Eier (Sondergenehmigung!), und gebraten wird sie auf einem Rost über offenem Feuer aus Kiefernzapfen. Diese Zubereitung verleiht den 31 Zentimeter langen Würsten ihren typischen Geschmack. Außerdem wird die Semmel nicht in horizontaler, sondern in vertikaler Richtung aufgeschnitten.
Augenblick: 31 Zentimeter?
Wenn Sie gerade in Ihre Bratwurst beißen – werfen Sie einen Blick auf den Giebel des Rathauses. Dort oben balanciert der Coburger Stadtheilige, St. Moriz, besser bekannt als »Bratwurstmännla«. Der Marschallstab in seiner Hand gibt das rechte Bratwurstmaß vor. Über Jahrzehnte hinweg konnte seine Länge nicht exakt festgestellt werden. Man schätzte sie auf 35 bis 40 Zentimeter. Als 1982 die Coburger Feuerwehr eine neue Drehleiter vorführte, wurde nachgemessen: 31 Zentimeter!
Eine andere sehr beliebte Spezialität der Stadt sind die in alle Welt exportierten Coburger Schmätzchen. Sie sind klein, rund und schmecken nach Honig und ein klein bisschen nach Weihnachten. Die Hofbäckerei Feyler in der Rosengasse bäckt die Lebkuchentaler nach Originalrezept. Die Goldschmätzchen erhalten nach dem Backen einen Guss aus Schokolade und werden gekrönt mit einem Tupfer echten Blattgoldes.
Coburg war seit der Reformation über viele Jahrhunderte hinweg eine so gut wie ausschließlich protestantische Stadt. Hier nahm Martin Luther 1530, unter Reichsacht stehend, Zuflucht. Er blieb fünf Monate auf der Veste Coburg. Einige Szenen in Eric Tills Film Luther mit Joseph Fiennes in der Hauptrolle wurden auch dort gedreht. Einen fiktiven Mordfall, der sich während Luthers Aufenthalt auf der Veste Coburg zutrug, schildert Dohlenhatz, Gmeiner, Meßkirch 2017.
Einen wunderbaren literarischen Einblick in die späten herzöglichen Jahre Coburgs gibt Uwe Timms 2002 erschienener Roman Der Mann auf dem Hochrad. In dieser so ironisch wie feinfühlig erzählten Geschichte um Franz Schröter, der Hochrad fahren lernt und die kleine Stadt mit dieser Pioniertat völlig durcheinanderbringt, spiegeln sich der Fortschrittsglaube der damaligen Zeit, aber auch die provinzielle Kleinkariertheit des späten 19. Jahrhunderts.