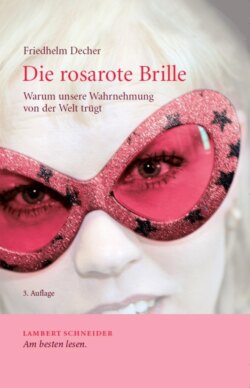Читать книгу Die rosarote Brille - Friedhelm Decher - Страница 9
Die Perspektivität, Selektivität und Konstruktivität der Wahrnehmung
ОглавлениеNeben der Wahrnehmungspsychologie hat insbesondere die sogenannte „Evolutionäre Erkenntnistheorie“ das Augenmerk auf das Problemfeld der Perspektivität, Selektivität und Konstruktivität der Wahrnehmung gelenkt. Die Evolutionäre Erkenntnistheorie wurde bereits im 19. Jahrhundert durch Schopenhauer und Nietzsche auf den Weg gebracht, insofern beide die Lebensdienlichkeit unserer kognitiven Strukturen herausstellten. Im 20. Jahrhundert war es dann der Verhaltensforscher Konrad Lorenz, der weitere Denkanstöße gab, indem er die These vertrat, die kognitiven Strukturen, über die wir Heutigen gleichsam a priori verfügen, hätten sich im Laufe der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen herausgebildet, seien also das Ergebnis einer evolutionären Anpassung. Dieser Ansatz wurde von Autoren wie Karl Raimund Popper, Gerhard Vollmer und Rupert Riedl weiterentwickelt und ausformuliert.4 Bei der Evolutionären Erkenntnistheorie handelt es sich um eine Theorie über die biologische Herkunft unserer kognitiven Strukturen. Ihre Kernthese besagt: „Unser Erkenntnisapparat ist ein Ergebnis der Evolution. Die subjektiven Erkenntnisstrukturen passen auf die Welt, weil sie sich im Laufe der Evolution in Anpassung an diese reale Welt herausgebildet haben. Und sie stimmen mit den realen Strukturen (teilweise) überein, weil nur eine solche Übereinstimmung das Überleben ermöglichte.“5
Hier ist nun nicht der Ort, diese These weiter zu entfalten und sich detaillierter mit ihr auseinanderzusetzen. Im vorliegenden Zusammenhang kommt es vielmehr in erster Linie darauf an, den Beitrag des erkennenden Subjekts zur Erkenntnis, der von den Vertretern der Evolutionären Erkenntnistheorie differenziert untersucht worden ist, eingehender unter die Lupe zu nehmen.6 In ihrer Gesamtheit zeigen die Forschungsergebnisse der Wahrnehmungspsychologie, Sinnesphysiologie und Neurobiologie, dass der Beitrag des erkennenden Subjekts zur Erkenntnis perspektivisch, selektiv und konstruktiv sein kann. Perspektivisch ist er insofern, als der Standort des Subjekts sowie sein Bewegungs- und Bewusstseinszustand in eine Wahrnehmung beziehungsweise eine Erkenntnis einfließt. Zur Perspektivität der Wahrnehmung tragen demnach schon sogenannte standortvariante Erscheinungen bei. Beispiele hierfür sind etwa: mein Standort im Verhältnis zum Horizont (der Horizont kann weit entfernt oder vergleichsweise nah sein), der Ausschnitt des sichtbaren Himmels (blicke ich aus einem Fenster, so nehme ich einen anderen Ausschnitt wahr, als wenn ich auf freiem Feld stehe), ferner Effekte der Relativgeschwindigkeit auf Gleichzeitigkeit (sitzt man in einem Zug und der auf dem Nebengleis stehende Zug setzt sich in Bewegung, so glaubt man, der Zug, in dem man selbst sitzt, fahre los). Darüber hinaus beeinflussen auch physiologische, also körperspezifische Faktoren, was und wie wir wahrnehmen. Ein sprechendes Beispiel ist die Farbenblindheit: Ein Farbenblinder nimmt die Welt beziehungsweise Ausschnitte der Welt anders wahr als ein Mensch, der diese Einschränkung nicht hat. Auch unser Maß an Aufmerksamkeit kann Form und Inhalt unserer Wahrnehmung beeinflussen. Das Gleiche gilt für Drogen und bewusstseinsverändernde Substanzen aller Art. Zudem spielen frühere Erfahrungen, ästhetische Erziehung, Erwartungen sowie emotionale und kulturelle Faktoren eine nicht unerhebliche Rolle. So wird etwa, um ein Beispiel für einen emotionalen Faktor zu nennen, die Art und Weise, wie wir eine andere Person wahrnehmen, durch unsere persönliche Beziehung zu ihr beeinflusst: Ist mir die andere Person sympathisch, so nehme ich selbst ihre Größe und ihr Aussehen anders wahr, als wenn sie mir unsympathisch ist, ich sie nicht leiden kann oder gar hasse. Und einen schönen Beleg dafür, wie kulturelle Faktoren die Wahrnehmung prägen können, liefert die „Kreis-Kultur“ der Zulus: In ihrer Welt gibt es so gut wie keine Ecken, rechte Winkel oder gerade Begrenzungen; ihre Hütten sind rund und haben runde Öffnungen; auch pflügen sie ihre Felder nicht in geraden Furchen, sondern in Kurven und Kreisen.
Begnügen wir uns mit diesen Hinweisen auf die Perspektivität der Wahrnehmung und wenden wir uns ihrer Selektivität zu, auf die der Biologe Jakob von Uexküll seit den 1920er Jahren in einer Reihe von Schriften hingewiesen hat. Gemäß der Umweltlehre, die Uexküll auf der Grundlage empirischer Forschungen entwickelte, schneidet jeder Organismus aus der realen Welt gleichsam ein Stück heraus, das ihm zur „Umwelt“ wird. „Umwelt“ ist so gesehen ein relationaler Begriff und Ergebnis eines selektiven Vorgangs. Das heißt, infolge seiner arttypischen Organausstattung filtert, selegiert der Organismus aus den Reizen, die ihn aus der ihn umgebenden Welt erreichen, die ihm dienlichen heraus. Mit anderen Worten: Er lässt nur eine bestimmte Auswahl aus den objektiv vorhandenen Möglichkeiten zu. Diese Auswahl ist seine „Umwelt“. Für das einzellige Pantoffeltierchen beispielsweise gibt es lediglich ein einziges Verhalten, mit dem es auf jeden nur möglichen Reiz – sei es ein chemischer, ein thermischer, ein Licht- oder ein Berührungsreiz – reagiert: die Flucht. Die Umwelt des Pantoffeltierchens, so könnte man sagen, ist eine Fluchtwelt. Für die Seegurke, um ein anderes Beispiel heranzuziehen, enthält die Umwelt nur ein Merkmal, nämlich das Dunklerwerden, auch wenn ihre Umgebung objektiv noch so reichhaltig sein mag. Ob nun eine Wolke, ein Schiff oder tatsächlich ein natürlicher Feind die Sonne verdunkelt – all das spielt für die Seegurke keine Rolle: Sie zieht sich bei jeder Verdunkelung zusammen. Die Umwelt des Frosches ist entsprechend eine Bewegungswelt, die des Hundes vor allem eine Riechwelt und die der Fledermaus eine Hörwelt.
All dies ist seit langem bekannt und unbestritten. Etwas anders verhält sich die Sachlage hinsichtlich der Konstruktivität der Wahrnehmung. Konstruktiv, so erläutert Vollmer, ist Wahrnehmung dann, wenn sie die Erkenntnis positiv mitbestimmt oder erst ermöglicht. Dass sinnliche Wahrnehmung einen konstruktiven Anteil in sich birgt, ist in der Geschichte der Philosophie unbestritten. Umstritten ist jedoch die Frage, wie groß dieser konstruktive Anteil ist. Der Rationalismus, wie ihn René Descartes im frühen 17. Jahrhundert begründete, veranschlagte ihn sehr hoch, ging er doch davon aus, der menschliche Geist verfüge über sogenannte „angeborene“ beziehungsweise „eingeborene Ideen“. Zu ihnen wurden logische und mathematische Ideen gerechnet, ferner die Idee Gottes sowie von manchen Rationalisten grundlegende ethische Prinzipien, wie etwa der Pflichtbegriff. Konkret bedeutet das: Eine geometrische Figur, beispielsweise ein Dreieck, vermag das erkennende Subjekt nur deswegen als Dreieck wahrzunehmen, weil es über die angeborene Idee des Dreiecks verfügt. Für den Rationalisten liegen der erkennenden Vernunft – Ratio – und der erfahrbaren Wirklichkeit gleiche, aufeinander bezogene Strukturen zugrunde. Der Rationalist behauptet also eine Art Gleichförmigkeit, eine Isomorphie, zwischen den Erkenntniskategorien – sprich: den eingeborenen Ideen – und der realen Welt. Die eingeborenen Ideen sind mithin insofern erkenntniskonstitutiv, als sie der Wahrnehmung bestimmte Formen aufprägen.
Die sich ebenfalls im 17. Jahrhundert ausbildende Richtung des Empirismus weist die Annahme eingeborener Ideen entschieden zurück. Die Empiristen begreifen Wahrnehmen und Erkennen als überwiegend passives Abbilden von Welt. Darum ist Wahrnehmung für sie naturgemäß nie konstruktiv.
Immanuel Kant nun war es, der im darauffolgenden Jahrhundert den Streit zwischen Rationalisten und Empiristen zu schlichten versuchte. Er bezeichnete seinen Ansatz als „Transzendentalphilosophie“. „Transzendental“ bedeutet hierbei nicht: Beschäftigung mit dem Übersinnlichen, dem Metaphysischen. Vielmehr ging es Kant darum, die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis herauszufinden. Er fragte: Wie ist es uns überhaupt möglich, Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen? Und er formulierte als bahnbrechende und wegweisende Antwort: Bereits unsere sinnliche Wahrnehmung formt das Anschauungsmaterial insofern, als wir alles räumlich und zeitlich wahrnehmen, das heißt in einer dreidimensionalen Anordnung und in einer zeitlichen Abfolge des Nacheinander. Alles, was wir wahrnehmen, wird also durch Raum und Zeit geprägt. Das durch diese beiden „Anschauungsformen“, wie Kant sie nannte, geordnete Anschauungsmaterial verarbeitet unser Verstand dann weiter, indem er es begrifflich fasst, das heißt in die von Kant so bezeichneten „Kategorien“ oder „Verstandesbegriffe“ einordnet. Eine dieser Kategorien ist beispielsweise die Kausalität. Sie versetzt uns in die Lage, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu denken. Auf diese Weise machen die Strukturen der Erkenntnis, über die wir nach Kant immer schon verfügen, Erfahrung überhaupt erst möglich. Sie sind die Bedingungen aller Erfahrung und aller Erkenntnis. Erfahrung und Erkenntnis erweisen sich hier als Ergebnis eines konstruktiven Prozesses, genauer gesagt: eines Zusammenspiels von Anschauung und begrifflichem Denken. Vor diesem Hintergrund betonte schon Kant die Selektivität und Konstruktivität aller menschlichen Wahrnehmung und Erkenntnis, die moderne Forschungen heute mit einer Fülle von empirischem Material untermauern können.
Die selektiven und konstruktiven Momente der Wahrnehmung lassen sich besonders gut anhand der Farb-, Raum- und Gestaltwahrnehmung veranschaulichen. Beginnen wir mit der Farbwahrnehmung.7 Das uns bekannte elektromagnetische Spektrum reicht von den kurzwelligen Gammastrahlen bis zu den langen Radiowellen. Es umspannt also den Pico-Bereich (1 Picometer = 1 billionstel Meter = 10 hoch minus 12) bis hin zu den Kilometer-Dimensionen der Langwellen. Das menschliche Auge ist nun lediglich für Wellenlängen zwischen 380 und 760 Nanometer empfindlich (1 Nanometer = 1 milliardstel Meter = 10 hoch minus 9). Unsere sinnliche Wahrnehmung ist also sehr „wählerisch“. Sie filtert aus den Signalen der Außenwelt nur ganz bestimmte Informationen heraus. Wir haben, bildlich gesprochen, nur ein sehr schmales optisches Fenster zur Welt.
Ebenso verhält es sich mit dem Hören. Wir können nur einen schmalen Ausschnitt aus dem Schwingungsspektrum hören: nämlich ca. 16 bis 16.000 Hertz. Wir verfügen also auch nur über ein recht schmales akustisches Fenster zur Welt. Andere Lebewesen können Schwingungen jenseits von 20.000 Hertz vernehmen – Hunde zum Beispiel –,wiederum andere Radarwellen, beispielsweise Fledermäuse.
Ähnliches gilt auch für das Schmecken, Riechen und Tasten: Auch mit diesen Sinnen können wir nur innerhalb unserer arttypischen Fenster wahrnehmen. Sie liefern uns lediglich eine Selektion, eine Auswahl aus einem objektiv viel reichhaltigeren Material.
Nun sehen wir aber, um auf das Sehen zurückzukommen, keine Wellenlängen, sondern Farben. Und das ist eine konstruktive Leistung unserer Wahrnehmungsorgane, die auf angeborenen Dispositionen beruht. Hierzu zählen die sogenannten „Zäpfchen“ in unserer Retina, der Netzhaut, die über photochemische Prozesse Licht absorbieren und es uns damit allererst ermöglichen, Farben wahrzunehmen. Außerdem enthält die Retina „Stäbchen“, die schwarz-weiß-empfindlich sind und uns bei Dunkelheit in die Lage versetzen, Grauabstufungen zu unterscheiden.
Andere Lebewesen verfügen über andere angeborene Dispositionen. Bienen etwa besitzen, wie die Forschungen Karl von Frischs und anderer gezeigt haben, ein ganz anderes optisches Fenster zur Welt.8 Sie nämlich können kein Rot wahrnehmen, dafür aber ultraviolettes Licht. Infolgedessen hat eine blühende Wiese oder auch eine einzelne Blüte für eine Biene eine ganz andere Farbstruktur als für uns.
Darüber hinaus ist unsere Farbwahrnehmung noch zu einer anderen interessanten konstruktiven Leistung imstande. Das Spektrum der Regenbogenfarben ist linear und zweiseitig offen. Ordnen wir jedoch die Spektralfarben nach ihrem Empfindungswert, dann tendieren wir dazu, sie zu einer topologisch geschlossenen Figur anzuordnen, nämlich kreisförmig. Das Ergebnis ist der sogenannte Farbenkreis. In ihm liegen sich Rot und Grün – zwei Farben, die wir als polar, das heißt als sich gegenseitig ausschließend, empfinden – diametral gegenüber. Wir können demzufolge sehr gut zwischen der physikalischen Natur des Lichts und dem psychologischen Empfindungswert von Farben unterscheiden. Man könnte auch sagen: Wir trennen zwischen den objektiven und subjektiven Aspekten des Lichts. Aber gerade bei diesen subjektiven Aspekten handelt es sich um selektive und konstruktive Leistungen unseres Wahrnehmungsapparats.
Auch unsere Raumwahrnehmung ist das Resultat einer Konstruktion des wahrnehmenden und erkennenden Subjekts. Wir wissen: Das Bild von einem dreidimensionalen Gegenstand auf der Netzhaut ist nur zweidimensional. Das bedeutet: Aus einer im Wesentlichen zweidimensionalen Information baut unser Wahrnehmungssystem eine dreidimensionale Welt auf. Diese Rekonstruktion dreidimensionaler Gegenstände ist eine konstruktive Leistung des Subjekts, der angeborene Strukturen zugrunde liegen.
Sehr schön lässt sich dieser Sachverhalt anhand der Versuche mit Umkehrbrillen illustrieren, die G. M. Stratton bereits 1897 durchgeführt hat.9 Er trug ein als Umkehrbrille fungierendes Linsensystem acht Tage lang über dem rechten Auge. Das linke Auge blieb während dieser Zeit gänzlich abgedeckt. Der dadurch hervorgerufene Effekt bewirkte eine Umkehrung des Gesichtfelds und eine Seitenvertauschung. Stratton berichtete über massive Orientierungsstörungen unmittelbar nach Aufsetzen der Umkehrbrille. Sie führten zu einer weitgehenden Unterbrechung der normalen Koordination von visueller Wahrnehmung und Körperbewegung. So griff er in die falsche Richtung, wenn er einen Gegenstand, den er wahrgenommen hatte, aufheben wollte. Und der Schall schien ihm aus einer Richtung zu kommen, die der visuell wahrgenommenen Schallquelle entgegengesetzt war. Aber nun kommt das Erstaunliche: Nach etwa drei Tagen nahm die Desorientierung ab. Und nach Ablauf von acht Tagen war die neu erlernte visuellmotorische Koordination relativ zufriedenstellend. Zudem war sich Stratton im Laufe der Versuchstage zunehmend weniger des Umstands bewusst, dass die gesamte Szenerie Kopf stand. Als er dann die Umkehrbrille wieder abnahm, bemerkte er zunächst abermals eine Desorientierung. Diese dauerte jedoch nur kurze Zeit an.
Spätere Wiederholungsversuche bestätigten die Leistungsverschlechterung nach dem erstmaligen Aufsetzen der Brille. Sie zeigten überdies eine relativ schnelle Anpassung während der Periode der künstlichen Gesichtsfeldumkehrung, wenn der Test über einen längeren Zeitraum durchgeführt wurde. All das bestätigt eindrucksvoll die konstruktiven Leistungen unseres Gehirns.
Dies alles ist schon erstaunlich genug. Aber das vielleicht erstaunlichste Merkmal der menschlichen Wahrnehmung liegt nach Ansicht von Wahrnehmungspsychologen in ihrer Neigung, Ganzheiten und Muster zu bilden. Das gelingt ihr, indem sie unvollständige Konturen ergänzt, verschiedenartige Schlüsselreize integriert und die Beiträge einzelner Reize so bewertet, dass sie insgesamt das ergeben, was Gestaltpsychologen eine „gute Gestalt“ nennen. Das gilt nicht nur für räumliche Muster, sondern auch für zeitliche, wie beispielsweise ein musikalisches Motiv, für raumzeitliche Konfigurationen, etwa bestimmte Bewegungsabläufe, ebenso wie für abstrakte Muster, zum Beispiel informationelle. In solchen Gruppierungen zu einem Ganzen wird die konstruktive Leistungsfähigkeit unseres Datenverarbeitungsapparats, also letztlich des Gehirns, augenfällig.
Die Gestaltpsychologie, eine Teildisziplin der Psychologie, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts herauszubilden begann, hat herausgefunden, dass es mehrere Arten von „guten Gestalten“ gibt.10 Da gibt es zum einen die „gute Fortsetzung“, auch bekannt als „Gesetz der guten Kurve“. Es beschreibt den Tatbestand, dass Reize, die eine „gute“ Fortsetzung einer Linie, einer Kurve oder einer Bewegung sind, leichter zu Einheiten gruppiert werden können. Darüber hinaus spielt Symmetrie eine bedeutsame Rolle, werden doch symmetrische oder ausgewogene Gruppierungen von unserem Wahrnehmungsapparat asymmetrischen vorgezogen. Bevorzugt werden auch Gruppierungen, die zu einer geschlossenen oder vollständigen Gestalt führen. Und schließlich gibt es noch diejenige Variante der „guten Gestalt“, die als „gemeinsames Schicksal“ bezeichnet wird. Damit ist gemeint: Elemente, die sich gemeinsam bewegen oder verändern, schließen sich gegenüber Elementen mit anderer Bewegungsrichtung zusammen.
Die konstruktive Leistung unseres Gehirns bei der Gestaltwahrnehmung zeigt sich außerdem bei Objekten, die „in Wirklichkeit“ gar nicht da sind. Ein bekanntes Beispiel ist die „Rubin’sche Täuschung“. Hier konstruieren wir aus den uns gebotenen Reizen entweder einen Pokal beziehungsweise eine Vase oder zwei Gesichter im Profil. Unsere unbewusste Reizverarbeitung belässt es nicht bei der Zweideutigkeit, sondern bevorzugt die Eindeutigkeit, die im Fall der Rubin’schen Täuschung wenigstens zu 50 Prozent richtig ist. Mit Blick auf dieses Phänomen spricht man in der Gestaltpsychologie von einer „Prägnanztendenz“. Aber auch in Felsenmeeren und bei Tintenklecksen erfindet unsere Einbildungskraft Strukturen. Tintenkleckse werden gar zu psychodiagnostischen Zwecken verwendet, etwa beim Rorschach-Test, einem Projektionstest, bei dem Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Probanden, zum Beispiel auf seine Intelligenz, Einbildungskraft oder Aktivität, gezogen werden.
Abb. 6: Junge Frau und alte Schwiegermutter
Gestaltwahrnehmung kann durch Informationen über die wahrzunehmende Gestalt sowie durch Übung verbessert, verfeinert oder überhaupt erst richtig aktiviert werden. So kommt es, dass man einen auf dem Boden verlorenen Gegenstand schneller wiederfindet, wenn man weiß, wie er aussieht. Bekannt ist auch der „Cocktail-Party-Effekt“: Aus einer Geräuschkulisse, beispielsweise der einer Party, kann man eine ganz bestimmte Stimme heraushören. Das Gleiche lässt sich bei Konzerten beobachten. Auch hier sind wir in der Lage, ein spezielles Instrument zu isolieren. Generell gilt für die Wahrnehmung von Musik: Wir hören nicht eine bloße Tonfolge, sondern verbinden mehrere Töne zu Akkorden, Akkordfolgen, Riffs, Melodien, Motiven und ganzen Themen. Bei all dem handelt es sich, um es noch einmal zu betonen, um höchst selektive und konstruktive Leistungen derjenigen mentalen Apparatur, welche die Reize aus der Umwelt aufnimmt und verarbeitet.
Dieses Fazit wirft auch Licht auf die Selektivität unserer Wahrnehmung bei mehrdeutigen Figuren, den sogenannten „Kippfiguren“, wie dem bereits erwähnten Necker-Würfel oder dem bekannten Bild „Junge Frau und alte Schwiegermutter“. Hier werden unserer Wahrnehmung und unserer Kognition zwei mögliche Wahrnehmungsorganisationen angeboten. Unser Gehirn entscheidet sich zunächst für eine der beiden Möglichkeiten. Irgendwann „kippt“ die Figur dann um, und uns bietet sich die andere Möglichkeit dar. Betrachtet man solche Bilder längere Zeit, kann man schließlich gezielt beide Variationen abwechselnd wahrnehmen – ein schönes und sehr sprechendes Beispiel für den selektiven und konstruktiven Beitrag des erkennenden Subjekts bei der Wahrnehmung und Erkenntnis dessen, was uns als Realität gilt.