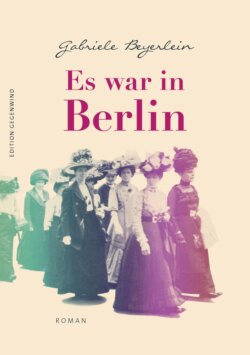Читать книгу Es war in Berlin - Gabriele Beyerlein - Страница 4
2
ОглавлениеUnd was so eine braucht, das ist gottverdammt noch mal keine Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit …
Dieser Satz ging in Margarethes Kopf herum wie ein Mühlrad, verwob sich mit dem Violinsolo, das der polnische Virtuose mit dem völlig unaussprechlichen Namen zum Besten gab. Ge-rech-tig-keit, skandierten die harten Striche in wütendem Fortissimo, mit denen das Presto endete, Ge-rech-tig-keit!
Höflicher Applaus, der weniger dem bravourösen Spiel des Künstlers galt als der Gastgeberin Baronin von Zug, Margarethes Mutter, in deren Salon – genauer gesagt im großen Musiksaal der Villa – sich wie jeden Donnerstagabend Damen und Herren von Geburts- oder Geldadel nach einem fünfgängigen Menü vielversprechende junge Künstler vorführen ließen: schüchterne oder schwärmerische Dichter, die aus ihren Werken lasen, linkische Maler, die stets eine Mappe ihrer Arbeiten unter dem Arm trugen, Bildhauer mit olympischem Blick und einem Album mit Fotografien ihrer Werke, oder Musiker aller Provenienzen. Heute also dieser junge Pole mit seiner wenig eingängigen Musik.
Ermutigt durch den Beifall begann er zu allem Überfluss noch ein weiteres Stück. Es erschien Margarethe wie eine einzige Anklage. So wie das Gesicht dieser kleinen einfachen Frau, die ihr im Hof der Mietskaserne ihren Zorn entgegengeschleudert hatte.
Margarethe versuchte das Bild zu verscheuchen. Sofort war da ein anderes, weit schlimmeres: dieses unsägliche Kellerloch, die bleichen Kinder und die verzweifelte alte Frau – die gar nicht so alt sein konnte, hatte sie doch noch ein Baby. Diese unterwürfige Art, fast hündisch. Kaum hatte sie verhindern können, dass Anna Brettschneider ihr die Hände küsste, und das nur, weil sie in ihrer Rat- und Hilflosigkeit den Inhalt ihres Geldbeutels zwischen die Tütenstapel auf den verklebten Tisch gekippt hatte, nicht mehr als sieben, acht Mark, wenn es hoch kam zehn. Sie hatte nicht mehr Geld eingesteckt, schließlich hatte sie ja nicht geahnt, wie dringend ihr Wunsch sein würde, Geld zu geben. Oder sollte sie ehrlicher sagen: sich loszukaufen?
Dieser Schmutz und dieser unglaubliche, Übelkeit erregende Gestank! Keinen Augenblick länger hätte sie es in diesem Keller ausgehalten. Als sie sich wieder in den Hof gerettet hatte, geschüttelt von Ekel und Entsetzen, hatte sie sich erbrochen. In die Villa zurückgekehrt, hatte sie sich alle Kleider vom Leib gerissen und Emma eingeschärft, sie samt und sonders zu waschen, Mantel, Hut und Muff zum Lüften über Nacht ins Freie zu hängen und die Handschuhe aus feinem Baumwollgarn zu kochen, hatte sich ein Bad zubereiten lassen und sich dreimal eingeseift. Nur zum Haare Waschen war keine Zeit mehr gewesen, die langen Haare brauchten Stunden, um zu trocknen, und an ihrem Salon-Abend bestand Maman auf Margarethes Anwesenheit, da gab es kein Entkommen. So hatte sie die Haare nur von Emma am offenen Fenster ausbürsten und danach mit Parfüm bestäuben lassen. Ihr schien, dass man durch den Rosenduft hindurch den Mief immer noch roch.
Und in einer solchen Luft, in diesem feuchten Moder lebten Tag und Nacht fünf kleine Kinder mit ihrer Mutter. Und klebten Tüten.
»Die Mädchen können beim Kleben noch nicht recht mitarbeiten, sie sind noch zu ungeschickt, aber beim Falten helfen sie auch schon!«, hatte Anna Brettschneider entschuldigend gestammelt – als bedürfe es einer Rechtfertigung, dass die beiden blassen kleinen Geschöpfe tatenlos im Bettzeug vergraben auf dem Strohsack kauerten! Zu immer weiteren Rechtfertigungen hatte sie ausgeholt: »Trotzdem reicht es nicht. Bisher hab ich jeden Monat was von meinem Hausrat ins Leihhaus getragen, aber jetzt hab ich nichts mehr, den Topf und den Eimer brauch ich doch und das eine Bett auch, sonst kündigt mir meine Schlafgängerin und ich verlier auch noch die paar Pfennige, die sie für den Schlafplatz zahlt. Aber wenn ich eine Nähmaschine hätte, eine Singer, mit der man Damenkonfektion nähen kann …«
Dieser flehende Blick – der ließ sich nicht abwaschen wie der Gestank.
»Sie werden Ihre Nähmaschine bekommen«, hatte sie hastig versprochen, »darauf gebe ich Ihnen mein Wort.«
Dabei war sie zu so einem Versprechen überhaupt nicht berechtigt. Sie hatte in dem Wohltätigkeitsverein, dessen Vorsitzende ihre Mutter war, nichts zu entscheiden. Nur auf deren beharrliches Drängen hin – es sei Zeit, mit ihren dreiundzwanzig Jahren endlich einmal Interesse an christlicher Nächstenliebe und sozialer Verantwortung unter Beweis zu stellen und den ihr angemessenen Platz in der Gesellschaft auszufüllen – war sie zur letzten Sitzung des Komitees mitgekommen und hatte den Auftrag übernommen, eine gewisse Anna Brettschneider zu besuchen. Sie hatte keine Ahnung gehabt, worauf sie sich einließ.
Die Bittschrift Anna Brettschneiders hatte ganz passabel gewirkt, sehr devot zwar und reichlich altertümlich im Ton, aber die Handschrift war ordentlich gewesen und die Orthografie auch nicht schlimmer, als zu erwarten war. Sie habe eine Lehre als Damenschneiderin gemacht, hatte Frau Brettschneider ausgeführt, vor ihrer Ehe und bis zum ersten Kind in einer Werkstätte für Damenoberbekleidung der besseren Kreise gearbeitet und sei unverschuldet in Not geraten, weil ihr Ehemann sie verlassen und unversorgt mit fünf kleinen Kindern zurückgelassen habe. Wenn sie eine Singer-Nähmaschine hätte, so würde sie hoffen, durch Heimarbeit ihre Kinder ernähren zu können, was derzeit gänzlich unmöglich sei. Als alleinverdienende Ernährerin sei es auch ganz ausgeschlossen, die Raten zu erwirtschaften, um eine Nähmaschine abzustottern. Deshalb bitte sie um der christlichen Barmherzigkeit willen untertänigst darum, von den hochwohlgeborenen wohltätigen Damen eine selbige gestellt zu bekommen …
Wie hatte sie, Baronesse Margarethe von Zug, da ahnen können, in welch einen Sumpf von Elend und Grauen sie geraten würde? Die Schneiderin, die zum Maßnehmen und Anprobieren in die Villa kam, sah immer sauber und adrett aus und duftete angenehm nach Lavendel.
Sie war naiv genug gewesen, eine Person zu erwarten wie diese Schneiderin – und fünf rotwangige reizende Kinder.
Warum hatte ihr niemand gesagt, dass es solch entsetzliche Zustände gab, im Deutschen Kaiserreich, 1895, in der Reichshauptstadt, praktisch vor ihrer Haustür?
Nun gut, gelesen hatte sie schon hin und wieder von Wohnungsnot und Wohnungselend, vom Unwesen des Schlafgängertums und unsittlichen Zuständen, aber das waren Worte gewesen, mit denen sich keine Vorstellungen verbunden hatten. Nun waren es Bilder. Und schlimmer noch: Gerüche.
Sie wusste nicht, wie sie die wieder loswerden sollte.
Ob die Mutter auch solche Wohnungen kannte und solche Verhältnisse? Als Vorsitzende des Wohltätigkeitsvereins Misericordia sollte sie das wohl. Wie konnte sie dennoch jede Woche eine Gesellschaft mit fünfgängigem Menü geben und sich mit jungen Künstlern schmücken?
»Wie modern«, flüsterte ihre Mutter nach Beendigung des Stückes der neben Margarethe sitzenden Generalin von Klaasen zu. »Das ist die Musik der Zukunft, deren Geburtsstunde wir hier miterleben dürfen.«
»Die Sterbestunde der guten alten Klassik wäre mir lieber«, gab diese trocken zurück, während der höfliche Applaus einsetzte, und blinzelte Margarethe zu. »So blass, meine Liebe? Lösen diese schrägen Töne bei Ihnen auch Migräne aus?«
»Ich muss zugeben, dass ich kaum zugehört habe«, erwiderte Margarethe. »Ich habe heute eine arme Frau besucht, die in einer Bittschrift um eine Nähmaschine eingekommen ist. Die Bilder wollen mir nicht aus dem Kopf. Dieses Elend.«
»So schlimm?«, fragte Frau von Klaasen.
»Über alle Maßen grauenerregend«, stöhnte sie.
»Sei nicht so überspannt, Margarethe«, gab die Mutter zurück. »Diese Menschen empfinden ihr Elend nicht so, wie wir das tun. Sie kennen es nicht anders.« Damit stand sie auf und trat nach vorn, dankte dem Künstler mit einer souverän vorgetragenen kleinen Rede, schloss mit einem Sinnspruch und lud die Anwesenden zu zwanglosem Gespräch in die dem Musiksaal gegenüberliegenden Räumlichkeiten ein – den Salon und das Herrenzimmer.
»Mein schönes Fräulein, darf ich's wagen?«, fragte Hauptmann von Klaasen und hielt Margarethe mit einer knappen Verbeugung den Arm hin. »Da sowohl Ihr Adel als auch Ihre Schönheit außer Frage stehen, habe ich hoffentlich mit einer Abfuhr nicht zu rechnen?« Er lächelte, als sei er selbst erstaunt darüber, wie geistreich er sich durch seine Bemerkung als Goethe-Kenner erwiesen hatte. Wenn er wüsste, wie oft sie schon mit dergleichen Anspielungen auf ihren Namen malträtiert worden war!
Um seiner Mutter willen, der liebenswerten Generalin von Klaasen, bemühte sie sich um ein strahlendes Lächeln und stand auf.
Alle Welt schien verschworen, den Hauptmann und sie zusammenzubringen, seit Jahren wurde er auf den verschiedensten Gesellschaften zu ihrem Tischherrn bestimmt. Die Themen, über die sie mit ihm zu reden wusste, grenzten sich mit jedem Gespräch mehr ein. Weder gehörten der Militäretat noch die deutschen Kolonien in Afrika oder die Vision einer mächtigen deutschen Kriegsflotte zu den Gesprächsstoffen, die sie bevorzugte. Dennoch hatte ihre Mutter ihn heute schon wieder neben sie gesetzt.
Ihr schien, die Augen ihrer Mutter und die der Generalin ruhten voller Spannung auf ihnen. Fast als sei ihre Verlobung schon beschlossene Sache.
Es schien ja auch alles zu passen: der alte Adel auf beiden Seiten, seine Aussicht auf eine glänzende Militärkarriere als Sohn eines verdienten Generals und ihre auf eine nicht weniger glänzende Mitgift als einzige Tochter eines reichen Bankiers. Aber man wollte doch aufsehen zu seinem Mann – und dies nicht nur im wörtlichen Sinne.
Sie nahm den ihr angebotenen Arm. Wie immer kam sie sich neben ihm zu groß vor. »Ich hoffe nur, Sie erwarten nicht von mir, dass ich Ihnen nun getreu meiner berühmten Namensvetterin die Gretchenfrage stelle«, sagte sie lächelnd.
Seinem Gesicht war anzusehen, dass er, verzweifelt um die richtige Antwort bemüht, seinen Faust durchging. »Wie halten Sie's mit der Religion«, half sie ihm mit einem kleinen Lachen auf die Sprünge und ging neben ihm her in den Salon.
»Oh!«, meinte er ebenso überrascht wie ratlos. Fast tat er ihr leid und sie suchte schon nach einer eleganten Form, das Gespräch in andere Bahnen zu lenken, da sprang er an, als habe sie die Frage ernst gemeint. »Als Hofprediger Stoecker noch im Dom amtierte«, begann er mit Emphase, »war es ein Erlebnis, den Gottesdienst zu besuchen. Zu schade, dass er sich bei Hofe in Ungnade gebracht hat – und in die Kirche der Stadtmission will ich denn doch nicht zu ihm gehen, man muss schließlich wissen, wo man hingehört. Aber dieser Mann wusste zu Herzen gehend zu predigen. Pastor Stoecker ist, wenn ich so sagen darf, eine wahre Posaune des Herrn.«
»Stoecker?«, fuhr Margarethes Vater herum, der vor ihnen in den Salon getreten war. »Gehen Sie mir mit dem! Früher, als er mit seiner Christlichsozialen Partei die Arbeiterschaft von den Sozialisten trennen und für die Treue zu Kirche, Monarchie und Vaterland retten wollte, da hat er mir insgeheim nicht schlecht gefallen – auch wenn man das vor Bismarck nicht zu laut sagen durfte. Aber mit dem Programm hat Stoecker ja leider Schiffbruch erlitten: Die Arbeiter sind ihm nicht in Massen zugeströmt, trotz Schrippenkirche und Kaffeepott. Doch was er sich in den letzten Jahren leistet – diese Anbiederung an das Kleinbürgertum in all seiner Beschränktheit!«
»Ich will Ihnen nicht widersprechen – Sie als Reichstagsabgeordneter, ich weiß, ich habe nicht Ihren politischen Weitblick«, warf der Hauptmann ein, »aber die Leitung der Stadtmission, die Diakonie, das soziale Engagement!«
»Schön und gut«, räumte der Vater ein, »Stoeckers soziales Werk ist eindrucksvoll. Die Kirche soll sich der Armen und Schwachen annehmen, alles sehr christlich und respektabel, nichts dagegen einzuwenden. Aber seine antisemitischen Hetzreden, mit denen er an die niedersten Instinkte und Vorurteile der Kleingeister appelliert! Geradezu demagogisch. Und nun hat er in den vergangenen Jahren damit auch noch Einfluss auf das Parteiprogramm der Deutschkonservativen gewonnen! Zersetzender jüdischer Einfluss – was ich darüber am liebsten sagen würde, gehört nicht vor die Ohren einer jungen Dame!«
»Ich meine Stoecker ja auch nicht als Politiker, sondern als Prediger«, versuchte Hauptmann von Klaasen den Redeschwall zu unterbrechen, doch der Vater sprach einfach weiter: »Was wären wir denn ohne die Juden? Wo man hinschaut, allein schon in Berlin, wir könnten doch einpacken ohne sie! Banken und Zeitungswesen sowieso, aber auch die Wirtschaft, man denke nur an die Konfektionsindustrie, daneben die Wissenschaften, die Medizin, die Künste – wo stünden wir denn ohne die Juden? Ich mache meine besten Geschäfte mit ihnen und schäme mich dessen nicht.«
»Sicher, darin bin ich ganz Ihrer Meinung, zumal auch Seine Majestät, ich wollte nicht …«, versuchte Hauptmann von Klaasen Boden zu gewinnen, doch Baron von Zug hatte sich offensichtlich festgebissen. Als hielte er eine Rede im Reichstag, stand er da und überschüttete Margarethes Tischherrn mit weiteren politischen Ausführungen.
Ihr war es nur recht. Mit einem lächelnden »Dann will ich die Herren bei der Lösung der Weltprobleme nicht länger stören« machte sie sich davon. Wenn es nur einen Vorwand gäbe, sich ganz zurückzuziehen! Immer unerträglicher erschien ihr dieser Abend nach den Erlebnissen des Nachmittags, immer stärker sehnte sie sich nach der Abgeschiedenheit ihres Zimmers. Aber in der Forderung nach der Erfüllung gesellschaftlicher Pflichten war ihre Mutter unerbittlich.
Nun strebte diese auch noch auf sie zu, einen unbekannten jungen Mann in einem Frack, der mit seinen Glanzstellen verdächtig nach Leihhaus aussah, im Schlepptau. »Hier, Margarethe, ich will dir unseren jungen Dichter vorstellen, in einer Woche wird er uns mit seinem Werk erfreuen, heute weilt er schon einmal unter uns, um sich etwas einzugewöhnen. Er ist ein bedeutender Naturalist: Johann Nietnagel – meine Tochter Margarethe.« Damit überließ die Mutter sie ihrem Schicksal.
»Dann will ich uns erst einmal etwas zu trinken ordern«, sagte sie mit jenem antrainierten Lächeln, das sich in Gesellschaft fast ohne ihr Zutun auf ihrem Gesicht einstellte, und gab dem Diener einen Wink. »Nach diesem Musikgenuss« – sie sprach das Wort in unüberhörbaren Anführungszeichen – »haben wir uns das redlich verdient, finden Sie nicht auch?« Zustimmung heischend schlug sie ein kleines ironisches Lachen an.
»Mich hat diese Musik sehr beeindruckt«, erwiderte er, ohne auf ihre Ironie einzugehen. Seine Stimme war tiefer, als sie es sich vorgestellt hätte, und von einer Klangfülle, wie sie es nur von einem Sänger erwartet hätte. Und dass das Erste, was er zu ihr, der umschmeichelten Tochter des Hauses, sagte, ein Widerspruch war, ließ sie aufhorchen.
»Freilich nicht jedermanns Sache«, fuhr er fort, sich anscheinend nicht im Geringsten der Unhöflichkeit seines Verhaltens bewusst. Oder scherte er sich nur nicht darum? »Nicht der leichte Geschmack, nicht eingängig und unterhaltsam. Dafür ganz und gar originär. Aber was ich noch wichtiger finde: Für mich spricht eine Wahrheit aus dieser Musik, ein aufrichtiger Schmerz und eine Leidenschaft, wie sie nur der haben kann, der das Leiden kennt und daran gewachsen ist.«
Es war, als öffne sich ihr eine Tür in eine wahrhaftere Welt als die, welche sie kannte. Hier galten nicht die Regeln des gesellschaftlichen Plauderns. Das hier war endlich einmal etwas anderes.
»Aber entschuldigen Sie, meine Damen, ich habe Anna Brettschneider versprochen, dass sie ihre Nähmaschine bekommt«, erhob Margarethe Einspruch.
»Dazu warst du nicht autorisiert«, erwiderte ihre Mutter, ganz die Vorsitzende. »Die Mittel, die wir zur Verfügung hatten, sind mit den Unterstützungen, die wir soeben beschlossen haben, fürs Erste aufgebraucht.«
Da hatte sie den Damen des Wohltätigkeitskomitees in den glühendsten Farben geschildert, in welch unerträglichen Verhältnissen sie die arme Frau angetroffen hatte, und nun wurde diese nicht berücksichtigt. Bekam keinen Pfennig, geschweige denn eine Nähmaschine!
Sicher, auch die anderen Fälle, die einzelne Damen vorgetragen und zur gefälligen Unterstützung vorgeschlagen hatten, hörten sich sehr bedrückend an oder gingen zu Herzen, insbesondere der Fall von Kinderlähmung, die gleich drei Kinder einer armen Arbeiterfamilie zu Krüppeln gemacht hatte und so die Mutter zwang, ihre Fabrikarbeit aufzugeben, um die hilflosen Geschöpfe zu versorgen. Aber es durfte doch nicht sein, dass Anna Brettschneider deswegen leer ausging!
»Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, liebe Margarethe«, meinte Frau General von Klaasen begütigend. »Wir werden den Fall Anna Brettschneider wohlwollend vormerken. Es ist durchaus denkbar, dass wir sie bei der nächsten Verteilung von Mitteln berücksichtigen können.«
»Anna Brettschneider braucht die Nähmaschine aber nicht irgendwann später, sie braucht sie jetzt«, machte Margarethe einen letzten verzweifelten Versuch, ihrem Schützling zu helfen. »Wenn Sie gesehen hätten …«
»Bitte verschonen Sie uns mit weiteren Einzelheiten, Baronesse«, wurde sie von Frau Geheimrat von Hörrach unterbrochen. »Wir können uns solche Verhältnisse durchaus vorstellen – im Gegensatz zu Ihnen waren wir schon in mehr als einer Arbeiterwohnung. Aber zunächst einmal muss wieder Geld in unsere Vereinskasse kommen, ehe wir es ausgeben können.«
»Ich bin ganz Ihrer Meinung, verehrte Frau General, verehrte Frau Geheimrat«, stimmte die Mutter zu. »Entschuldigen Sie das jugendliche Ungestüm meiner Tochter.« Ein kurzer, sehr kühler Blick streifte Margarethe, dann wandte sich die Mutter wieder an das Gremium. »Also, meine Damen, lassen Sie uns überlegen, wie wir unser diesjähriges Wohltätigkeitsfest zu einem besonderen Erfolg machen können!«
Sofort entspann sich eine rege Diskussion mit Sammlung von Vorschlägen, die von einem Bazar mit selbstgefertigten Handarbeiten und kunstgewerblichen Gegenständen über eine Tombola bis hin zu musikalischen Darbietungen der verschiedensten Arten reichten. Margarethe saß schweigend da und versuchte sich zu fassen. Sie war so sicher gewesen, mit ihrer Schilderung Anna Brettschneider zu ihrer Nähmaschine zu verhelfen. Wie stand sie nun da? Sie hatte schließlich ihr Wort gegeben!
Aber nicht einmal Frau General von Klaasen hatte verstanden, wie wichtig es war, in diesem Fall sofort zu helfen.
Mühsam zwang sie ihre Gedanken zurück zur Diskussion. Die verwitwete Frau Ministerialrat von Aubach führte soeben aus, dass sie mit ihrer Tochter bereits zwölf Wandteller mit Szenen aus Preußens Geschichte – angefangen vom Großen Kurfürsten – bemalt habe und einen Zyklus von vierundzwanzig Szenen bis hin zur Kaiserkrönung in Versailles herzustellen plane. Sie verspreche sich einen guten Erlös im Bazar davon. Die Damen nickten wohlwollend und murmelten Zustimmung. Die kunstgewerblichen Fähigkeiten der Frau Ministerialrat waren bekannt – und ebenso die dezent vertuschte Tatsache, dass ihre finanziellen Mittel beschränkt waren, weshalb sie Geldleistungen durch persönlichen Einsatz für den Wohltätigkeitsverein zu ersetzen trachtete.
»Meine Verehrten«, erklärte Frau von Klaasen dann in einem Ton, der ihr sofort die allgemeine Aufmerksamkeit sicherte, »so weit so schön und gut. Dergleichen Aktivitäten bieten wir bei unseren Wohltätigkeitsfesten jedes Jahr mit Regelmäßigkeit! Und mit der gleichen Regelmäßigkeit werden die Einnahmen aus diesen Festen von Jahr zu Jahr niedriger. Und warum? Weil unsere Ideen so wenig originell sind, dass sie niemanden mehr anlocken. Wir können uns unsere Handarbeiten ja nicht nur gegenseitig abkaufen! Nein, wir müssen einmal etwas Neues bieten, etwas, was noch nicht da war.«
»Und was? – Sie haben doch gewiss schon eine Idee? – Spannen Sie uns nicht auf die Folter!«, sprachen die Damen durcheinander.
»Nun ja«, Frau General lächelte zufrieden, »ich habe da tatsächlich eine Idee. Unserer lieben Margarethe habe ich einen besonderen Platz dabei zugedacht.«
Margarethe beugte sich vor. Etwas für Anna Brettschneider tun zu können, etwas tun zu können, um diesen Aufruhr in sich zur Ruhe zu bringen!
»Ich dachte an ein lebendes Bild«, verkündete die Generalin.
Ein lebendes Bild? Enttäuscht ließ sich Margarethe in ihren Sessel zurücksinken. Auch die anderen Damen gaben sich zurückhaltend.
»Ich weiß, das klingt zunächst nicht weltbewegend«, meinte die Generalin gelassen. »Aber ich will es erklären. Ich dachte nämlich an ein ganz besonderes Bild, eines, das unserer preußischen Geschichte sehr nahesteht und zugleich auch zu Herzen geht, die Fantasie beflügelt, kurz, alle patriotischen und menschlichen Gefühle auf das Edelste berührt. Und ich dachte daran, dieses Bild eine gewisse Zeit lang zur allgemeinen Bewunderung stehen zu lassen, dann aber die Figuren zum Leben zu erwecken und in Aktion treten zu lassen. Kurz, das Ganze in ein kleines Schauspiel münden zu lassen. Natürlich müsste dazu der Text eigens verfasst werden. Das von mir anvisierte Sujet eignet sich hervorragend, einen Appell an Edelmut und Hilfsbereitschaft unterzubringen. Natürlich sollte das Ganze in Reimen verfasst sein.«
»Ich kenne einen jungen Dichter, dem ich gerne einen Auftrag zukommen lassen würde«, warf die Mutter ein. »Ein gewisser Johann Nietnagel, den ich am nächsten Donnerstag in unserem Salon einführen werde.«
»Johann Nietnagel?«, wiederholte die Generalin. »Noch nie gehört. Aber ich verlasse mich ganz auf Sie, Verehrteste. Jede von uns weiß, wie sicher Ihr Gespür für die wahre Kunst ist und wie gut Sie sich in Künstlerkreisen auskennen. Wenn Sie Herrn Nietnagel für einen begabten jungen Mann halten, so gilt mir das als Beweis seines Könnens. Folglich wird er wohl dazu in der Lage sein, ein kleines Theaterstück zu reimen, das«, sie machte eine kunstvolle Pause und blickte Aufmerksamkeit fordernd in die Runde, »das Tilsiter Treffen unserer hochverehrten Königin Luise mit Kaiser Napoleon zum Thema hat.«
»Das ist ja geradezu genial!«, rief die Frau Geheimrat. »Die vielgeliebte Königin der Herzen, die Mutter des ersten deutschen Kaisers, in einer der schwersten Schicksalsstunden Preußens! Die Personifikation des edlen Mutes einer erhabenen Frau durch Darsteller zum Leben erweckt – natürlich müssen die Kulissen und die Kleidung ganz und gar getreu ausgeführt sein –, das wird Interesse erwecken. Und wenn Königin Luise und Napoleon dann plötzlich zu sprechen beginnen, zu agieren, einfach hinreißend!«
Frau Ministerialrat von Aubach warf ein: »Ich könnte das Bühnenbild malen. Nicht allein natürlich, aber meine Tochter Julia könnte mich dabei unterstützen. Sie ist in vielen Dingen sehr geschickt – und ich würde sie gerne hier im Kreis einführen, wenn es den Damen recht ist.«
»Wie schön«, stimmten die Mutter und die Generalin von Klaasen wie aus einem Mund zu. Frau Kommerzienrat Stolze aber, die neureiche Fabrikantengattin, die in diesem erlauchten Kreis selten den Mund zu öffnen wagte, vergaß ihre Scheu vor all den hochgeborenen Damen und rief aus: »Baronesse von Zug, dann müssen Sie unbedingt die preußische Königin darstellen! Sie haben eine gewisse Typähnlichkeit mit ihr, wenn ich das so sagen darf, die Haarfarbe, die hohe, schlanke Gestalt, den Liebreiz. Und dieses unverkennbar Edle.«
»Sie sprechen mir aus dem Mund«, bestätigte die Generalin leicht süffisant. »Sie werden sich erinnern, dass ich von Anfang an sagte, mein Plan habe mit der Baronesse zu tun.«
Frau Stolze wurde sichtbar kleiner.
»Werden Sie es tun, meine Liebe?«, wandte sich die Generalin an Margarethe.
Diese lächelte zustimmend. »Warum nicht!« So ein paar Reime aufzusagen, sollte wohl möglich sein, und sich in königliche Pose zu stellen und betrachten zu lassen, erst recht. Sie wusste um ihre Wirkung – und sie musste zugeben, dass sie geheimen Gefallen daran fand, bewundert zu werden. »Wenn Sie meinen, dass wir dadurch die Spendenfreudigkeit des Publikums anregen können?«
»Aber mit Sicherheit«, erwiderte ihre Mutter. Die Begeisterung hatte ihre Kühle vertrieben. »Ich stelle mir vor, dass du dann als Königin Luise an der Hand Napoleons mit einem Körbchen durch die Reihen gehst und jeden Herrn persönlich ansprichst. Den Herrn möchte ich sehen, der für die hochverehrte, geliebte preußische Königin nicht anständig seine Geldtasche zückt! Es ist also beschlossene Sache?«
Ringsum wurde eifrig genickt.
»Fragt sich nur: Wer gibt den Napoleon?«, fragte Frau Geheimrat von Hörrach. »Die Herren sind im Allgemeinen nicht so leicht zu solcherlei Darbietungen zu gewinnen.«
»Nun«, meinte Frau General von Klaasen und lächelte zufrieden, »das lassen Sie meine Sorge sein! Ich denke, es ist klar, wer am besten für diese Rolle in Frage kommt: mein älterer Sohn.« Und dann fügte sie mit einem Anflug von Ironie hinzu: »Er hat die richtige Statur.«
Das ist es also, dachte Margarethe. Dazu hat sie das alles eingefädelt. Damit wir uns bei den Proben näherkommen, Hauptmann von Klaasen und ich. Wahrscheinlich wartet sie darauf, dass wir spätestens nach der Vorstellung unsere Verlobung bekannt geben.
Auf einmal kam sie sich vor wie ein gefangener Vogel.
»Doch pfiff auch dreist die feile Dirne,
die Welt, ihn aus: Er ist verrückt!
Ihm hatte leuchtend auf die Stirne
der Genius seinen Kuss gedrückt.
Und wenn vom holden Wahnsinn trunken,
er zitternd Vers an Vers gereiht,
dann schien auf ewig ihm versunken
die Welt und ihre Nüchternheit.
In Fetzen hing ihm seine Bluse,
sein Nachbar lieh ihm trocknes Brot,
er aber stammelte: O Muse!,
und wusste nichts von seiner Not …«
Er schreibt über sich selbst, dachte Margarethe und beobachtete die schmale Gestalt Johann Nietnagels, der da vorn im Musiksaal in seinem schäbigen Leihhausfrack stand und der versammelten Gesellschaft seine Gedichte vortrug. Wie angenehm dieser Hauch von Selbstironie ist …
Unbeirrt seinen eigenen Weg zu gehen wie dieser Dichter da. So weit zu kommen, dass es einem nichts mehr ausmacht, wenn die ganze Welt einen für verrückt erklärt …
Nein, das war ihr unvorstellbar.
Eine Frau stand und fiel mit dem Ruf, den sie in der Welt hatte. Gab es sie überhaupt hinter diesem Ruf? War sie selbst mehr als das, was sie schien, mehr als eine charmante junge Dame der besten Gesellschaft? Hatte sie eine Essenz, ein unaustauschbares Inneres?
Manchmal meinte sie es zu spüren. Doch wenn sie danach greifen wollte, entglitt es ihr. Nur die Sehnsucht war da, vage, unbestimmt.
Was bliebe von ihr, wenn ihr alles genommen würde, was sie scheinbar ausmachte: ihre Kleider, ihr Schmuck, ihr gepflegtes Äußeres, ihre Umgebung – die Herkunft aus hohem Haus, die Tochter eines Reichstagsabgeordneten, die umworbene Erbin mit glänzender Mitgift und klangvollem Namen?
Johann Nietnagel hatte alles aufgegeben, was ihn einmal äußerlich ausgemacht hatte, und folgte seiner inneren Stimme. Sohn eines Juristen, eines Bürgermeisters solle er sein, hatte Maman gesagt, Literatur und Philosophie studiert haben. Er hätte eine gesicherte Existenz als Gymnasialprofessor haben können – wenn er sich nicht ganz der Muse geweiht hätte. Maman fand das interessant. Papa dumm. Und sie?
»… ein Träumer, ein verlorner Sohn!«, beendete Johann Nietnagel seinen Vortrag.
Wohlwollender Applaus. »Naturalismus in reinster Ausgestaltung«, hörte Margarethe ihre vor ihr sitzende Mutter in bedeutungsvollem Ton Frau Doktor Schneider zuflüstern, der Gattin des Hausarztes. Diese nickte mit Kennermiene.
Der Dichter blätterte in seinem Manuskript, nahm eine neue Seite zur Hand. »Ein Bild«, verkündete er und begann mit seinen Versen tatsächlich vor Margarethes innerem Auge ein Bild entstehen zu lassen: eine reiche Villa, wie sie hier in der Nachbarschaft im Westend zu stehen schien, doch dunkel verhangen, jeder Ton erstickt, die Dienerschaft um völlige Lautlosigkeit bemüht. Ein Todesfall in der Familie?, fragte sie sich, mehr und mehr in den Bann des Gedichtes, in den Bann dieser suggestiven, das unverkennbar Tragische untermalenden Stimme gezogen:
»Der hochgeborne Hausherr, Exzellenz,
schwankt wie ein Rohr umher auf bleicher Düne,
die erste Redekraft des Parlaments
fehlt heute abermals auf der Tribüne …«
War das nicht Papa?
»… schon viermal war der greise Hausarzt da
und meinte, dass es sehr bedenklich stünde.«
Doch dann auf einmal änderte sich der Ton der Stimme, nahm etwas Ironisch-Distanziertes an:
»Nach Eis und Himbeer wird sehr oft geschellt,
doch mäuschenstill ist es im Krankenzimmer …«
Sie wandte keinen Blick mehr von diesem jungen Mann dort vorn, der unverkennbar spöttische Zug um seinen Mund, wie er immer weiter die Atmosphäre des Hauses beschrieb, das ob des Geschehens im Krankenzimmer den Atem anhielt. Doch nein, in seinen Augen blitzte nicht nur der Spott, das war etwas Heißeres:
»… die Luft umher ist wie gewitterschwül,
denn ach, die gnäd' ge Frau hat heut – Migräne!«,
schloss Johann Nietnagel. Eine Männerstimme im Publikum lachte laut auf, war das nicht Papa? Jedenfalls applaudierte er mit unverkennbarem Vergnügen, er, dem diese literarischen Abende in aller Regel eine lästige gesellschaftliche Pflicht waren. Auch das eine oder andere weitere Lachen war vernehmlich, vereinzeltes Klatschen. Universitätsprofessor Unschlicht strahlte über das ganze Gesicht. Doch die versteinerten Mienen und die Hände, die unbewegt im Schoß liegen blieben, überwogen. Und das Schweigen, das von diesen Mienen und Händen ausging, verbreitete sich rasch und erstickte auch die anfänglichen Äußerungen des Gefallens.
»Was bildet dieser Mensch sich ein!«, zischte eine empörte Frauenstimme.
»Unerhört«, sagte Hauptmann von Klaasen laut. »Der reine Klassenhass!«
Die Mutter erhob sich. »Meine Damen, meine Herren. Meine Tochter möchte gern ein Klavierstück zu Gehör bringen, war es nicht die Appassionata, Margarethe?«
Wie? Margarethe zuckte zusammen. Hatte sie recht gehört? War sie soeben von ihrer Mutter als Pianistin angekündigt worden?
Zwar hatte sie die Beethoven-Sonate in den vergangenen Monaten so intensiv studiert, dass sie in der Lage sein sollte, sie vor Publikum zum Besten zu geben, aber das war nicht abgesprochen, sie hatte ein Glas Champagner und etwas Wein getrunken, was sie vor dem Klavierspielen niemals tat, und der erste und dritte Satz stellten hohe Anforderungen an ihr technisches Können und erforderten allerhöchste Konzentration.
Ein beschwörender Blick der Mutter traf sie. Maman hatte ein untrügliches Gespür dafür, wann gesellschaftliche Situationen zu kippen drohten. Und ebenso untrüglich wusste sie in jeder Situation, wie sie zu retten war. Nun also war Margarethes Part gefragt.
Gehorsam erhob sich Margarethe, neigte leicht den Kopf auf den freundlichen Beifall hin, der ihr galt und nicht dem Dichter dort vorn. Noch immer stand er hinter dem Rednerpult und musterte das Publikum mit Augen, als wolle er gleichsam eine innere Fotografie anfertigen.
»Migräne ist eine furchtbare Krankheit, ein Leiden, das sich keiner vorstellen kann, der es nicht erlebt hat!«, verkündete Frau Universitätsprofessor Unschlicht mit schriller Stimme, »und dieser Mensch, dieser Mensch! Herr Doktor, sagen Sie doch etwas dazu!«
Der Hausarzt Dr. Schneider lächelte leise. »Gewiss, Frau Universitätsprofessor, gewiss kann Migräne ein furchtbares Leiden darstellen. Eine schwerwiegende und äußerst quälende Erkrankung, ohne Zweifel. Nur – wir wollen doch nicht leugnen, dass die Ausrede Migräne gelegentlich auch für anderes herhalten muss, für leichte Befindlichkeitsstörungen und seelische Verstimmungen, womöglich auch für die eine oder andere Unlust, nicht wahr?«
»Und das, meine ich, hat der Dichter ganz vorzüglich angedeutet mit seinem Verweis auf Eis und Himbeeren!«, schaltete sich Frau Doktor Schneider, eine geborene Baronesse von Zietowitz, lebhaft ein. »Wer jemals eine wirkliche Migräne hatte, weiß, dass da weder an Eis mit Himbeeren noch an sonst irgendetwas Essbares auch nur im Entferntesten zu denken ist.«
»Nehmen Sie diesen Menschen etwa auch noch in Schutz?«, empörte sich Frau Universitätsprofessor Unschlicht. »Eine Person, die so über unsere Kreise herzieht? Ich für mein Teil …«
»Meine Damen, meine Herren«, sagte Margarethe laut und verneigte sich noch einmal, »wenn Sie mir Ihr wohlwollendes Gehör schenken würden? Blätterst du mir um, Maman?«
Sie klappte den Deckel des Flügels auf, legte die Noten zurecht, sandte ein Stoßgebet gen Himmel und begann zu spielen. Der erste Satz mit seinem düster drohenden Bass und dem schicksalhaften Klopfmotiv forderte sie bis zum Äußersten. Dennoch bedachte sie bei ihrem Spiel auch noch, was für eine Figur sie dabei abgab. Nicht zu exaltierte Körperbewegungen, das wirkt bei einer Dame leicht deplatziert, pflegte die Mutter sie zu ermahnen.
Mit einigen Patzern, die sie gekonnt überspielte, kam sie heil durch das Stück. Sie atmete heimlich auf und widmete sich dem technisch einfacheren zweiten Satz mit mehr Empathie, vergaß endlich die Zuhörer, vergaß, auf ihr Äußeres zu achten, war nur noch bei dieser innig singenden Musik, spürte etwas in sich weit werden und sehnen und hoffen. Und diese Einheit mit der Musik blieb ihr auch bei dem dritten Satz erhalten, den sie in furiosem Tempo nahm. Bald neunzehn Jahre täglicher Etüden hatten ihre Finger geläufig gemacht, ihre Technik geschult, ließen sie auch dem verzweifelten Rasen der Sechzehntel, dem Presto der galoppierenden Achtel gewachsen sein. Wie einen Hafen erreichte sie aus dem ungestümen Lauf heraus die drei Schlussakkorde.
Stürmischer Applaus brachte sie in den Saal zurück. »Sie sind eine wahre Künstlerin der Tasten«, erklärte Hauptmann von Klaasen und neigte sich über ihre Hand. An seinem Arm wechselte sie in das angrenzende Speisezimmer hinüber, in dem ein Kuchenbuffet errichtet war. Johann Nietnagel stand im Erker ans Fensterbrett gelehnt und schob mit unübersehbarem Appetit ein Stück Apfelkuchen in sich hinein. Hatte er ihrem Klaviervortrag etwa gar nicht beigewohnt?!
»Dieser Dichter scheint zu befürchten, gleich des Hauses verwiesen zu werden, und will zuvor noch sein Honorar verspeisen«, flüsterte sie Hauptmann von Klaasen süffisant zu. Woher kam der feine Stich in ihrer Brust, den sie dabei verspürte? Als habe sie soeben Verrat begangen.
Der Hauptmann gab ihr lachend recht.
»Stellen Sie sich vor«, setzte sie noch eins obendrauf, »er ist von meiner Mutter dazu auserkoren, die Dialoge zu schreiben, mit denen wir beim Wohltätigkeitsfest Napoleon und Luise geben sollen.«
»Das ist nicht möglich?«, fragte er entsetzt. »Ihm fehlt mit Sicherheit der patriotische Ernst!«
Sie zuckte lächelnd die Achseln. »Meine Mutter hat nun einmal eine Schwäche für Randfiguren des Kulturbetriebes. Lassen Sie mich nur machen! Ich werde klarstellen, in welchem Sinn das Stück verfasst sein soll.«
Damit trennte sie sich von Hauptmann von Klaasen und schlenderte zu dem Dichter hinüber.
»Nun?«, fragte sie kühl und sah einige Zentimeter an ihm vorbei zum Fenster hinaus in den beleuchteten Garten. »Hat meine Mutter Sie von dem Auftrag schon in Kenntnis gesetzt, ein Stück über Napoleon und Königin Luise zu schreiben?«
»Sie ist heute vor meinem Vortrag mit dem Vorschlag auf mich zugekommen«, erwiderte er und stellte den Teller beiseite. »Wer weiß, ob sie es danach noch getan hätte! Aber ich musste Ihrer Frau Mutter ohnehin mit meinem aufrichtigen Bedauern – sie ist eine bewunderungswürdige Ausnahmeerscheinung in dieser Gesellschaft, wenn ich mir das zu bemerken erlauben darf –, ich musste ihr leider abschlägigen Bescheid geben. Ich fertige keine Auftragsarbeit.«
Sie sog hart die Luft ein, starrte ihn an. Dann wurde ihr bewusst, wie undamenhaft ihr Verhalten war. Dennoch senkte sie den Blick nicht.
Johann Nietnagel strich sich mit heftiger Geste die Haare aus der Stirn. »Zudem entspricht der Stoff ganz und gar nicht meinem Interesse. Ich bin an der Gegenwart interessiert, nicht an der Vergangenheit. Ein unbestechlicher Chronist unserer Zeit will ich sein, einfangen, was ist, ihm eine der Wirklichkeit, der Natur möglichst nahe Form geben. Die Wahrheit schreiben. Und so auch den Stummen meine Stimme leihen. Verstehen Sie?«
Wider Willen nickte sie. Da hatte ihre Mutter geglaubt, ein gutes Werk zu tun, wenn sie diesem Dichter einen bezahlten Auftrag gab, und nun wies dieser ihn einfach zurück. Und sie selbst, sie hatte gemeint, ihm vorschreiben zu können, in welchem Sinne er das Ganze verfassen sollte! Wie lächerlich sie sich damit gemacht hätte, wenn sie es ausgesprochen hätte! Diese Unabhängigkeit …
»Aber – Sie müssen doch – können Sie denn – davon leben?«, fragte sie stockend.
Er lachte. Klang Bitterkeit in diesem Lachen oder Triumph? »Nach Ihren Maßstäben sicher nicht«, erwiderte er. »Nach meinen schon. Auch wenn mein Frack aus dem Leihhaus ist, wie Sie zweifellos bemerkt haben. Nach diesem Abend werde ich ihn ohnehin nicht mehr benötigen. Ich glaube nicht, dass man mich so bald wieder in Ihre Kreise einladen wird. Man wird mir meinen Spott über die Migräne der hochgeborenen Damen nicht verzeihen.«
Dies klang so ironisch, so gar nicht schuldbewusst oder sich selbst bemitleidend, dass sie unwillkürlich lächelte. »Nun, meine Mutter hat in dieser Hinsicht ein weites Herz. Frau Universitätsprofessor Unschlicht dagegen mit Sicherheit nicht. Sie würde ihre Migräne zweifellos gerne im gleichen Umfang zelebrieren, wie es Ihr Gedicht beschreibt – leider fehlen ihr dafür die goldbetresste Dienerschaft und auch der hochgeborne Hausherr. Dafür hat ihrem Gatten Ihr Gedicht umso besser gefallen. Ich meine, er hatte eine geradezu diebische Freude daran, und das zählt mehr als die Gekränktheit seiner Gattin. Er ist ein bedeutender Romanist.«
»Ich weiß. Ich habe eine Vorlesung über die französischen Naturalisten bei ihm gehört und eines seiner Seminare besucht.«
Die Arroganz dieses Menschen war unerträglich. Warum musste er ihr permanent das Gefühl geben, dass alles, was sie sagte, falsch oder deplatziert sei?
»Um auf Ihre Frage zurückzukommen«, fuhr Herr Nietnagel fort. »Nur das ist mir unverzichtbar: Freiheit und Würde. Gerechtigkeit. Vor allem aber die Kunst. Nach ihr suche ich, nach der wirklichen Wahrheit. Ich brauche keinen goldenen Käfig. Ich lebe im Hinterhof einer Mietskaserne unter Menschen, die das Leben kennen, wie es ist. Von ihnen habe ich gelernt, mit wie wenig man überleben kann. Im Gegensatz zu mir haben sie niemals eine Alternative zur Armut gehabt. Sie sind hineingeboren.«
»Du solltest dich langsam nach Stoffen für das Kleid umsehen«, sagte die Mutter, stellte ihre Kaffeetasse behutsam hin und tupfte sich die Mundwinkel mit der Serviette ab. »Man kann sich gar nicht früh genug darum kümmern. Natürlich kommt nur schwere Atlasseide infrage. Ich denke, wir werden uns mit der Ausstattung an unserem Gemälde orientieren.«
Margarete nickte. Sie hatte sich das berühmte Bildnis der Königin Luise sehr genau angesehen, das sie in Kopie im Salon hängen hatten: die Königin stehend hinter dem sitzenden König. Die Vorstellung, sich in einem solch locker fließenden Empirekleid zu präsentieren, mit hochgeschnürtem Busen, doch sonst ohne Korsett, so ganz natürlich, hatte etwas Reizvolles. Fast als tue sie heimlich etwas Verbotenes – und doch in aller Öffentlichkeit. Und diese lockere Frisur würde ihr auch gut stehen. Überhaupt: die berühmteste Königin der preußischen Geschichte lebendig werden zu lassen, das war ein Gedanke, dem sie immer mehr abgewinnen konnte, je mehr sie sich damit beschäftigte. Und dann auch noch zu einem guten Zweck …
Effi La Fontière, eine entfernte Nichte von General von Klaasen, die sich gelegentlich als Schriftstellerin hervortat, würde das Gedicht verfassen, nun, da Johann Nietnagel als Dichter ausschied. Margarethes Gedanken blieben einen Moment bei ihm hängen. Wirklich bodenlos arrogant, wie er sich verhalten hatte! Und warum um alles in der Welt versagten ihre Konversationsgabe und Schlagfertigkeit ausgerechnet im Umgang mit ihm?
Ach, was machte es! Sie würde ihn nie wiedersehen.
Die gute Effi würde zweifellos ein Stück schreiben, das dem Anlass genau angemessen war. Und das die Königin ins rechte Licht rückte.
Zum Glück musste sie Königin Luise ja nicht in einer Szene mit ihrem Gatten darstellen, von dem es hieß, sie sei ihm in großer Liebe verbunden gewesen, sondern mit Napoleon, dem sie mit einer Bitte für ihr Vaterland gegenübertreten würde. Da war sie nicht gezwungen, etwas anderes als Hoheit in ihren Blick zu legen, vielleicht auch eine gewisse Demut, doch geschützt durch Unnahbarkeit. Das war gut.
»Nur mit der Brosche wird es schwierig«, meinte sie nachdenklich. »Du weißt, die Brosche, die an der Schulter das Kleid zusammenhält. Etwas Vergleichbares besitzt du doch nicht, Maman?«
»Nein, das nicht«, erwiderte die Mutter. »Ich habe mir auch schon über den Schmuck den Kopf zerbrochen. Als Diadem können wir das meiner Urgroßmutter verwenden. Auch wenn es nicht identisch ist, es passt hervorragend. Es stammt aus der gleichen Zeit und meine Urgroßmutter war schließlich Prinzessin aus einem Haus, das Mecklenburg-Schwerin in nichts nachstand. Aber die Brosche – es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als sie nach der Vorlage anfertigen zu lassen. Was meinst du, Rüdiger?«
Der Vater sah von der Zeitung auf. »Das hört sich an, als ob mich eure Wohltätigkeit teuer zu stehen kommen würde«, meinte er trocken. »Es käme mich offensichtlich billiger, einen erklecklichen Betrag in deinen Wohltätigkeitsverein zu spenden, liebste Augusta, als diesen Bühnenzauber zu finanzieren, von dem noch offen ist, ob er als Einnahmen überhaupt einspielen wird, was er mit Sicherheit an Ausgaben kostet. Aber wenn es meine hinreißende Tochter glücklich macht!«
Diese Worte tauchten blitzartig die ganze Situation in ein gleißendes Licht. Warum hatte sie das alles bisher nicht gesehen? Sich auch noch eingebildet, ein gutes Werk zu tun?
»Wie prosaisch du immer redest, Rüdiger!«, erwiderte die Mutter leicht verärgert. »Wenn du in der Bank deine Bilanzen im Kopf hast, schön und gut, dort gehören sie hin. Aber hier geht es doch wahrhaftig um anderes! Und zugleich um ein gesellschaftliches Ereignis, das auch deinem Ruf und damit deinem Erfolg als Bankier und als Reichstagsabgeordneter zugutekommen wird, wie du sehr wohl weißt. Im Übrigen meine ich natürlich keine echte Kopie der Brosche. Eine wirklich gute Imitation aus böhmischem Glas tut es auch. Und das Kostüm lässt sich ohne Weiteres in ein paar Jahren noch einmal bei einem Kostümball tragen, sodass die Ausgabe gerechtfertigt ist.«
»Gewiss, gewiss«, begütigte der Vater.
»Aber Papa hat recht!«, rief Margarethe. Wie eine billige Farce erschien ihr plötzlich dieses ganze Wohltätigkeitsgesäusel. Und auf einmal war die längst ins Vergessen verdrängte Erinnerung an das Kellerloch von Anna Brettschneider wieder da. »Von dem Geld, das wir hier verplanen, ließe sich für Anna Brettschneider nicht nur eine Nähmaschine kaufen, sondern wahrscheinlich auch noch eine halbe Wohnungseinrichtung!«
»Anna Brettschneider?«, fuhr die Mutter auf. »Ich dachte, das wäre erledigt! Du hattest den Auftrag, im Namen des Wohltätigkeitsvereins dieser Frau einen Absagebrief zukommen zu lassen. Hast du das nicht getan?«
Margarethe schüttelte den Kopf. »Ich habe es nicht über mich gebracht.«
»Ach«, erwiderte die Mutter, »meinst du, es ist besser für die arme Frau, wenn sie sich weiter in falschen Hoffnungen wiegt?«
»Aber wir können sie doch nicht so im Stich lassen!«, widersprach Margarethe, um das schlechte Gewissen zum Schweigen zu bringen, das sich auf einmal leise meldete.
»Meine liebe Tochter«, erwiderte die Mutter, »das Elend in den Hinterhöfen ist schier uferlos – und bisher hat es dich nicht im Geringsten interessiert. Ich erinnere mich, dass du meine wiederholten Aufforderungen, dich in unserem Verein zu engagieren, mit der Begründung abzulehnen pflegtest, das sei dir zu langweilig. Nun hast du zum ersten Mal an einem winzigen Zipfel einen Blick auf das Elend erhascht und meinst, das wäre der Nabel der Welt. Aber solche verlassenen oder verwitweten Frauen, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen, gibt es wie Sand am Meer. Und mehr noch kinderreiche Frauen von Trunkenbolden, von Invaliden und Kranken, von Arbeitsscheuen oder miserabel verdienenden Ungelernten, bei denen es vorne und hinten nicht reicht. Was glaubst du denn, warum ich mit einigen gleichgesinnten Damen unseren Verein Misericordia gegründet habe! Genau um solchen Frauen und ihren Kindern zu helfen. Aber wir können nun einmal nicht die ganze Welt retten.«
Die Worte der Mutter waren wahr, sie konnte nichts dagegen einwenden. Aber dennoch sollte sie vielleicht noch einen Versuch unternehmen?
Sie wandte sich an ihren Vater: »Papa, bitte!«
Er hob die Hände. »Ich halte es mit dem Alten Fritz: Ich bin für Gewaltenteilung. Die Wohltätigkeit ist eindeutig das Ressort deiner Mutter, ich werde mich hüten, mich da einzumischen. Ich bin lediglich der Mittelgeber, und was ich gebe, das lege ich in ihre Hände. Dort ist es bestens aufgehoben.« Damit versenkte er sich wieder in seine Zeitung.
»Was den Text der Aufführung anbelangt«, wechselte die Mutter in einem Ton das Thema, dass Margarethe wusste, die Frage Anna Brettschneider war ein für alle Mal erledigt, »so sollten wir uns gelegentlich mit Frau La Fontière zusammensetzen. Ich fürchte, die Gute wird uns sonst ein unerträglich sentimentales Rührstück abliefern. Ja, was ist?«, wandte sie sich zu dem Diener um, der geräuschlos in den Raum getreten war und mit dezentem Hüsteln an der Tür des Wintergartens stehen blieb, in dem die Familie gelegentlich zu speisen pflegte, wenn man ganz unter sich war so wie heute.
»Hauptmann von Klaasen bittet darum, seine Aufwartung machen zu dürfen«, antwortete dieser.
»Hauptmann von Klaasen?«, wiederholte die Mutter lebhaft. »Wir lassen bitten!« Ein bedeutungsvoller Blick traf Margarethe.
Nicht auch das noch! Was soll ich tun, wenn er mir einen Antrag macht? Ein Ja schien ebenso unmöglich wie ein Nein.
Wenn sie Nein sagte, so würde sie ihn kränken. Mit Sicherheit würde er sie kein zweites Mal fragen, ein Klaasen hielt auf seine Ehre. Und eine Partie wie Hauptmann von Klaasen, von der jede junge Dame ihrer Kreise träumen würde, schlug man doch nicht aus!
Aber die Werbung annehmen, ohne Liebe …?
War das nicht Verrat? Verrat an ihm – Verrat an der Liebe – Verrat vielleicht sogar an sich selbst? Doch woher sollte sie wissen, ob nach ihm noch ein anderer kommen würde und vor allem: ein besserer! Fast die Hälfte der Damen der oberen Kreise blieb unvermählt. Sollte sie wirklich ewig dieses Leben weiterführen, wie sie es jetzt tat, diese ganze Nutzlosigkeit und Belanglosigkeit? Diese gähnende Langeweile? Papas hinreißende Tochter.
Hier eine Gesellschaft und dort eine Landpartie, hier die Oper, dort ein Ball, die Aufführung beim Wohltätigkeitsfest, ein bisschen lesen, ein bisschen musizieren, ein bisschen malen oder sticken und hinter dem allen das öde Nichts. Keine Aufgabe, kein Ziel.
Es gab keinen anderen Weg, ein sinnerfülltes Leben zu führen, als zu heiraten. Wie Maman ein großes Haus führen, in dem Künstler und Gelehrte ein und aus gingen, es zu einem Mittelpunkt der Gesellschaft machen. Und vor allem: eine eigene Familie haben, Kinder.
Das war die Aufgabe, die einzige. Mit Hauptmann von Klaasen rückte sie greifbar nahe. Sein Name war so klangvoll, dass es ein Leichtes sein würde, ihr Haus zu einem gesellschaftlichen Anziehungspunkt zu machen.
Das alles sprach für ein Ja auf den Antrag, der kommen würde, kommen musste. Wenn da nicht diese Furcht davor wäre, sich für alle Zeit zu binden – und womöglich an den Falschen. Dieses Gefühl, dass da noch etwas sein musste, etwas Wesentliches, was sie nicht kannte – und was sie mit Hauptmann von Klaasen niemals kennenlernen würde.
Liebe musste sich doch anders anfühlen als diese gewisse Vertrautheit, die sie dem Hauptmann gegenüber empfand. Liebe musste doch etwas so Mitreißendes sein, etwas so durch und durch Erfüllendes, dass es keine Zweifel mehr gab.
Ob ihm wirklich an ihr gelegen war – oder nur an ihrer Mitgift?
Verlass dich ganz auf dein Herz, hatte die Mutter geraten, als sie einmal mit ihr darüber gesprochen hatte, wie man denn den Richtigen erkennen könne. Es wird dir sagen, was richtig ist. Aber was sollte man tun, wenn das Herz schwieg? In ihren jungen Jahren hatte sie sich mehrfach schwärmerisch verliebt, war bald für den einen Offizier entflammt gewesen, bald für den anderen. Aber diese untrügliche Stimme des Herzens, das Dieser oder keiner hatte sie nie gehört.
Vielleicht hatte sie gar kein Herz. Und alles Warten würde vergebens sein, das, worauf sie wartete, würde niemals eintreten, und eines Tages würde sie unversehens eine alte Jungfer sein und kein Mann würde je mehr um ihre Hand anhalten.
Wahrscheinlich lag es an ihr.
Sie nahm kaum wahr, wie Hauptmann von Klaasen eintrat und sie alle begrüßte, reichte ihm mechanisch die Hand zum Kuss, beteiligte sich nicht an der höflichen Plauderei, die sich zwischen den Eltern und dem Hauptmann entspann. Obwohl sie die Augen niedergeschlagen hielt, spürte sie immer wieder seinen Blick auf sich – und den Blick der Mutter, der zwischen ihr und Hauptmann von Klaasen hin und her ging.
Schon nach wenigen Minuten erklärte der Vater, seine Geschäfte warteten auf ihn, und kaum war der Vater gegangen, erhob sich auch die Mutter und bedauerte, nicht weiter die angenehme Gesellschaft des Hauptmanns teilen zu können, weil sie dringend ein Musikstück einstudieren müsse, das sie am Abend zum Besten geben wolle. Höflich wollte auch er sich verabschieden, doch die Mutter hinderte ihn daran: Er möge doch mit Margarethes Konversation vorliebnehmen und möge sich nicht stören lassen, wenn sie nebenan ein wenig Klavier übe.
Margarethe stieg das Blut in den Kopf. Was für ein abgekartetes Spiel! Niemals sonst ließ die Mutter sie mit einem Herrn allein, und nun verschwand sie im Musiksaal und ließ die doppelflügelige Glastür nur gerade so viel offen, wie es der Anstand dringend erforderte.
Nebenan erklang Für Elise, ein Stück, das die Mutter auswendig zu spielen pflegte und auch in seinem schwierigeren Mittelteil völlig fehlerlos und im richtigen Tempo beherrschte. Diese schmachtenden Töne!
Der Hauptmann sah auf seine Hände, faltete sie ineinander, verknotete sie. Eine Welle von Sympathie stieg plötzlich in ihr auf. Offensichtlich war ihm die Situation genauso unangenehm wie ihr!
»Ich hatte schon lange vor, bei Ihnen vorstellig zu werden, Baronesse«, begann er zögernd.
Sie lächelte ihr strahlendstes Lächeln. »Ja, ich habe Sie erwartet. Wir müssen über unsere Darstellung bei dem Wohltätigkeitsfest sprechen, nicht wahr? Königin Luise und Napoleon. Johann Nietnagel steht ja nun glücklicherweise als Dichter nicht mehr zur Debatte. Aber wir sollten mit Ihrer werten Cousine ein wenig beraten, auf welche Art sie den Stoff zu fassen gedenkt. Was meinen Sie?«
»Gewiss, ja, das auch. Sie dürfen versichert sein, es ist mir eine große Freude und Ehre, mit Ihnen gemeinsam in diesem Stück auftreten zu dürfen.« Er stockte, fuhr schließlich fort: »Aber das Werk mit der Verfasserin abzusprechen, denke ich, kann ich ganz und gar Ihnen überlassen, Verehrteste. Sie wissen ja aus unseren Tischgesprächen: In Sachen Kunst und Literatur bin ich nicht so bewandert wie Sie.«
Sie neigte leicht den Kopf.
Er warf ihr einen tiefen Blick zu. »Ich bewundere sehr Ihre Bildung im Kulturellen. Ihr seelenvolles Klavierspiel. Ihre Schönheit. Ihren hinreißenden Charme. Dieses Unbeschwerte, Leichte, wenn ich es so nennen darf. In Ihrer Gegenwart, im Haus Ihrer Eltern, darf man den Ernst der Welt vergessen und fühlt sich emporgehoben zu den erhabeneren Dingen, tritt sozusagen ein in das Reich der Musen. Was für eine wohltuende Erholung für einen Mann des Militärs, der pflichtgetreu seinen Dienst für Kaiser und Vaterland tut und auf die Stunde seiner Bewährung wartet.«
»Eine Stunde, die hoffentlich nie eintritt«, gab sie zurück. »Die Künste gedeihen nun einmal nur im Frieden, und es bedarf solcher Männer, wie Sie einer sind, um diesen zu sichern.«
»Wie schön Sie das sagen«, erwiderte er. »Wenn Sie einmal einen eigenen Salon führen werden, wird er dem Ihrer verehrten Frau Mutter in nichts nachstehen.«
Um Himmels willen, was für eine Richtung nahm das Gespräch! Als Nächstes würde er sich erbieten, ihr durch eine Heirat den Rahmen für diesen Salon zu stellen. Sie musste dem Gespräch eine andere Wendung geben. Doch wie?
Ihr Blick fiel auf die Zeitung, die der Vater mit der Rückseite nach oben auf den Tisch gelegt hatte. Eine Anzeige des Lessing-Theaters stach ihr ins Auge: »Nora. Von Henrik Ibsen. Noch Karten der besten Kategorien (6,50 – 7,50 Mark) frei für die heutige Aufführung.«
»Würden Sie mir wohl eine große Freude machen, Herr Hauptmann?«, fragte sie rasch.
»Mit dem größten Vergnügen!« Er verneigte sich.
»Ich würde so gerne heute Abend ins Theater gehen, in die Nora, würden Sie mich wohl begleiten? Natürlich müssten wir noch eine Gesellschafterin mitnehmen, wenn Sie drei Karten bestellen wollten?«
»Gewiss, ja.«
War es Enttäuschung oder Erleichterung, was sie auf seinem Gesicht las? Sie erhob sich. »Wie schön, dann sehen wir uns ja heute Abend. Ich freue mich sehr darauf. Und jetzt, wenn Sie mich bitte entschuldigen würden …«
»Zu allem Übel auch noch dieses Stück!«, hatte die Mutter entsetzt gesagt. »Einem Mann, der drauf und dran ist, dir einen Antrag zu machen, muss dies mehr als merkwürdig vorkommen, um nicht zu sagen, es muss ihm als Affront erscheinen. Nun, dann sieh zu, welche Dame dich mit dem Hauptmann ins Theater begleitet! Auf mich wirst du jedenfalls verzichten müssen.« Doch dann, nach einer verstimmten Pause, hatte die Mutter auf einmal ganz weich und ernst gefragt: »Wäre dir denn sein Antrag so unangenehm, Margarethe?«
Sie wusste es doch nicht! Tatsächlich war sie nach den Vorhaltungen der Mutter geradezu in Panik verfallen bei dem Gedanken, sie könnte durch ihr Verhalten für immer eine Tür zugeschlagen haben, die sie sich offenhalten wollte – und sei es nur einen schmalen Spalt. Oder vielleicht mehr als das. Wenn schon heiraten, warum dann nicht Hauptmann von Klaasen?
Sie würde jedenfalls eine Schwiegermutter haben, mit der sie sich vertrug.
Und vertragen würde sie sich ja auch mit dem Hauptmann, er hatte gepflegte Manieren und war zweifellos ein Mann von Ehre. Aber mit ihm das Bett zu teilen? Sie konnte es sich nicht vorstellen.
Dabei lag es nicht daran, dass sie so unwissend wäre, wie man höhere Töchter gewöhnlich hielt – eher im Gegenteil. Wenn sie ihr Leben nur in der höheren Töchterschule und im Mädchenpensionat verbracht hätte, wo man stets nur von der Seele und dem Herzen sprach, nie vom Körper, wo man die Klassiker und die Bibel in für die Jugend bereinigter Form las und alles auf das Peinlichste vermied, was auf etwas anderes hindeuten könnte, als dass ein Mädchen Kopf, Hände und Gemüt hatte und sonst nichts, nichts, nichts – dann würde sie sich vielleicht nicht so viele Gedanken machen.
Aber sie war in einem liberalen Elternhaus aufgewachsen. Ihr Vater hielt nichts von verschlossenen Bücherschränken und einem Verbot für seine Tochter, die Bibliothek zu benutzen, wie es in den meisten der Margarethe bekannten Elternhäuser gang und gäbe war. Und ihre Mutter sammelte mit wahrer Leidenschaft zeitgenössische sozialkritische Gesellschaftsromane, in denen schließlich immer und immer wieder das Verhältnis der Geschlechter zum literarischen Ausdruck kam – und Kunstbücher aller Art. Auch einen Band mit Fotografien griechischer Vasen hatte Margarethe vor Jahren in der Bibliothek entdeckt, Vasen mit Abbildungen, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließen. Fast schlugen sich die Seiten schon von selbst auf, so oft hatte sie seinerzeit diese Bilder betrachtet.
Nein, sie konnte sich nicht vorstellen, etwas in dieser Art mit Hauptmann von Klaasen zu tun. Mehr noch: dazu verpflichtet zu sein durch Trauschein und Gesetz.
Und doch schien – wenn sie an die Andeutungen in den vielen ergreifenden Romanen dachte, in denen sie von Liebe und Ehebruch gelesen hatte – genau diese körperliche Vereinigung das zu sein, wohin es Liebende mit unwiderstehlicher Macht zog. Da konnte sie doch nicht einen Mann wählen, den sie nicht liebte!
Oder – würde die Liebe sich einstellen, bedurfte es dafür nur eines Entschlusses? Dann hätte sie ja doch die Möglichkeit, den Antrag des Hauptmanns anzunehmen …
Was eigentlich sollte an dem ihr unbekannten Ibsen-Stück, das da eben auf der Bühne begann, für den Hauptmann so irritierend sein?
Wenn sie wenigstens noch mit Frau Doktor Schneider ein unverfängliches Gespräch unter vier Augen über dieses Stück hätte führen können und dabei vielleicht einen Hinweis erhalten hätte! Aber dazu hatte sich keine Gelegenheit ergeben, von Anfang an war der Hauptmann dabei gewesen.
Die der Etikette geschuldete Anwesenheit der Hausarztgattin war ihr auch sonst keine Hilfe. Mit Frau Doktor Schneider verband sie nur ein geselliger Kontakt der Familien. Doch eine wirkliche Freundin, mit der sie ohne Scheu ihre Zweifel hätte teilen und die ihr jetzt hätte beistehen können, hatte sie nicht. Nun saß sie zwischen Frau Doktor Schneider und dem Hauptmann in der vordersten Reihe des Balkons im ersten Rang – einen auffälligeren Platz hätte er kaum mieten können – und nahm nur am Rande wahr, was da auf der Bühne gespielt wurde. Immer wieder verloren ihre Gedanken den Zusammenhang mit dem Theaterstück, das sie ohnehin nicht berührte. Diese Nora erschien ihr als flatterhafte oberflächliche Person, deren Belanglosigkeit ihr nachgerade auf die Nerven ging. Was sollte sie tun, wenn der Hauptmann nach der Vorstellung noch eine Aussprache mit ihr anstrebte?
»Was für eine entzückende, liebreizende Frau, diese Nora«, nahm der Hauptmann in der Pause nach dem ersten Akt pflichtschuldig das Gespräch über das Stück auf, »ein wahrer Sonnenschein.« Dann beeilte er sich hinzuzufügen: »Ich meine natürlich die Rolle, nicht die Schauspielerin. Aber diese Nora: So eine kleine Lerche, wie Helmer sie nennt, ein lockerer Zeisig, so ein kindlich schutzbedürftiges und zugleich kapriziöses, verschwenderisches Wesen – einfach hinreißend. Kein Wunder, dass Torvald Helmer sie anbetet.«
Ist es das, was er in seiner künftigen Frau sucht, dachte Margarethe, ein kindlich schutzbedürftiges, kapriziöses Wesen? Eine trällernde Lerche, einen entzückenden Sonnenschein? Ich könnte ihm den vorgaukeln, zweifellos. Aber – will ich das?
»Anbetet?«, warf Frau Doktor Schneider ein. »Gewiss, das auch. Aber zugleich stellt er sich doch sehr über sie. Im Übrigen hat Nora durchaus noch einen tieferen Wesenszug. Diese angedeutete Geschichte, wie sie ihrem Mann einst das Leben rettete, ohne dass er es überhaupt merkte – ich meine, das offenbart eine ganz andere Nora. Und von wegen verschwenderisch – das macht sie doch nur ihrem Gatten vor! In Wahrheit vollbringt sie im Stillen ein Wunder an Selbstbeschränkung. Wie schwer muss es für sie sein, unbemerkt das Geld zusammenzusparen, sogar heimlich Schreibarbeiten zu übernehmen, um die Schulden abzutragen, die sie nur aus Liebe zu ihm gemacht hat! Tragisch, dass sie ihm davon nichts sagt.«
»Tragisch? Ganz und gar nicht!«, widersprach der Hauptmann so engagiert, als wolle er unter Beweis stellen, dass auch er sich für literarische Fragen zu interessieren vermochte. »Sie hat eben ein feines Empfinden. Welcher Mann könnte es ertragen, von seiner Frau gerettet worden zu sein? Im Gegenteil, ich finde diesen frommen Betrug sehr klug von ihr: Sie weiß, wie sie sich die Liebe ihres Mannes erhält und wie sie ihn an sich fesselt. Das ist eben die Klugheit der Frauen. Was meinen Sie, Baronesse?«
Ein Aufruhr war in Margarethe, den sie kaum zu beherrschen wusste. Sie hatte das Gefühl, mit dieser Antwort über ihr ganzes Leben zu entscheiden. »Ich bin gespannt auf den Fortgang der Handlung«, erwiderte sie ausweichend. Sie lächelte ihm zu und wusste, dass Dutzende Operngläser dieses Lächeln vergrößerten, Dutzende Damen der Gesellschaft es registrierten. Morgen würde man sich erzählen, zwischen Baronesse von Zug und Hauptmann von Klaasen scheine sich nun endlich eine Entscheidung anzubahnen. Welcher Teufel hatte sie eigentlich geritten, sich mit ihm dieser Öffentlichkeit auszusetzen?
Mit gespielter Aufmerksamkeit wandte sie sich der Bühne zu. Doch dann begann die Dramatik des Stückes sie wider Willen in Bann zu ziehen und die eigenen Gedanken in den Hintergrund zu drängen. Im dritten Akt schließlich folgte sie der Handlung mit atemloser Spannung. Mehr und mehr spürte sie, dass dort auf der Bühne ihre Zukunft verhandelt wurde. Wie Nora die Augen aufgingen über den wahren Charakter ihres Mannes – über den wahren Charakter ihrer Ehe – vor allem aber über sich selbst und das Scheinleben, das sie bisher geführt hatte …
Diese Sätze im Dialog zwischen Nora und ihrem Mann:
Sie: Unser Heim ist nichts anderes als eine Spielstube gewesen. Hier bin ich deine Puppenfrau gewesen, wie ich zu Hause Papas Puppenkind war – Ich muss danach trachten, mich selbst zu erziehen. Und darum verlasse ich dich jetzt …
Er: So entziehst du dich deinen heiligsten Pflichten? – Pflichten gegen deinen Mann und deine Kinder …
Sie: Ich habe andere Pflichten, die ebenso heilig sind – die Pflichten gegen mich selbst – Ich liebe dich nicht mehr – das ist der Grund, warum ich nicht länger hier bleiben will …
Er: Werde ich dir niemals wieder mehr als ein Fremder sein können?
Sie: Dann müsste mit uns beiden, mit dir und mir, eine solche Wandlung vorgehen, dass … Ach, Torvald, ich glaube an keine Wunder mehr …
Er: Sprich zu Ende. Eine solche Wandlung, dass …?
Sie: dass unser Zusammenleben eine Ehe werden könnte. Leb wohl!
»Das würde ich nie übers Herz bringen«, sagte Frau Doktor Schneider mit Tränen in den Augen, als der Vorhang fiel, »meine Kinder zu verlassen. Das brächte doch keine Mutter über sich!«
Hauptmann von Klaasen nickte und stimmte zu: »Dieses Ende ist unerträglich! Im Programm steht, dass an manchen Schauspielhäusern Nora mit einem anderen Schluss gegeben wird. Es ist ein Skandal, dass man sich bei dieser Inszenierung nicht auch dazu entschlossen hat. Nicht wahr, Baronesse?«
»Nein«, widersprach sie und räusperte sich, kaum fand sie ihre Stimme, »genau so muss es sein.«