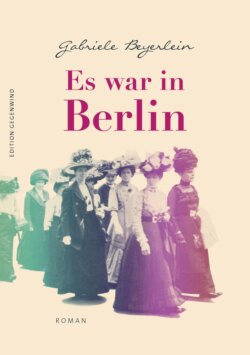Читать книгу Es war in Berlin - Gabriele Beyerlein - Страница 5
3
ОглавлениеEin Geräusch ließ sie aufschrecken. Sofort schnellte ihr Puls in die Höhe. Clara lauschte.
Lisas Atem ging ruhig und gleichmäßig. In dem schmalen Küchenbett dicht an sie geschmiegt lag die Schwester in tiefem Schlaf, ungetrübt von Angst und Schuldgefühl. Sie selbst aber …
Da war es wieder. Schwere Schritte im Treppenhaus. Stürmte dort etwa die Polizei die Treppe herauf, würde gleich die Küchentür aufreißen und brüllen: »Alle an die Wand!«, und dann mit der Durchsuchung beginnen, das Unterste zuoberst kehren?
Wenn sie darauf kamen, die Dielen zu überprüfen!
Als gutes Versteck war es ihr erschienen, die Hefte unter dem losen Bodenbrett zu verstecken. Schließlich stand ihr Bett darüber, und kein Mensch konnte merken, dass das Brett sich herausnehmen ließ, oder? Sie hatte es selbst ja erst kurz vor Weihnachten entdeckt, als sie für die Festtage den Küchenboden hatte scheuern müssen, wie es daheim im Dorf Brauch gewesen war. Und sie hatte ein mit Ruß beschmiertes vielfach gefaltetes Papierstückchen in den Spalt neben der losen Diele geklemmt, sodass sie nicht mehr wackelte, und dieses winzige schwarze Schnipsel war doch beim besten Willen nicht von dem Dreck zu unterscheiden, der allenthalben in den Spalten zwischen den Dielen klebte!
Aber wenn die Polizisten das Bett zur Seite schoben und mit dem Messer in jeden Spalt fuhren und jedes Brett darauf prüften, ob es auch fest saß? Bei Gerda hatten sie sogar den Schuhputzkasten ausgeleert und die Puppenstube der kleinen Töchter auseinandergenommen, hatte Jenny erzählt.
Das Poltern kam näher. Genau auf ihre Tür zu.
Clara grub die Fingernägel in die Handballen, dass es schmerzte. Hätte sie sich nur nie darauf eingelassen, diese verfluchten Hefte zu verstecken! Was für Vorwürfe würde sie von den Eltern bekommen! Und recht hätten sie, niemals hätte sie die ganze Familie in so eine Gefahr bringen dürfen, vielleicht hatte jemand Gerda gesehen, als sie in der Nacht in Jennys Wohnung gekommen war, und beobachtet, dass sie, Clara, kurz darauf diese Wohnung verlassen hatte, und da lag doch der Schluss nahe …
Sie würden alle im Gefängnis enden.
Die Schritte stockten vor ihrer Tür. Clara hielt den Atem an. Dann wurde die Tür aufgerissen. Im schwachen Schein des in die Küche fallenden Mondlichts erkannte Clara undeutlich eine massige Gestalt, die in den Raum torkelte, gegen den Stuhl stieß und ein unflätiges Fluchen hören ließ.
Das konnte nicht die Polizei sein. Clara stieß die Luft aus. Ihr wurde schwach vor Erleichterung: Gerettet! Es war nur irgendein besoffener Nachbar in seinem Samstagabendrausch. Und es konnte zwar unangenehm werden, so einen Kerl wieder hinauszubugsieren, aber gegen die Polizei war das nichts.
Eben wollte sie aus dem Bett springen, um den Betrunkenen aus der Küche zu schieben, da schien dieser seinen Irrtum zu bemerken: Er drehte um, hielt sich einen Augenblick am Türrahmen fest und schwankte hinaus. Überraschend behutsam schloss er die Tür hinter sich. Erst als sie ihn nebenan die nächste Küchentür öffnen hörte, verstand sie, dass es Willy gewesen war, ihr unmittelbarer Nachbar, ein berüchtigter Trunkenbold.
Jette, seine Frau, hatte noch am Abend heulend bei ihnen in der Küche gesessen und geklagt: Er kommt schon wieder nicht heim! Ich kann ja nicht jeden Samstag vor dem Fabriktor stehen und ihm mein Haushaltsgeld abverlangen, ich hab ja nicht weggekonnt, die Arbeit wächst mir so schon über den Kopf, und außerdem fühlt er sich blamiert, wenn ich das mache, und letztes Mal hat er mich deswegen so zusammengeschlagen, als er heimgekommen ist, dass es wochenlang bei jedem Atemzug wehgetan hat und ich nicht mehr wusste, wie ich Luft holen sollte. Und jetzt sitzt er wieder in irgendeiner Destille und versäuft alles und kommt ohne einen Pfennig nach Hause. Und ich habe doch schon so viele Schulden beim Krämer, der schreibt mir nichts mehr an.
Vielleicht sitzt er ja beim Unterirdischen Paule, hatte die Mutter gemeint, da können wir ihn rausholen.
Aber Jette hatte heulend erklärt, nein, da sei er nicht, sie habe die Kinder schon nachschauen lassen. Ihr Jammern hatte in dem Satz gegipfelt: Wenn er sich doch wenigstens tot saufen würde, dann wäre ich ihn los.
Nebenan wurde es laut. Jette begann in den höchsten Tönen zu schreien und anzuklagen, Bruchstücke hörte Clara von bitteren Vorwürfen, dazwischen lallende Antworten von Willy, plötzlich ein wütendes Brüllen und ein paar schallende Ohrfeigen. Dann war Ruhe. Kurz darauf setzte ein grunzendes Schnarchen ein. Clara vergrub ihren Kopf im Kissen. Jette tat ihr leid. Und trotzdem: Warum konnte die ihren Mund nie halten, sie wusste doch, wie Willy im Suff war. Nüchtern war er ein ganz erträglicher Mensch.
Was für ein Glück, dass sich ihr eigener Vater selten so sinnlos betrank. Seit sie in Berlin wohnten, trug zwar auch er viel Geld in die Kneipe, aber wenigstens lieferte er jede Woche von den rund sechzehn, siebzehn Mark, die er verdiente, zehn für Haushalt und Miete bei der Mutter ab. Geschlagen hatte er die Mutter auch noch nie, sie konnte sich nicht erinnern, dergleichen je miterlebt zu haben. Und dass er sie selbst und ihre Geschwister für jedes kleinste Vergehen zu verprügeln pflegte, das war etwas anderes. Das taten Väter nun mal.
Doch, im Großen und Ganzen hatten sie es gut. Und auch wenn es mit dem Geld knapp war, mit dem zusammen, was sie und die Mutter verdienten, reichte es gerade und so hatten sie es nicht nötig, Betten an Schlafgänger zu vermieten: Sie konnten ihre Stube für sich allein behalten, in der die Eltern und die Brüder schliefen. Jette hatte ihre Stube ganz an Schlafgänger abgeben müssen, in drei Betten schliefen dort sechs junge Männer, für die Jette auch kochte und wusch und flickte, sonst reichte es nicht mit dem Geld. Wie die das alles überhaupt aushielt, zwei Kinder und die Schlafgänger und die Heimarbeit als Stepperin an der Nähmaschine und dann noch Prügel von ihrem Mann, das war unbegreiflich.
Woran erkannte man wohl rechtzeitig, ob ein Mann zur Gewalttätigkeit und zum Suff neigte? Jette hatte erzählt, früher, als sie sich in ihn verliebt hatte, sei ihr Willy ganz anders gewesen, eine Seele von einem Mann. Richtig glücklich sei sie mit Willy gewesen. Nur der Schnaps habe ihn so kaputtgemacht.
Lisa, die die ganze Aufregung verschlafen hatte, seufzte leise im Schlaf, drehte sich auf die Seite und kuschelte sich an sie. Clara lächelte und schlang den Arm um die Schwester. Lisas Haare kitzelten ihr in der Nase. Dennoch blieb sie so liegen. Es war schön, diese Nähe zu spüren. Wie es wohl wäre, eines Tages mit einem Mann im Bett zu liegen, einem Mann, der anders war als Willy? Auch anders als Franz. Der ging inzwischen fest mit Olga, die erzählte jeden Montag davon, was sie am Samstagabend und am Sonntag mit ihm erlebt hatte, und ließ nichts dabei aus, auch nicht, wo sie für ihn die Beine breit gemacht hatte und wie fest er hinlangte und wie oft er konnte und dass sie ganz wund sei. Wie anzüglich sie dabei lachte!
War die Liebe wirklich so – so roh und dreckig? Und ganz ohne Herz …
Nein, nicht an Franz und Olga denken! Auch nicht an Jette und Willy, nicht an die Hefte und die Polizei! Einfach an nichts. Sie döste wieder ein.
Irgendwann wurde sie ein zweites Mal von Geräuschen geweckt. Sie blinzelte. Die Mutter stand beim trüben Schein eines spärlich flackernden Talglichtes am Herd und hantierte. »Schon Zeit?«, murmelte Clara.
»Nein, schlaf weiter«, gab die Mutter halblaut zurück. »Ich mach nur einen Tee für den Vater, zum Glück ist das Wasser noch einigermaßen warm. Er hustet schon wieder wie ein Verrückter. Und Fieber hat er auch, unser Bett ist ganz nass geschwitzt. Wenn er nur am Montag wieder zu Arbeit kann!« Die Mutter seufzte sorgenvoll.
Schon wieder krank? Auch Clara seufzte. Der Vater war oft krank. Drei Wochen hatte er diesen Winter schon die Grippe gehabt und das Bett hüten müssen. Und in der ersten Woche gab es doch kein Krankengeld, und ab der zweiten dann auch nur die Hälfte vom Lohn – und sein Bier trank er ja trotzdem. An den Schulden, die sie in der Zeit gemacht hatten, zahlten sie immer noch ab. Wenn nun der Vater schon wieder nichts verdiente!
Am Ende kam die Mutter noch auf die Idee, sich Claras Erspartes aushändigen zu lassen?
»Was ist?«, fragte Lisa schlaftrunken und wollte sich aufrichten. Clara drückte die Schwester in die Kissen zurück. »Nichts. Schlaf weiter!« Aber sie selbst konnte nicht wieder einschlafen, auch als die Mutter längst gegangen war. Da lag sie nun am einzigen Tag in der Woche, an dem sie hätte ausschlafen können, wach und wartete darauf, dass es endlich Zeit würde aufzustehen.
Bald kam der Frühling. Im Winter musste sie den Weg im Dunkeln zurücklegen, sodass man meinte, es sei noch tiefste Nacht. Jetzt graute schon der Morgen.
Clara hastete. Die kalte Luft biss ihr in der Brust. Sie war viel zu spät von zu Hause weggekommen, die Mutter, ermüdet von einer durch das Husten und die Fieberträume des Vaters gestörten Nacht, hatte verschlafen und einen eigenen Wecker besaß Clara nicht. Nun lief sie gegen die Zeit an, beinahe rannte sie und wusste doch, dass es fast unmöglich war, noch rechtzeitig vor Torschluss die Fabrik zu erreichen. Hätte sie doch Geld, fünf Pfennige, damit sie die Straßenbahn nehmen könnte! Aber sie hatte nicht einen einzigen Pfennig einstecken. Ihr blieb nichts, als zu rennen, so schnell sie konnte. Wenn sie auch nur eine Minute zu spät kam, musste sie am Klingelzug läuten, um noch eingelassen zu werden, und dreißig Pfennige Lohnabzug wären ihr sicher.
Es wäre die Katastrophe – nun, da der Vater doch wieder krank war und im Bett bleiben musste. Bestimmt würde es Wochen dauern, bis er wieder auf die Beine kam. Wenn der Vater erst einmal krank war, erholte er sich schwer mit seiner angegriffenen Lunge.
Sie würden wieder Schulden beim Krämer machen müssen und die Mutter würde ihr die eine Mark für sich nicht lassen und ein Kleid rückte in weite Ferne. Sie wünschte sich doch so sehr ein neues Kleid, ein richtiges Sommerkleid, eines, mit dem sie zum Tanzen gehen konnte! Wenn sie schon nicht zum Tanzen in eine Wirtschaft durfte, so könnte Jenny sie doch wenigstens zum Tanzabend im Arbeiterverein mitnehmen. Und dagegen konnte doch nicht einmal der Vater etwas haben?
Aber ohne Kleid ging das nicht…
Sie rannte. Von der Garnisonskirche schlug es sechs. Alle Hetze und Anstrengung vergebens. Nach Luft ringend blieb Clara stehen und drückte sich die Hand in den vor Seitenstechen schmerzenden Leib. Jetzt war schon alles gleich – ob sie acht Minuten zu spät kam oder zehn, das machte keinen Unterschied mehr. Bis zu fünfzehn Minuten Verspätung war die gleiche Strafe angesetzt. Sie taumelte erschöpft gegen eine Hauswand, schloss kurz die Augen.
Langsam beruhigte sich ihr Atem, ließ das Stechen in ihrer Seite nach. Weiter. Sie öffnete die Augen. Da fiel ihr Blick auf den Zettel, der an der Toreinfahrt angebracht war: Druckerei Bruchmüller. Wir stellen ein Mädchen/eine Frau als Auflegerin ein. Arbeitszeit 10 Stunden täglich. Wochenlohn 9,50 Mark. Einstellung sofort.
Neun Mark fünfzig. Eine Mark und fünfzig mehr als sie zuletzt in der Spinnerei bekommen hatte, bevor die Kurzarbeit anfing. Und das für eine Stunde weniger Arbeitszeit! Dass die Drucker gut verdienten, wusste sie, in ihrem Haus wohnte einer, der konnte sich mehr leisten als jeder andere Arbeiter. Aber auch die Frauen! Was war eigentlich eine Auflegerin?
Neun Mark fünfzig. Letzte Woche hatte sie durch die Kurzarbeit mit den Abzügen und Strafgeldern mal gerade vier Mark sechsundvierzig verdient. Und diese Woche begann gleich mit dreißig Pfennigen Strafe. Vielleicht bekam sie am Wochenende nicht mehr als vier Mark heraus …
Sie starrte den Zettel an. Hoch und hart schlug ihr Herz. Sollte sie es wagen?
Was man als Auflegerin wohl machen musste? Schwerer als die Arbeit an einer Spinnmaschine konnte es doch auch nicht sein, oder?
Neun Mark fünfzig.
Sie presste die kalten Fäuste gegen das Gesicht. Wahrscheinlich war der Zettel alt und die Stelle längst vergeben. Aber er sah aus wie frisch geschrieben. Wenigstens kurz fragen, ob die Stelle noch frei war? Wenn sie sich beeilte, konnte sie trotzdem noch fünfzehn nach sechs in der Spinnerei sein …
Sie lief durch die Hauseinfahrt, kam in einen Hinterhof, sah das Schild über einer der beiden Türen zum Hinterhaus: Druckerei Bruchmüller. Warum brannte kein Licht, drang kein Laut heraus? Sie rüttelte an der Tür. Verschlossen.
»Die machen erst um sieben auf!«, rief ihr eine Stimme zu. Sie wandte sich um: Eine gebrechliche alte Frau, die sich ein graues Wolltuch über ihr Hemd geschlungen hatte, verließ eben die baufälligen Abortanlagen.
»Ich, ich wollte nur fragen, ob die Stelle noch frei ist«, stammelte Clara.
»Kontor ist vorne«, war die Antwort, damit verschwand die Frau durch die zweite Tür ins Hinterhaus.
In der Toreinfahrt war es dunkel, Clara konnte die Schilder nicht lesen, die dort an der Wand angebracht waren. Zwei Zugänge gab es ins Vorderhaus, einen rechts und einen links. Ratlos stand Clara vor der Tafel. Wenn hier nur jemand wäre, den sie fragen könnte! Sie hatte keine Zeit zu verlieren, sie müsste längst weiter. Da kam ein Bäckerjunge mit einem Leinensack voller Brötchen und strebte das rechte Treppenhaus an. »Wo ist das Kontor der Druckerei Bruchmüller?«, sprach sie ihn an.
»Unten links!«
Vier Stufen führten zu einem ersten Absatz im linken Treppenhaus hinauf. Eine Tür mit Klingelzug. Sie läutete. Wartete. Läutete. Wartete.
Sie hatte es ja geahnt, diese Stelle war nichts für sie. Nichts wie weg hier, zu ihrer Spinnerei! Da wusste sie wenigstens, dass sie Arbeit hatte, wenn auch nur Kurzarbeit und schlecht bezahlt.
Sie machte kehrt, rannte die Stufen hinunter, rannte aus der Einfahrt, stieß mit einem Straßenkehrer zusammen, beinahe wäre sie gestürzt. Als sie in die Straße zur Spinnerei einbog, schlug es von der Nikolaikirche Viertel.
Tränen schossen ihr in die Augen. Nun hatte sie zu allem Übel auch noch die fünfzehn Minuten überschritten! Wie hoch der Abzug war, der ihr jetzt drohte, wusste sie überhaupt nicht, das war ihr noch nie vorgekommen in den mehr als drei Jahren, die sie hier gearbeitet hatte. Vielleicht wurde ihr sogar gekündigt?
Auf Einlegung eines blauen Montags stand die fristlose Entlassung, das hatte sie schon einmal miterlebt: Einer der Arbeiter, der erst am Dienstag wieder zur Arbeit erschienen war, hatte gleich wieder umkehren müssen. Und jetzt, wo sowieso Kurzarbeit war! Vielleicht wartete der Fabrikdirektor ja nur darauf, Arbeiterinnen zu entlassen.
Aber sie hatte sich doch nie etwas Schlimmes zuschulden kommen lassen und war fast immer pünktlich gewesen und hatte sich hochgearbeitet von sechs Mark auf acht …
Aber was zählte das schon. Ein Federstrich und sie war rausgeschmissen.
Und wenn sie sagte, dass sie krank war? Aber wenn sie dann zum Arzt geschickt wurde?
Sie konnte nicht am Abend nach Hause kommen und der Mutter sagen, dass sie ihre Arbeit verloren hatte. Das konnte sie nicht. Jetzt, wo der Vater krank war.
Mit schweren Schritten schleppte sie sich zum Tor der Spinnerei, legte sich Entschuldigungen zurecht, verwarf sie wieder. Sie griff nach dem Klingelzug. Zögerte. Nahm die Hand wieder zurück.
Dann drehte sie sich entschlossen um. Sie würde es doch in der Druckerei versuchen.
Sie hatte nicht geahnt, dass es so anstrengend sein würde. Ganz leicht hatte es ausgesehen: Einfach nur auf der Fußbank neben der Stopp-Zylinder-Schnellpresse stehen, den obersten der großen Papierbögen vom Stapel nehmen und genau richtig in die Zufuhr der Maschine legen und dann gleich den nächsten und den nächsten und den nächsten. Das war alles.
Die ersten Stunden hatte sie ihr Glück kaum fassen können: Sie hatte die Stelle wirklich bekommen! Sie war gerettet! Und die Mutter würde selig sein, dass sie mehr Geld nach Hause brachte, nun, wo es so dringend nötig war.
Der Privatbeamte hatte nicht viele Worte gemacht und nicht viele Fragen gestellt, hatte sich ihre Adresse aufgeschrieben und ihr befohlen, am nächsten Tag ihre Papiere vorzulegen, hatte ihr die Fabrikordnung ausgehändigt und sie in die Druckerei geleitet, in der rechts und links von einem Hauptgang je sechs Schnellpressen standen, die mit Transmissionsriemen von zwei Wellen unter der Decke angetrieben wurden. Wie im Paradies war es ihr da erschienen: nicht so laut wie in der Spinnerei und vor allem nicht so schwülheiß und nicht der Gestank, der dort herrschte, und der Staub von den herumfliegenden Fasern, sondern nur der Geruch nach Druckerschwärze, der ihr gefiel. Und nicht mehr auf all diese wirbelnden Spulen starren müssen und vor der Maschine hin und her rennen, sondern einfach nur ruhig dastehen und immer den gleichen leichten Handgriff machen: Papier aufheben, einführen, aufheben, einführen – ein Kinderspiel.
Nein, sie hatte nicht geahnt, wie anstrengend es sein würde und wie sehr sie sich nach ein paar Stunden danach sehnen würde, wieder vor ihrer Spinnmaschine herumlaufen zu dürfen. Die Beine waren von Stunde zu Stunde schwerer geworden. Schließlich hatte sie begonnen, von einem Fuß auf den anderen zu treten, weil sie das Stillstehen nicht länger ertragen hatte. Und immer dieselbe Bewegung in ewig gleichbleibendem Rhythmus!
Jede knappe Sekunde einen neuen Papierbogen exakt in die Zufuhr einlegen, siebzig in der Minute, vierhundertundzwanzig in der Stunde. Keinen Augenblick konnte man aussetzen, kein einziges Mal die halb erhobenen Arme aufstützen, nicht einmal ein wenig schneller machen, um dann wieder die Zeit zu haben, tief durchzuatmen oder sich die Haare aus der Stirn zu streichen, denn das Tempo gab die Druckmaschine vor. Der Drucker hatte ihr gleich als Erstes erklärt: Wenn der Papierbogen nicht richtig eingelegt war, sobald sich der Zylinder über dem Satz drehte, dann würde der Aufzug auf dem Zylinder eingeschwärzt und die Maschine müsste angehalten werden, der Zylinder neu aufgezogen und alles neu eingerichtet werden, und das war ein Zeitverlust und ein Schaden, der ihr vom Lohn einbehalten würde.
Nur wenn ein Druckvorgang abgeschlossen war und der Drucker den Satz auswechselte, Farbe nachfüllte, den Zylinder mit einem neuen Aufzug versah und den Probedruck begutachtete, hatte sie eine Verschnaufpause und konnte wenigstens auch einmal das Klosett aufsuchen.
An den größeren Maschinen auf der anderen Seite des Ganges, die etwa doppelt so schnell liefen, arbeiteten zwei Auflegerinnen gleichzeitig, die eine von rechts und die andere von links, die konnten sich einmal gegenseitig aushelfen, doch Clara stand allein an ihrer Schnellpresse, nur Erna saß noch dahinter und nahm die fertigen Bögen in Empfang. Claras Schultern taten weh, der Hals fühlte sich steif an und die Finger schienen ihr vom vielen Papieranfassen so ausgetrocknet, dass sie kaum mehr etwas anderes denken konnte, als dass sie sie unbedingt mit Schweineschmalz einreiben wollte.
Trotzdem. Neun Mark fünfzig in der Woche. Stolz war sie auf sich, dass sie diesen Sprung gewagt hatte, ganz allein. Sehr stolz. Und das andere, das würde sich geben, sie würde sich daran gewöhnen, schließlich wusste sie noch genau, wie völlig unerträglich ihr die Arbeit am Selfaktor anfangs erschienen war – und hatte sie es nicht doch ertragen?
Hoffentlich würde der Vater gutheißen, dass sie den Arbeitsplatz gewechselt hatte. Der Vater war so altmodisch. In seinem Kopf war immer noch Schlesien und nicht Berlin. Wo man von Gott hingestellt ist, da bleibt man, pflegte er zu sagen. Und als sie einmal erwidert hatte: Dann hättest du daheim an deinem Webstuhl bleiben müssen, da hatte sie sich eine kräftige Ohrfeige von ihm eingefangen.
Wenn er sich bloß nicht aufregte und ihr Vorwürfe machte, weil sie ihn nicht um Erlaubnis gefragt hatte! Er wollte doch immer derjenige sein, der sagte, wo's langging. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst … Manchmal, wenn der Vater in Rage geriet, konnte einem himmelangst vor ihm werden.
Aber was hätte sie denn tun sollen? Nach Hause rennen und erst den Vater fragen? Dann wäre die Stelle womöglich an ein anderes Mädchen vergeben worden, ehe sie wieder bei der Druckerei gewesen wäre. Außerdem war der Vater viel zu krank, um ihr gefährlich werden zu können. Er hatte Fieber und lag im Bett und hustete und am besten sagte man ihm vorerst einmal gar nichts davon. Damit er nicht vor lauter Aufregung noch kränker würde.
Entschlossen schob sie diese Gedanken beiseite. Lieber sich an das Gedicht erinnern, das sie in der Mittagspause gelesen hatte. Die Mittagspause, die war gut gewesen. Neben dem Maschinensaal und der Setzerei gab es eigens einen Raum mit einem Ofen und mit Tischen, an denen man auf richtigen Stühlen sitzen durfte, und mit Garderobenhaken an der Wand und sogar einem Wasserhahn über einem Ausguss, an dem man sich die Hände waschen konnte.
Ein anderer Ton herrschte hier als im Keller der Spinnerei, man merkte eben gleich, dass die Drucker etwas Besseres waren und sich mit geistigen Dingen beschäftigten. Auch unter den Mädchen gab es einige, die in der Pause lasen. Sie brachten sich die Ausschussbögen mit fehlerhaften Drucken mit an den Tisch und studierten sie beim Essen. Erna, ein sympathisches Mädchen etwa in ihrem Alter, die an der gleichen Maschine arbeitete wie Clara – sie musste die bedruckten Papierbögen auf den Stapel schichten, wenn sie an Fäden aus der Maschine herausgeführt wurden, und über jeden gedruckten Bogen ein Löschpapier legen – hatte ihr in der Pause einen der Bögen hingeschoben und auf ein Gedicht gewiesen: Hier, schau, das ist aus einer Literaturzeitschrift, die wir drucken, ist das nicht gut?
Clara hatte noch niemals Gedichte gelesen, kannte nur die Gesangbuchverse und die schwülstigen Strophen, die sie in der Schule auswendig gelernt und nie verstanden hatte. Gedichte, hatte sie immer gedacht, das ist nur was für die besseren Leute. Doch dann diese Zeilen, auf die Erna mit dem Finger gezeigt hatte:
Ihr Dach stieß fast bis an die Sterne,
vom Hof her stampfte die Fabrik,
es war die richt' ge Mietskaserne
mit Flur- und Leiermannsmusik!
Im Keller nistete die Ratte,
parterre gabs Branntwein, Grog und Bier,
und bis ins fünfte Stockwerk hatte
das Vorstadtelend sein Quartier …
Sie hatte nicht gewusst, dass es solche Gedichte gab. Solche Worte, die von dem erzählten, was sie kannte, und die es doch weit über alles hinaushoben, was sie kannte:
Dort saß er nachts vor seinem Lichte
– duck nieder, nieder, wilder Hohn! –
und fieberte und schrieb Gedichte,
ein Träumer, ein verlorner Sohn!
Sein Stübchen konnte grade fassen
ein Tischchen und ein schmales Bett;
er war so arm und so verlassen,
wie jener Gott aus Nazareth!
Sie hatte die Verse auswendig gelernt, sie, für die das Auswendiglernen in der Schule immer nur eine mehr als lästige Pflicht gewesen war, hatte ihre Mittagspause darauf verwandt, ein Gedicht zu lernen! Nun versuchte sie es beim Nachhausegehen wieder aufzusagen, die dritte Strophe fiel ihr nicht ein, sie hatte sie auch nicht so richtig verstanden, doch die vierte wusste sie wieder:
In Fetzen hing ihm seine Bluse, sein Nachbar lieh ihm trocknes Brot, er aber stammelte: O Muse! und wusste nichts von seiner Not. Er saß nur still vor seinem Lichte, allnächtlich, wenn der Tag entflohn, und fieberte und schrieb Gedichte, ein Träumer, ein verlorner Sohn!
»Ein Träumer, ein verlorner Sohn«, flüsterte sie vor sich hin. Die Geschichte vom verlorenen Sohn kannte sie, im Religionsunterricht hatten sie sie lernen müssen: Der verlorene Sohn war aus reichem Haus und hatte sich sein Erbe auszahlen lassen, aber er hatte alles Geld durchgebracht und nun musste er Schweinefutter essen.
Ob auch dieser Dichter eigentlich aus reichem Haus war? Gebildet bestimmt, sonst könnte er ja nicht dichten. Aber trotzdem lebte er in Not und hatte eine zerrissene Bluse und wohnte in einer winzigen Kammer und konnte sich nicht einmal trockenes Brot kaufen. Und war glücklich bei alldem, weil er etwas Höheres hatte, wofür es sich zu leben lohnte.
Eine unbestimmte Sehnsucht erfasste sie. Hätte sie nur auch so etwas, was sie über das graue Einerlei hinausheben würde, sodass sie es gar nicht mehr spüren würde!
Sicher, da war der Wunsch nach einem Kleid und einem Tanzvergnügen. Aber sie spürte wohl, dass das nicht das Gleiche war wie das, wovon der Dichter dieser Verse sprach.
Johann Nietnagel hieß er. Sein Name hatte unter dem Gedicht gestanden. Er schreibe öfter für die Literaturzeitschrift, hatte Erna gesagt, aber sonst wusste auch Erna nichts über ihn.
Clara seufzte. Fast war ihr der Weg nach Hause zu kurz. Sie hätte gern noch ein paar Minuten gehabt, um an das Gedicht zu denken. Gleich würde sie der Mutter erklären müssen, warum sie später nach Hause kam als von ihrer Kurzarbeit, und wenn sie Pech hatte, erfuhr gar der Vater davon, dass sie die Fabrik gewechselt hatte.
Sie erreichte die Straße, in der sie wohnte, sah von Weitem ihren Häuserblock. Eine Frau mit Wäschekorb unter dem Arm stieg eben die Treppe zum Krämerladen hinunter, der im Keller des Vorderhauses ihrer Mietskaserne eingerichtet war, ein kleiner Junge lief hinter ihr her. Waren das nicht Jenny und Moritz? Ein paar Worte mit Jenny reden, das wäre gut.
Clara ging schneller, eilte in den Laden hinunter. Vor der Theke stand ein altes Dienstmädchen und kaufte ein. Hinten aber im Winkel des Kellers drehte Jenny die Wäschemangel. Stine lag auf dem Stapel ungebügelter Wäsche und schlief.
»Clara, schau her, was ich hab! Das hat mein Papa mir gemacht!« Moritz rannte ihr entgegen und zeigte ihr das grob geschnitzte kleine Holzpferd, das er in der Hand hielt.
»Wie schön!« Sie strich dem Jungen durch die Haare. »So ein schönes Pferdchen.« Ihr Vater hatte ihr nie irgendein Spielzeug geschnitzt.
»Stell dir vor, Jenny, ich hab die Fabrik gewechselt«, platzte sie dann heraus. Während sie der Freundin Laken und Handtücher zureichte, erzählte sie, was sie an diesem Tag erlebt hatte.
Wie erleichtert war sie, als Jenny sagte: »Das hast du gut gemacht!«
»Meinst du?«, fragte sie, um es noch einmal zu hören.
»Natürlich«, bestätigte die Ältere. »Was du in der Spinnerei verdient hast, war sowieso nur ein Schandlohn, und höher, als du warst, hättest du da auch nicht mehr kommen können. Nur die Männer können aufsteigen in die besseren Positionen, die Frauen bleiben ja doch immer bei den Hilfsarbeiten, ganz gleich, wie geschickt und tüchtig sie sind. Und dann auch noch Kurzarbeit und die ganzen Strafgelder! Gut so, dass du gegangen bist, das ist das einzige Recht und Mittel, das wir Arbeiterinnen haben: die Fabrik zu wechseln, wenn es uns zu bunt wird. Wenn deinem Fabrikherrn alle Arbeiterinnen wegbleiben würden, ja, dann würde er sich umschauen, aber bis die Frauen so viel Solidarität lernen, da fließt noch viel Wasser die Spree hinab.«
»Wie du das alles weißt«, meinte Clara bewundernd.
Die Freundin lachte. »Ich geh ja auch zu Versammlungen und in die Arbeiterinnenschule und ich les den Vorwärts und die Gleichheit und die Agitationsschriften für Frauen!«
»Und ich hab heut ein Gedicht gelesen«, erwiderte Clara. »Sogar auswendig gelernt. Ein Gedicht von Johann Nietnagel.« Sie sprach den Namen mit Andacht.
»Johann Nietnagel?«, wiederholte Jenny lebhaft. »Den kenn ich! Der wohnt ja bei mir im Haus.«
»Was? Wie? Das …« Clara kam ins Stottern. Ein richtiger Dichter bei ihnen in der Mietskaserne. Und nicht irgendeiner, sondern der Dichter dieses Gedichtes …
»Drei Stock über mir, unterm Dach«, erklärte Jenny nüchtern. »Im Winter erfriert er dort halb und im Sommer schmilzt er. Aber was will er machen, für mehr reicht sein Geld nicht und ein Zimmer mit anderen teilen, wie sollte er da dichten? Im Übrigen ist er ein guter Genosse, inzwischen. Ich kenn ihn noch aus der Zeit vom Sozialistengesetz. Manchmal putz ich ihm sein Zimmer, wenn's dort allzu arg aussieht, oder wasch was von ihm mit, wenn ich große Wäsche hab, und stopf es auch gleich, aus Freundschaft und alter Dankbarkeit sozusagen. Er hat mir mal aus der Patsche geholfen, als ich beinah erwischt worden wär beim Austeilen vom Sozialdemokrat, das vergess ich ihm nie. Damals war er noch ein besserer Herr, ein feiner Student. Jetzt ist er Sozi und macht Gedichte und schreibt für den Vorwärts. Aber viel Geld kriegt er dafür nicht, und deshalb verdient er sich auch noch manchmal was mit Adressenschreiben. Und von dem habt ihr ein Gedicht gedruckt?«
Clara nickte. Sie setzte zu einer Antwort an, verschluckte sich vor Aufregung. Kannst du ihn mir einmal zeigen?, wollte sie fragen und traute sich nicht. Wenn er das dann merkte, was sollte er von ihr denken! Und überhaupt, ein Dichter, was wüsste der schon mit ihr anzufangen.
Vorne im Laden wurde es laut. Eine klagende Stimme erhob sich: »Was soll ich denn machen, ich brauch doch Petroleum, ohne Licht kann ich ja keine Tüten mehr kleben! Und Sie bekommen alles zurück, ich zahl alles, ich schwör es Ihnen. Sobald ich erst meine Nähmaschine hab!«
Clara stupste Jenny an und flüsterte mit einer Kopfbewegung zur Theke: »Anna Brettschneider!«
»Nähmaschine, Nähmaschine! Ich kann's nicht mehr hören!«, erwiderte Frau Molle, die Krämerin, barsch. »Das sagst du jetzt seit Wochen. Anschreiben, wenn man weiß, man bekommt sein Geld wieder, das lass ich mir gefallen. Aber bei dir – woher soll ich wissen, dass du die Nähmaschine überhaupt bekommst?«
»Die Dame hat es mir versprochen, sie hat es mir hoch und heilig zugesagt«, jammerte Anna. »Und so eine feine Dame, die hält doch ihr Wort! Nur warten muss ich eben und nicht den Glauben verlieren. Denn an ein Wunder, an ein Wunder muss man doch glauben, sonst meint der Herrgott, man ist es nicht wert. Und bis dahin – bitte, seien Sie so gut, geben Sie mir das Petroleum, ich hab Ihnen doch meine Schulden bezahlt von dem Geld, das das gnädige Fräulein mir gegeben hat …«
»Nicht alles«, kam die unwirsche Antwort. »Vier Mark bist du schuldig geblieben, und jetzt sind es schon wieder sieben. Ich weiß doch, wie das geht. Riefke setzt dich auf die Straße und weg bist du mit deinen Gören und ich bleib sitzen auf meinen Auslagen. Geh doch zur Stadtmission! Bei mir gibt es nichts mehr.«
Anna rang die Hände. Da sagte Jenny laut: »Schreib es bei mir an, Molle! Ich bürg für die Frau. Und jetzt gib ihr endlich ihr Petroleum, damit sie zurück kann an ihre Arbeit!«
Anna fuhr herum und starrte Jenny an. »Vergelt's Gott!«, flüsterte sie heiser.
»Na, darauf kann ich verzichten!«, erwiderte Jenny. »Wenn du nachher zu mir kommst, geb ich dir einen Kohlkopf aus meinem Garten. Man muss sich doch beistehen aus weiblicher Solidarität unter Proletarierinnen. Auf die ist besser zu setzen als auf deinen Wunderglauben und auf deinen Herrgott – und allemal besser als auf gnädige Fräuleins!«
Sie schaute diese feine Dame da im hohen Spiegel an und konnte es nicht fassen. War das wirklich sie? So schön!
Clara drehte und wendete sich vor dem Spiegel in dem Geschäft für abgelegte Herrschaftskleidung. Unglaublich. Was für ein Kleid. Und was für eine Figur.
Zum ersten Mal in ihrem Leben trug sie ein Korsett. Unbequem war es, das Ladenfräulein hatte ihr die Schnüre hinten fest angezogen, es presste ihr die Taille zusammen und drückte ihr den Atem ab. Aber wie es aussah und wie es den Busen anhob und zur Geltung brachte …
Wie sie aussah.
Sogar gewaschen hatte sie sich nach Arbeitsschluss, als alle Arbeiter schon gegangen waren – vorsichtshalber hatte Erna an der Tür zum Saal Wache gehalten, falls doch noch jemand hereinwollte –, und sich den Zopf neu geflochten. Schließlich hatte sie anständig aussehen wollen, wenn sie in so ein vornehmes Geschäft ging, um sich endlich das ersehnte Kleid zu kaufen. Aber dass sie so gut aussehen würde, das hatte sie nicht geahnt.
Ein Traum von einem Kleid war es. Sie hatte sich doch kein schwarzes ausgesucht, wie sie erst gedacht hatte, sondern ein ganz helles aus leichtem Baumwollstoff mit kleinen grünen Tupfen und einem breiten grünen Gürtel aus Atlasseide und Puffärmeln, die oben ganz weit waren und an den Ellbogen ansaßen wie eine zweite Haut. Die breiten Schultern, die das machte, ließen ihre geschnürte Taille noch schmaler erscheinen. Auch das dazugehörende dunkelgrüne Samtjackett hatte solche Puffärmel und ein breites doppeltes Revers. Samt – wie eine Prinzessin kam sie sich darin vor.
Und dieser unglaublich weite Rock mit seinen unzähligen feinen Falten und den drei Stufen übereinander: Wie der fliegen würde, wenn sie sich beim Tanzen drehte!
Morgen Abend würde Lisa auf Stine und Moritz aufpassen und sie selbst würde mit Jenny und Heinrich zum Tanz in den Frühling im Arbeiterverein gehen. Endlich.
Den Vater hatte sie nicht gefragt. Schließlich war der noch immer krank und hatte Fieber und durfte sich nicht aufregen. Sonst fing er wieder davon an, dass Berlin ein Sündenbabel sei, ein gottloser Höllenpfuhl, und dass sie noch als ledige Mutter enden würde, wenn sie sich so herumtriebe, aber dann würde er ihr die Seele aus dem Leib prügeln und ihr die Tür vor der Nase zuschlagen, das solle sie sich gesagt sein lassen – und redete sich so in Rage, dass er anfing zu husten und gar nicht mehr aufhörte.
Dabei brauchte der sich gar nicht so aufzuführen! Schließlich wusste sie, seit sie ihre Papiere in der Druckerei hatte vorzeigen müssen, dass sie nur vier Monate nach der Heirat der Eltern geboren war!
Aber dazu hatte sie lieber nichts gesagt und so getan, als würde sie es nicht merken, als die Mutter ihr die Geburtsurkunde herausgesucht hatte und sie dabei einen Blick auf die Heiratsurkunde der Eltern geworfen hatte. Wie der Vater darauf reagieren würde, wenn sie dazu etwas sagte, das konnte sie sich so ungefähr vorstellen.
Dass sie jetzt in der Druckerei arbeitete, hatte die Mutter dem Vater beigebracht, auf eine Art, dass er nichts hatte dagegen sagen können.
Die Mutter war anders zu ihr, seit sie die Fabrik gewechselt hatte: geradezu sanft. So dankbar war die Mutter, weil sie jetzt mehr Geld nach Hause brachte, viel mehr, als die Mutter und Lisa gemeinsam mit Heimarbeit verdienten, sogar mehr als das Krankengeld vom Vater. Immer wieder sagte die Mutter: Das war Rettung in höchster Not. Ich wüsste gar nicht, was sonst werden sollte.
Vor lauter Dankbarkeit hatte die Mutter ihr sogar erlaubt, zum Tanzen zu gehen, sie solle es bloß den Vater nicht merken lassen.
»Sehen Sie, Fräulein, dieser Hut, der passt dazu wie dafür gemacht, den müssen Sie unbedingt auch nehmen, sonst ist es nur eine halbe Sache«, meinte das Ladenfräulein und reichte ihr einen zierlichen Strohhut mit grüner Atlasschleife und roten Seidenblumen. Auch noch ein Hut? Clara rechnete. Sollte sie wirklich so an ihre Ersparnisse gehen? Nein, das war nicht in Ordnung. Der Vater würde sagen, dass sie mit ihrer Putzsucht ihr Geld für sündige Vergnügungen verprasste. Dennoch setzte sie sich den Hut auf.
Leise pfiff sie durch die Lippen: Das machte was her. Gleich sahen ihre braunen Haare noch viel dunkler aus. Sie holte ihren Zopf nach vorn, ließ ihn über die Brust fallen. Er kam durch den Hut erst richtig zur Geltung. Trotzdem …
»Ohne Hut können Sie unmöglich zum Tanzen gehen«, erklärte das Ladenfräulein mit Nachdruck.
Das gab den Ausschlag. Sie behielt die neuen Sachen gleich an und ließ sich ihre alten Kleider in Packpapier zu einem Bündel schnüren.
Draußen neigte sich der erste schöne Frühlingstag des Jahres. Samstags endete die Arbeit in der Druckerei schon um vier. Gleich nach der Fabrikarbeit hatte Clara sich auf die Suche nach einem Kleid gemacht. Es hatte nicht so lange gedauert, wie sie gedacht hatte, weil sie sich von Anfang an in dieses eine Kleid verguckt hatte. So kam sie noch bei Sonnenschein aus dem Geschäft. Dennoch wurde es schon kalt. Aber Clara dachte nicht daran, ihr warmes Umschlagtuch aus dem Bündel zu holen. In dem dünnen Kleid und dem Samtjäckchen schritt sie stolz durch die Straßen. Alle, die sie sahen, mussten jetzt denken, sie sei ein vornehmes Bürgerfräulein, vielleicht die Tochter eines Kaufmanns oder sogar eines Arztes. Trafen sie nicht bewundernde Blicke? Und drehten sich nicht sogar feine Herren nach ihr um?
Nur mit Mühe hielt sie es aus, nicht nach hinten zu schauen, um festzustellen, ob ihr die Augen des einen oder anderen Herrn folgten. Morgen würde sie keinen Tanz auslassen. Jenny hatte mit ihr geübt, hatte ihr die Tanzschritte beigebracht und behauptet, sie sei ein Naturtalent. Die Herren würden sich um sie reißen.
Doch was sollte sie tun, wenn keiner sie aufforderte?
Unruhig wurde sie bei dem Gedanken, spürte das ganze Unglück im Vorhinein. Auf dem Stuhl sitzen und warten und warten, und keiner kam. Wie grausam musste das sein.
Sie musste noch einmal mit Jenny darüber reden. Und sie fragen, ob sie glaubte, dass sie das richtige Kleid zum Tanzen gekauft hatte. Vielleicht wäre ein schwarzes doch besser gewesen?
Jetzt ging sie, so schnell sie konnte, bis sie endlich zu ihrer Mietskaserne kam. Die zwei Treppen zu Jenny hinauf rannte sie, eilte den langen Flur entlang. Erhitzt kam sie an der Tür an, riss sie gleich nach dem Klopfen auf, stürmte in die Küche.
»Jenny, ich …« Sie brach ab, stockte. Ein fremder Mann saß bei Jenny am Küchentisch. Etwas Besseres war er, das merkte man gleich, obwohl seine Kleidung ziemlich schäbig aussah. Offensichtlich waren die beiden in eine ernsthafte Diskussion vertieft, Jenny sah sehr aufgebracht aus.
Nun fuhr die Freundin zu ihr herum. »Clara, du, stell dir vor, sie haben die Arbeiterinnenschule verboten!«, brach es aus ihr heraus. »Der ganze große Frauen- und Mädchenbildungsverein wurde durch Gerichtsurteil geschlossen. Sie gönnen uns nicht mal das bisschen Wissen! Dumm sollen wir bleiben, wie Schafe, die kann man scheren und melken und in den Stall treiben und sogar schlachten, ohne dass sie sich wehren. So hätte die Regierung uns Arbeiterinnen gern!«
»Aber was, wieso denn«, stammelte Clara. Da hatte sie Jenny ihr neues Kleid vorführen wollen und über das Tanzen reden, und nun!
»Weil sie Angst haben, dass wir uns in die Politik mischen, und das ist uns Frauen ja bekanntlich verboten«, erwiderte Jenny bitter. »Angeblich hat der Verein politische Ziele verfolgt. Einundzwanzig Genossinnen werden angeklagt, in nicht einmal zwei Wochen soll ihnen schon der Prozess gemacht werden. Sie hätten Frauenspersonen als Mitglieder eines politischen Vereins aufgenommen. Dabei sind wir doch so vorsichtig und passen auf, dass wir nach außen nie was von Politik verlauten lassen, sondern öffentlich immer nur über Lesefähigkeit und Hauswirtschaft und Kinderpflege und so was reden! Aber selbst damit sind wir vor der Polizei nicht sicher. Politik wäre überhaupt alles, was nicht eine einzelne Person, sondern die gesamte Öffentlichkeit angeht, und da haben nach Recht und Gesetz Frauen nun mal nichts verloren. Ich könnte die Wände rauf! Weil ein Arzt auf einer Versammlung für Mütter von der Säuglingssterblichkeit geredet hat und davon, dass sie von der Ernährung kommt, und dass es die Pflicht der Kommune sein sollte, die teure Kindermilch für die Familien zu beschaffen, die sie nicht bezahlen können! Und das soll nur die Männer was angehen und nicht die Frauen?!«
»So ist es nun einmal in der Klassengesellschaft«, meinte der fremde Mann. Er hatte eine tiefe, warme Stimme, die sehr ruhig, beinahe begütigend neben der aufgebrachten Stimme von Jenny wirkte. Der Klang dieser Stimme gefiel Clara so gut, dass es ihr ganz gleich war, was er sagte. Wenn er nur weitersprach.
»Die Herrschenden fürchten um ihre Macht. Mit Zähnen und Klauen verteidigen sie die alten Vorrechte. Die Vorrechte des Adels, des Militärs, des Grundbesitzes, des Kapitals, der Bildung. Und natürlich die Vorrechte des Mannes. Aber entschuldigen Sie, Fräulein Clara, wir sind noch gar nicht miteinander bekannt.«
Er erhob sich, verneigte sich leicht und streckte ihr die Hand entgegen. »Johann Nietnagel. Ich wohne hier im Haus. Hin und wieder verfasse ich einen Artikel für den Vorwärts oder sonst eine Zeitung, die bereit ist, meine Zeilen zu veröffentlichen. Deswegen beraten Jenny und ich gerade, wie man vorgehen könnte und was zu diesen unerhörten Vorgängen zu schreiben wäre.«
Johann Nietnagel.
Sie hielt seine Hand in der ihren und ließ sie gar nicht mehr los, bis er sie schließlich mit einem kleinen Lächeln zurückzog. Unwillkürlich sagte sie leise und andächtig: »Ein Träumer, ein verlorner Sohn.« Jäh stieg ihr die Hitze ins Gesicht.
Er sah sie überrascht an. »Sie kennen mein Gedicht?«
Sie nickte. »Ich hab es auswendig gelernt«, erwiderte sie und fügte rasch hinzu: »Ich arbeite in der Druckerei, und manchmal, da lesen wir die Fehldrucke und …« Ihre Stimme versandete. Was interessierte ihr einfältiges Gerede einen Dichter! Bestimmt fand er sie langweilig und lächerlich.
»Setzen Sie sich doch zu uns«, bat er und rückte ihr einen Stuhl zurecht. »Aber wenn ich störe – Sie wollten schließlich Jenny sprechen –, dann verabschiede ich mich.« Fragend sah er sie an.
Sie schüttelte den Kopf. Er und stören! Doch eine passende Antwort fiel ihr nicht ein. »Ich wollte Jenny nur noch mal wegen morgen fragen, weil wir ja zum Tanzen in den Arbeiterverein gehen wollen«, murmelte sie.
»Ach«, seufzte Jenny, »ich weiß gar nicht, ob mir nach alldem morgen nach einem Tanzvergnügen ist! Ich glaub, wir gehen da nicht hin.«
»Aber«, flüsterte Clara. Mehr brachte sie nicht heraus. »Aber …«
Ihr allererstes Tanzvergnügen, ihr neues Kleid, die ganze Vorfreude – und nun! Verzweifelt bemühte sie sich, nicht zu weinen.
»Warum nicht?«, fragte Johann Nietnagel. »Du wirst viele Gleichgesinnte dort treffen, Jenny, die neuesten Nachrichten und Gerüchte hören, was gibt es Besseres für die Agitation? Bei einem Tanzvergnügen wittert die Polizei nicht gleich politische Umtriebe, während man sich im Walzer dreht oder am Biertisch sitzt, kann man so manches besprechen, unbehelligt von den Spitzeln des Klassenstaates. Und was das Tanzen betrifft – den Triumph sollten wir der Polizei und der Justiz nicht gönnen, dass sie uns Genossen die ganze Lebensfreude rauben können! Ich jedenfalls hätte nicht schlecht Lust auf eine kleine Abwechslung. Haben Sie denn schon einen Herrn für morgen Abend, Fräulein Clara?«
Sie wagte nicht, ihn anzuschauen, blickte auf ihre Hände, die sie im Schoß verkrampft hielt. Sah er, wie rau sie waren? Stumm schüttelte sie den Kopf.
»Dann bitte ich sehr um die Ehre, morgen Abend ihr Tanzherr sein zu dürfen«, sagte Johann Nietnagel.
»Hat Ihnen Jenny denn erzählt, dass sie es war, die mich zum Sozialdemokraten gemacht hat?«, fragte Herr Nietnagel und legte Clara kurz die Hand auf die Rechte. Schade, dass er sie nicht liegen ließ.
Clara schüttelte den Kopf und sah ihn erwartungsvoll an. Wie im Traum fühlte sie sich, den ganzen Abend schon: der große, mit Lampions, Papiergirlanden und Frühlingsblumen geschmückte Wirtshaussaal, die vielen festlich gekleideten Männer, Frauen und Mädchen, die Musikkapelle, das Tanzen, der leichte, wohlige Nebel, den der ungewohnte Genuss von Bier in ihrem Kopf erzeugte – und vor allem er, Johann Nietnagel.
Keinen Tanz hatte er bisher ausgelassen. Die zweite Runde hatte er mit Jenny getanzt, aber sonst jeden einzelnen Tanz mit ihr. Es ging ganz leicht, sie musste nicht darüber nachdenken, welche Schritte und Drehungen sie zu machen hatte, sie musste sich einfach nur ihm überlassen.
Würde doch dieser Abend niemals enden!
Wie nah man einander beim Tanzen kam: sein Arm um ihre Taille gelegt, ihre Hand in der seinen, und die Gesichter so dicht beieinander, dass sie die feinen grünen Sprengsel in seinen bräunlichen Augen sehen konnte oder seinen Atem an ihrem Hals spüren.
Erst war sie enttäuscht gewesen, als die Kapelle eine längere Pause angekündigt hatte. Doch nun fand sie es gut, mit Jenny und Heinrich am Tisch zu sitzen und natürlich mit ihm, Johann. Heimlich, ganz für sich, nannte sie ihn bereits so.
Jenny lachte. »Ja, das ist eine Geschichte! Dann erzähl doch mal, Johann! Ich würde gern hören, wie sich das aus dem Mund des nationalliberalen feinen Herrn anhört, der du damals warst.«
»Ich war nie nationalliberal!«, protestierte Johann. »Ich fühlte mich gar keiner Partei zugehörig. Sie müssen wissen, Fräulein Clara, damals – es war im Jahr '89 – studierte ich noch an der Friedrich-Wilhelms-Universität hier in Berlin. Ich war für Philosophie und Literatur eingeschrieben, wenn ich mich auch gegen Ende meines Studiums dann die längste Zeit in den Vorlesungen der Katheder-Sozialisten herumtrieb, Schmoller, Wagner, aber das tut hier nichts zur Sache. Viel wichtiger ist, dass ich eine Studentenbude bei der Familie eines wackeren Kleinbürgers hatte, eines Lokomotivführers, der zu wenig verdiente, um seine sechsköpfige Familie anständig zu ernähren, weshalb die gute Stube an mich vermietet wurde. Über den Geschmack, mit dem dieser Repräsentationsraum ausgestattet war, will ich mich ausschweigen, aber ich wurde bestens versorgt und bedient – immer frisch gewaschene, gestärkte und geplättete Hemden, das war für mich selbstverständlich. Und dass ich ein besseres Essen bekam als die Frau und die Kinder, hab ich hingenommen, als wäre es natürlich.« Er zog die Augenbrauen zusammen, als wäre er ernstlich böse auf sich selbst.
»Wieso«, meinte Clara rasch – sie wollte nicht, dass er so über sich redete –, »das ist doch immer so, bei uns auch. Die Männer bekommen halt mehr und besser zu essen, Fleisch vor allem, das geht doch gar nicht anders, wenn's nicht für alle reicht. Und welcher Mann bügelt schon selbst seine Hemden? Dass ich nicht lache!«
»Genau!« Heinrich knuffte sie freundschaftlich in die Seite. »Du sagst es, Mädchen!« Er grinste breit.
Jenny schien etwas einwerfen zu wollen, doch Johann sprach bereits weiter: »Ja, so ist es jetzt. Aber wie es einmal in einer gerechteren Gesellschaft der Zukunft sein wird, wenn der Sozialismus gesiegt hat, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen, das führt jetzt zu weit. Ich wollte ja von Lokomotivführer Schreiber erzählen und vor allem von Jenny.«
Er lehnte sich behaglich zurück und lachte Jenny an. Wie schön dieses Lachen war, wie fröhlich und frei …
Clara spürte einen kurzen Stich der Eifersucht, dass es nicht ihr galt. Doch schon wandte er sich wieder ihr zu: »Nie wäre mir in den Sinn gekommen, mit dem guten Herrn Schreiber oder gar seiner Gattin ein politisches Gespräch zu führen. Guten Morgen, Guten Abend, Schönes Wetter heute, Reinigen Sie bitte den Anzug – viel weiter führte unsere Konversation nicht. Und niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dass dieser biedere kleine Mann ein heimlicher Sozialist sein könnte. Es war ja noch unter dem Sozialistengesetz, da hat man das tunlichst nicht an die große Glocke gehängt, und bei der Bahn wäre er doch sofort rausgeschmissen worden, wenn das rausgekommen wäre. Doch dann eines Tages – ich saß in meiner Bude und hatte bereits kurz zuvor die Türklingel gehört und eine flüsternde Mädchenstimme draußen im Flur, die sehr heimlich tat – da war plötzlich ein Sturmgeläut an der Wohnungstür und ein rabiates Klopfen und Rufen: »Sofort öffnen! Polizei!«
»Genau«, ergriff Jenny das Wort. »Du musst nämlich wissen, Clara, damals hab ich heimlich den Sozialdemokrat ausgeteilt, der war ja verboten, auf immer neuen Schleichwegen wurde die Zeitung aus der Schweiz nach Deutschland geschmuggelt und hier von vielen aktiven Genossen und Genossinnen im Untergrund verteilt. Wenn man dabei erwischt wurde, dass man die rote Feldpost unter die Leute brachte, konnte man glatt für einen Monat ins Gefängnis wandern. Na ja, ich habe mir immer neue Tricks ausgedacht. In dem Sommer war ich drauf verfallen, im Wald Brombeeren zu sammeln und die dann von Haus zu Haus zu verkaufen. Natürlich bin ich nur zu den Abnehmern des Sozialdemokrat gegangen, und unten in meinem Korb, unter einem Tuch versteckt, lagen die Hefte.«
»Ja, meine rote Jenny, das war eine ganz Mutige«, unterbrach Heinrich stolz und legte mit besitzergreifender Geste seinen Arm um seine Frau. »Aber was sag ich war. Sie ist es ja immer noch!«
»Clara auch«, erwiderte Jenny. Und dann zu Johann gewandt: »Clara versteckt nämlich die Beitragshefte vom Frauenagitationskomitee. Ohne Clara wäre Gerda jetzt vermutlich auch im Gefängnis.«
»Wirklich?« Johann sah sie freudig überrascht an. »Dann sind wir also Kampfgefährten? Respekt, Respekt, Fräulein Clara! Jetzt ist es mir eine doppelte Ehre, mit Ihnen tanzen zu dürfen.«
Respekt, Respekt – das hatte noch nie jemand zu ihr gesagt. Und nun er. Plötzlich war ihr, als sei sie ihm dadurch ein Stück weit ebenbürtig geworden, obwohl er natürlich unerreichbar weit über ihr stand: ein studierter Herr, ein Dichter. Zum Glück wusste er nicht, wie oft sie schon bereut hatte, diese Hefte an sich genommen und unter der Diele verborgen zu haben.
»Aber irgendwie bin ich wohl doch mal aufgefallen mit meinen Brombeeren«, nahm Jenny ihren Faden wieder auf. »Ich wurde offensichtlich beobachtet und verfolgt. Nun sollte ich also auf frischer Tat ertappt und verhaftet werden. Da stand ich mit meinen verbotenen Blättern im Flur bei Frau Schreiber und draußen hämmerte die Polizei an die Tür. Wär da nicht Johann gewesen …«
Er grinste. »Es war die reine Neugier, die mich in den Flur trieb. Und als ich die beiden da so stehen sah, den Stapel Blätter in der Hand und starr vor Schreck, da habe ich gar nicht mehr nachgedacht. Ich habe ihnen die Zeitungen einfach aus der Hand genommen und in meine Studentenmappe gesteckt, Frau Schreiber kam noch mit einem roten Liederbuch angerannt und schob mir das auch noch unter, und schon bin ich hinten zur Küchentür raus und die Hintertreppe runter. Unten stand ein Schutzmann und bewachte den Ausgang – den heißen Schreck spüre ich heute noch in den Gliedern –, aber er ließ mich unbehelligt durch. Er hatte wohl nicht Befehl, einen Studenten zu filzen. Den ganzen Tag trug ich jedenfalls diese roten Brandschriften in meiner Mappe in der Universität spazieren. Am Abend brachte ich sie wieder zurück – inzwischen war die Wohnung durchsucht worden, auch mein Zimmer hatte die Polizei durchwühlt, aber sie hatten nichts gefunden.«
»Nur Brombeeren!«, warf Jenny ein und lachte.
»Ich aber setzte mich noch am gleichen Abend hin und begann den Sozialdemokrat zu lesen«, fuhr Johann unbeirrt fort. »Etwas, wofür ein junges Mädchen so viel riskierte, musste ja wertvoll sein, nicht wahr? Und was soll ich sagen – es ließ mich nicht mehr los. Es öffnete mir die Augen. Auf einmal konnte ich an dem sozialen Elend, der Armut und der ganzen Ungerechtigkeit nicht mehr vorbeisehen. Es war der Anfang meiner Bekehrung.«
»Ganz schön mutig«, meinte Clara und schaute ihn an.
»Nicht mutiger, als du es bist, Clara«, sagte er warm und erwiderte den Blick.
Er hob ihr sein Bierglas entgegen. »Ich heiße Johann. Machst du mir die Freude und sagst du zu mir?«
»Ja, Johann.« Sie spürte selbst, dass sie rot übergossen war und es machte ihr nichts aus.
Die Musik setzte wieder ein. Er verbeugte sich vor ihr und führte sie zur Tanzfläche. Sie tanzten eine Polka und einen Walzer und noch einen Tanz, von dem sie keine Ahnung hatte, wie er hieß, aber was machte das, sie berührte den Boden ja kaum, die Füße bewegten sich von selbst, es war, als ob sie schwebe, getragen von seinem Arm und mehr noch von seinem Blick.
»Du süßes tapferes Mädchen«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Die Jeanne d'Arc der Hinterhöfe. So kühn und so hübsch.«
Sie wusste nicht, was eine Jeanne d'Arc war, aber das war ihr gleich. Es war ein Kompliment, nur das war wichtig, ein Kompliment, das von Herzen kam.