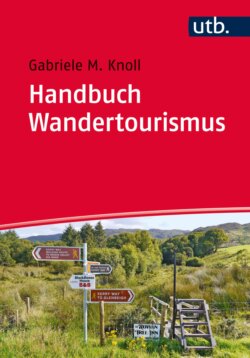Читать книгу Handbuch Wandertourismus - Gabriele M. Knoll - Страница 6
1 Eine Zeitreise zu Fuß – Aus der Geschichte des Wanderns 1.1 „Das Wandern ist des Müllers Lust“ – berufsbedingt zu Fuß durch halb Europa
Оглавление♦ Auf einen Blick
In diesem Kapitel werden folgende Aspekte und Fragen behandelt:
Welche Formen der Fußwanderung gehören zur europäischen Kulturgeschichte?
In welchen gesellschaftlichen Zusammenhängen sind die Anfänge des modernen Wandertourismus zu finden?
Worin lag der Protest, seine Wanderschuhe zu schnüren und auf Tour zu gehen?
Der „spießige“ Sonntagsspaziergang war einmal revolutionär!
Weshalb war es sinnvoll, Wandervereine zu gründen?
Nicht die Wanderfreude eines bestimmten Herrn Müller wird in dem alten Volkslied „Das Wandern ist des Müllers Lust“ besungen, sondern die berufliche Weiterbildung der Müllergesellen im Allgemeinen. Nach den Zunftordnungen war es für das Gros der Handwerksgesellen vom 14. noch bis ins 19. Jahrhundert Pflicht, auf Wanderschaft, auf die Walz zu gehen, in der Ferne bei anderen Meistern zu lernen, und mindestens vier bis sechs Jahre lang ihren Heimatbezirk nicht zu betreten. Erst mit der Aufhebung der Zünfte und neuen Gewerbeordnungen im 19. Jahrhundert erledigte sich dieser historische Zwang zur beruflichen Mobilität.
Bei den beruflichen Lehr- und Wanderjahren war nicht nur durch den technischen Stand des Verkehrswesen in jenen Zeiten, sondern auch durch soziale Spielregeln für Handwerker – und andere Angehörige unterer Schichten – die Fußreise die einzige Möglichkeit, von A nach B zu kommen. „Ein reitender Handwerksgeselle oder ein Bauer in der gemieteten „Extra-Post“ wären in der Standesgesellschaft undenkbar gewesen. Die Höhe des Pferderückens und der Radachse drückte symbolisch auch die Position in der gesellschaftlichen Hierarchie aus.“ (KASCHUBA (1991), S. 166)
Es konnten beachtliche Entfernungen sein, die die Handwerksgesellen auf ihrer Walz – wenn auch über mehrere Jahre verteilt – zurücklegten. Die geographischen Dimensionen von Handwerkerwanderungen können dabei durchaus beachtlich gewesen sein, wenn beispielsweise Maurer oder Steinmetze danach strebten, in den Dombauhütten oder auf den großen Schlossbaustellen bei den berühmtesten Baumeistern bzw. Architekten zu lernen und zu arbeiten. „Aus mitteleuropäischer Sicht umfaßte die geographische Ausdehnung handwerklicher Mobilität die deutschsprachigen Länder, die gesamte Schweiz, die flämischen und wallonischen Niederlande, Frankreich (vor allem den Westen und Paris), Italien (meist nur bis Rom), Böhmen und Mähren, Polen, das Königreich Ungarn unter Einschluß von Kroatien und Siebenbürgen, das Baltikum bis nach St. Petersburg, Dänemark und das südliche Schweden. Offensichtlich deckten sich häufig die Kommunikationsräume des Handwerks mit den Verkehrsräumen des Handels, wobei Großbritannien und die Iberische Halbinsel für die Handwerker doch eher abseits lagen.“ (ELKAR (1991), S. 57f.)
♦ Wissen: Auf der Walz (1834)
„Es war nicht nur meine Lust zum Reisen, weil ich hoffte, dadurch meine Gesundheit zu stärken, sondern es war Pflicht des jungen Handwerkers, ca. 3 Jahre ins Ausland zu reisen, ehe er in Hamburg ein selbständiges Geschäft anfangen konnte.
Ostern 1834 machte ich mich reisefertig. Mein Gepäck war nur ca. 15 Pfund schwer, mein Ränzel also nur klein. Er enthielt Rock, Hose, Weste, dann ein paar Strümpfe, 2 Hemden und einige Taschentücher. – Mein Anzug bestand aus Hose, Weste und Kittel, dann einem Paar kräftiger Schuhe, welche auf jeder Reise aushielten, und Filzhut. – Dann noch im Ränzel Witschels „Morgen- und Abendopfer“, und ein französisches Sprachenlehrbuch zum Üben auf der Reise. – In der Tasche hatte ich eine Miniaturausgabe von Seumes’s Gedichten, Auszüge aus anderen Freiheitsdichtern und Ehrenberg’s „Karakter und Bestimmung des Mannes“.
Noch eins darf ich nicht vergessen, ein kleines Album mit losen Blättern hatte ich bei mir, worin ich von meinen Freunden Sprüche zur einstigen Erinnerung an dieselben eintragen ließ, unter diesen zwei Blätter, die meine Eltern mir ins Album eingeschrieben haben, wozu ich ihnen die Umrandung nach ihrer Angabe machen mußte. – Das war mein ganzes Reisegepäck.“
Quelle: MICHAELSEN (1929), S. 39, zit. in PÖLS (1979), S. 219
Selbst in unseren Zeiten einer mühelosen weltweiten Kommunikation und einer Fachliteratur, die jeder Handwerker lesen kann, werden Gesellenwanderungen durchgeführt. Auch diese moderne Form unterliegt bestimmten festgelegten Regeln; so darf sich ein Geselle beispielsweise auch heute nicht auf seiner Walz dem Heimatort mehr als 50 Kilometer nähern (Confederation Europäischer Gesellenzünfte). Im Jahr 2015 wurde die Walz sogar auf die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Bundesrepublik Deutschland gesetzt, um eines Tages als ein Teil des nicht materiellen Kulturerbes der Welt zu gelten und ausgezeichnet zu werden.
♦ Linktipps
▶ Confederation Europäischer Gesellenzünfte
ww.cceg.eu
▶ Liste des Immateriellen Kulturerbes der Bundesrepublik Deutschland
unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe/bundesweites-verzeichnis/eintrag/handwerksgesellenwanderschaft-walz.html
Zu einer anderen großen Berufsgruppe, die über Jahrhunderte hinweg auf die Wanderung – oft auch als Fernwanderungen – angewiesen war, gehören Kaufleute und Hausierer. „Während des Früh- und Hochmittelalters waren Kaufmannstätigkeit und Reisen untrennbar miteinander verbunden. Die Notwendigkeit des Eigenhandels trieb jeden Kaufmann zur Reise. Seine Waren begleitend zog er in die Fremde, zu Märkten und Messen“ (NEUTSCH, WITTHÖFT (1991), S. 75). In jene Zeit fielen beispielsweise schon frühe Formen von Geschäftsreisen zur Frankfurter Herbstmesse; 1240 hatte Kaiser Friedrich II. mit seinem Privileg die freie Reichsstadt Frankfurt zur ersten Messestadt der Welt erhoben. Mit ihren Waren, durchaus auch Luxusgütern aus fernen Ländern, auf den Rücken von Saumtieren oder auf Fuhrwerke geladen, zogen die Händler per Pedes zu den Märkten und Messen. Im 14./15. Jahrhundert setzte es sich durch, dass die Großkaufleute in ihren Kontoren blieben und von dort die Geschäfte regelten, dafür mussten sich dann Kaufmannsgehilfe oder Frachtführer auf die beschwerliche Fußreise machen.
Zunehmend half den Kaufleuten Reiseliteratur für ihre speziellen Bedürfnisse, so genannte Routenbücher – ausgehend von handschriftlichen Tagebüchern und Geschäftskladden, die ab dem 16. Jahrhundert auch in gedruckter Form zur Verfügung standen – bis hin zu Meilenscheiben und Meilensteinen, die die Entfernungen von den Handelsstädten zu anderen Orten nannten (a. a. O., S. 76). Eine ähnliche Infrastruktur und Hilfen für Reisende gab es bereits in der Antike, doch mit dem Beginn der Neuzeit erlebt sie eine Renaissance und konnte sich entsprechend der Nachfrage auch weiter entwickeln.
Während sich die Kaufleute in der Neuzeit immer mehr von der Mühe der Fußreise verabschieden konnten und sie ihren Landverkehr mit Reit-, Zug- und Lasttieren betrieben, blieben die Hausierer als ambulante Gewerbetreibende bis ins 19. Jahrhundert und sogar noch im frühen 20. Jahrhundert weitgehend Fußgänger. Vermutlich existieren von keiner anderen Gruppe, die über die Jahrhunderte hinweg beruflich zu Fuß unterwegs war, so viele historische Abbildungen wie von den wandernden Männer mit Kiepen oder anderen Tragegestellen auf dem Rücken.
„Ganze Heerscharen in- und ausländischer Hausierer waren im 18. und 19. Jahrhundert unterwegs und brachten so ziemlich alles zu den Abnehmern, was man in Rucksäcken und Tragekisten transportieren konnte. Da läßt sich kaum abschätzen, in welchem Umfang Haushaltwaren und Arbeitsgeräte, Schmuck, Textilien, Bücher, Bilder und Geschirr in bäuerliche Haushalte gelangten.“ (GLASS (1991), S. 62) Wenn es auch verständlicherweise von diesen Wanderungen, wie von den anderen berufsbedingten der Vergangenheit, keine Zahlen gibt – wohl aber von den Personen, die als ambulante Händler registriert waren (1882 waren es im Deutschen Reich offiziell 227.617 Hausierer (a. a. O., S. 64) – so kann man doch von der Versorgung der ländlichen Bevölkerung mit vielen Artikeln des täglichen Bedarfs und von der Annahme, dass die Dörfer sicherlich nicht in hohem Maße an einen öffentlichen Nahverkehr angeschlossen waren, ausgehen, dass viele Hausierer unterwegs gewesen sein müssen.
Als letzte nennenswerte Gruppe, die ebenfalls aus beruflichen Gründen bzw. um in der Ferne zu lernen seit dem Mittelalter unterwegs war, gehören die Studenten und Gelehrte.
♦ Literatur
ELKAR, R. S. (1991): Auf der Walz – Handwerkerreisen, in: BAUSINGER, H., BEYRER, K., KORFF, G. (Hrsg.) (1991): Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus, C. H. Beck, München, S. 57–62.
GLASS, C. (1991): Mit Gütern unterwegs. Hausierhändler im 18. und 19. Jahrhundert, in: BAUSINGER, H., BEYRER, K., KORFF, G. (Hrsg.) (1991): Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus, C. H. Beck, München, S. 62–69.
KASCHUBA, W. (1991): Die Fußreise. Von der Arbeitswanderung zur bürgerlichen Bildungswanderung. In: BAUSINGER, H., BEYRER, K., KORFF, G. (Hrsg.) (1991): Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus, C. H. Beck, München, S. 165–173.
MICHAELSEN, F. R. (1929): Die Wanderjahre des hamburgischen Schneidergesellen Friedrich Rudolph Michaelsen 1834–1839. In: Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter, 4. Jg. 1929. Zit. in: PÖLS, W. (Hrsg.) (1979, 3. Aufl.): Deutsche Sozialgeschichte 1815–1870. Dokumente und Skizzen, C. H. Beck, München.
NEUTSCH, C., WITTHÖFT, H. (1991): Kaufleute zwischen Markt und Messe, in: BAUSINGER, H., BEYRER, K., KORFF, G. (Hrsg.) (1991): Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus, C. H. Beck, München, S. 75–82.
OHLER, N. (1986): Reisen im Mittelalter, Artemis, München.