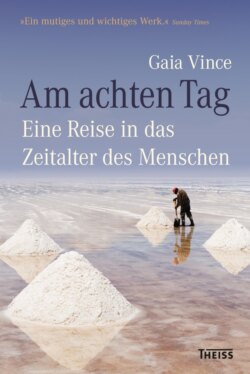Читать книгу Am achten Tag - Gaia Vince - Страница 8
EINLEITUNG DER MENSCHENPLANET
ОглавлениеVor viereinhalb Milliarden Jahren ging aus der schmutzigen Aureole kosmischen Staubes, die beim Schöpfungsprozess unserer Sonne entstanden war, ein wirbelnder, sich verdichtender Mineralklumpen hervor. Die Erde war geboren. Wenig später schlug auf ihr ein weiterer großer Gesteinsbrocken ein, der ein riesiges Stück – das später den Mond bildete – ablöste und unsere Welt in Schräglage kickte. Dieser Neigung verdanken wir die Jahreszeiten und Meeresströmungen, und der Mond bescherte uns Ebbe und Flut. All dies förderte die Voraussetzungen für die Entstehung des Lebens, das sich vor rund vier Milliarden Jahren zu entwickeln begann. Im Laufe der nächsten dreieinhalb Milliarden Jahre kam es wiederholt zu extremen Vereisungen. Nach der letzten dieser großen Eiszeiten explodierte die Zahl der komplexen vielzelligen Lebensformen geradezu.
Der Rest ist Geschichte, eingestanzt in die Haut des Planeten als dreidimensionale fossile Abbilder von fantastischen Kreaturen – langhalsigen Dinosauriern und Wesen zwischen Echse und Vogel, Rieseninsekten und fremdartigen Fischen. Die Entstehung von Leben auf der Erde veränderte die Physik des Planeten von Grund auf.1 Pflanzen beschleunigten mit ihren Wurzeln das allmähliche Aufbrechen des Gesteins und halfen beim Aushöhlen von Kanälen, durch die das Regenwasser abfloss, sodass sich Flüsse bildeten. Die Photosynthese wandelte die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre und Ozeane, versorgte das Erdensystem mit chemischer Energie und veränderte das Erdklima. Tiere fraßen die Pflanzen, was die Chemie der Erde ebenfalls beeinflusste.
Die physikalische Gestalt des Planeten wirkte ihrerseits auf seine Biologie ein. Lebewesen entwickeln sich in Reaktion auf geologische, physikalische und chemische Bedingungen. In den letzten 500 Millionen Jahren kam es fünfmal zu einem Massenaussterben, ausgelöst durch Eruptionen von Supervulkanen, Asteroideneinschläge und andere Ereignisse mit enormen globalen Auswirkungen, die das Klima dramatisch veränderten.2 Jedes Mal formierten sich die Überlebenden danach neu, vermehrten sich stark und entwickelten sich weiter. Heute ist die Diversität von Pflanzen, Tieren, Pilzen, Bakterien und anderen irdischen Lebensformen größer als jemals zuvor.3
Und wir? Der anatomisch moderne Mensch erschien erst vor rund 200.000 Jahren auf der Bildfläche, und ob wir überleben würden, stand auf Messers Schneide. Doch wir kamen durch – dank dem gewissen Etwas, das uns von den anderen Arten in unserer gemeinsamen Biosphäre unterschied und uns so erfolgreich machte, dass wir nun Herrscher unserer Welt sind: das menschliche Gehirn. Wir sind intelligenter und geschickter im Umgang mit Werkzeugen als andere Tiere. Überdies können Menschen Feuer machen und es beherrschen. Von dem Moment an, in dem ein Mensch den ersten Funken zündete, stand fest: Wir würden die mächtigste Spezies sein. Diese externe Energiequelle, die wir überallhin mitnehmen konnten, verlieh uns Macht über die Landschaft, Schutz vor anderen Tieren, die Möglichkeit, unsere Nahrung zu kochen, uns zu wärmen und letztendlich von der Welt Besitz zu ergreifen.
Jahrtausendelang teilten wir Menschen den Planeten mit Neandertalern und anderen Verwandten. Der Ausbruch des Supervulkans Toba in Indonesien vor 74.000 Jahren vernichtete beinahe uns alle – die menschliche Population schrumpfte auf wenige Tausend. Doch vor 35.000 Jahren hatten sich die eigentlichen modernen Menschen entwickelt, die von heutigen Menschen nicht mehr zu unterscheiden waren; sie wanderten aus Afrika aus und hinterließen in Höhlen und an Felsen zahllose Zeugnisse ihrer Kultur. Der heroische Aufstieg des Menschen hatte seinen Anfang genommen.
In der Steinzeit beschränkte sich unser Wirken als Spezies auf das Ausrotten einiger Arten – insbesondere großer Säugetiere – und einige Eingriffe in die Landschaft, wie das Niederbrennen von Wäldern. Die Techniken waren primitiv und minimalistisch und die Materialien allesamt erneuerbar. In den darauffolgenden Jahrhunderten nahm unser Einfluss zu. Vor etwa 10.000 Jahren (also vor rund 300 Generationen, Weltbevölkerung: 1 Million) wurde der Ackerbau erfunden; vom Menschen gezüchtete Pflanzensorten verdrängten Wildpflanzen und veränderten so einige regionale Landschaften. Vor rund 5500 Jahren (Weltbevölkerung: 5 Millionen) entstanden Städte und es entwickelten sich die ersten großen Zivilisationen. Der globale Einfluss der Industriellen Revolution in Europa und Nordamerika, die die Arbeitskraft von Menschen und Tieren durch Maschinen ersetzte, ist seit etwa 150 Jahren (Weltbevölkerung: 1 Milliarde) spürbar, da seither große Mengen Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen in die Atmosphäre geblasen werden.
Nichts ist jedoch vergleichbar mit dem Ausmaß und der Geschwindigkeit unseres weltweiten Einflusses seit dem Zweiten Weltkrieg, befeuert durch Bevölkerungswachstum, Globalisierung, Massenproduktion, Revolutionen auf dem Gebiet der Technik und der Kommunikation, effizientere landwirtschaftliche Methoden und medizinischen Fortschritt. Unter der Bezeichnung Great Acceleration („große Beschleunigung“) offenbart sich dieser rasante Zuwachs menschlicher Aktivitäten auf allen möglichen Ebenen, von der Anzahl der Autos bis zum Wasserverbrauch.4 Die Menschheit benötigte 50.000 Jahre, um eine Weltbevölkerung von 1 Milliarde zu erreichen, doch für die letzte Milliarde brauchten wir gerade einmal die vergangenen 10 Jahre.
Dieser radikale Umbruch beflügelte die soziale und ökonomische Entwicklung – vor 100 Jahren betrug die durchschnittliche Lebenserwartung in Europa weniger als 50 Jahre, heute liegt sie bei rund 80 Jahren. Doch die Great Acceleration hatte immer auch ihre schmutzige Seite. Dichter Smog hüllte Großstädte wie London ein und tötete Tausende, saurer Regen verseuchte Flüsse, Seen und Ackerböden und ließ Gebäude und Denkmäler zerfallen, Kältemittel zersetzten die schützende Ozonschicht, Kohlendioxidemissionen veränderten das Erdklima und machten die Meere saurer. Unser gieriges Ausbeuten der natürlichen Welt hat zu massiver Abholzung geführt, zu einem sprunghaften Anstieg der Aussterberaten und zu zerstörten Ökosystemen. Sie hat eine Flut von Müll produziert, deren Abbau Hunderte Jahre in Anspruch nehmen wird. Die Spanne eines einzigen Menschenlebens hat genügt, uns zu einer gewaltigen globalen Macht zu machen, und nichts spricht dafür, dass sich der Prozess verlangsamt – ganz im Gegenteil scheint sich unsere ungeheure Einwirkung auf den Planeten noch zu verstärken.
Zur gleichen Zeit lebt unser engster Verwandter, der Schimpanse, im Grunde noch genauso wie schon vor 50.000 Jahren. Menschen sind die einzigen Lebewesen mit einer kumulativen Kultur, was uns in die Lage versetzt, auf Vergangenem aufzubauen, statt das Rad immer wieder neu zu erfinden. Doch indem wir – stets den Launen unseres unfassbar leistungsfähigen Gehirns unterworfen – auf dem Antlitz der Erde herumwerkeln, wagen wir Menschen uns an das kühne Experiment, die physikalische und biologische Welt völlig neu zu gestalten. Wir besitzen die Macht, das Schicksal jeder einzelnen Spezies, einschließlich unserer eigenen, dramatisch zu verändern. Große Umwälzungen sind bereits im Gange. Dieselbe Genialität, die uns länger und behaglicher leben lässt als je zuvor, verwandelt die Erde stärker als alles, was unsere Art bisher erfahren hat. Dies ist eine aufregende, aber auch unsichere Zeit. Willkommen im Anthropozän – dem Zeitalter des Menschen.
Wir leben in epochemachenden Zeiten. Buchstäblich. Die in den letzten Jahrzehnten vom Menschen herbeigeführten Veränderungen waren weitreichender und tiefgreifender als alles, was unsere Welt in ihrer viereinhalb Milliarden Jahre langen Geschichte erlebt hat. Unser Planet ist dabei, in ein neues geologisches Zeitalter einzutreten, und wir Menschen sind die Urheber dieses Geschehens.
In Millionen von Jahren wird ein Streifen in den Gesteinsschichten der Erdoberfläche unsere Spuren preisgeben, genauso, wie wir heute Hinweise auf Dinosaurier im Gestein des Jura entdecken oder auf die kambrische Explosion von Lebensformen oder auf die tiefen Narben, die nach dem Gletscherschwund im Holozän zurückblieben. Unser Einfluss wird sich im massenhaften Aussterben von Arten offenbaren, in der veränderten Chemie der Ozeane, im Verlust von Wäldern und in der Ausbreitung von Wüsten, im Aufstauen von Flüssen, dem Rückgang von Gletschern und dem Versinken von Inseln. Die Geologen der fernen Zukunft werden aus den fossilen Zeugnissen das Ausrotten verschiedener Tierarten und die Fülle der domestizierten Tiere herauslesen, den chemischen Fingerabdruck künstlicher Materialien, wie Getränkedosen aus Aluminium und Plastiktüten, sowie die Spuren von Projekten wie der Syncrude-Mine in den Athabasca-Ölsanden im Nordosten Kanadas, wo jährlich 30 Milliarden Tonnen Erde bewegt werden – die doppelte Menge der Sedimente, die alle Flüsse der Welt in dieser Zeitspanne mit sich führen.
Geologen nennen dieses neue Zeitalter Anthropozän. Damit bringen sie zum Ausdruck, dass die Menschheit zu einer geophysikalischen Macht geworden ist, ebenbürtig den erderschütternden Asteroiden und den Finsternis bringenden Vulkanen, die vergangene Epochen geprägt haben.5
Die Erde ist heute ein Menschenplanet. Wir entscheiden, ob ein Wald bestehen bleibt oder abgeholzt wird, ob Pandabären überleben oder aussterben, wie und wo ein Fluss fließt, ja sogar, wie viel Grad die Atmosphäre hat. Wir sind das auf der Erde am häufigsten vorkommende große Tier, und gleich danach kommen die Tiere, die wir durch Züchten herangezogen haben und die uns dienen. Vier Zehntel der Erdoberfläche werden zum Anbauen unserer Nahrung genutzt. Drei Viertel der Süßwasservorkommen auf der Welt werden von uns kontrolliert. Dies sind außergewöhnliche Zeiten. In den Tropen schwinden die Korallenriffe, an den Polen schmilzt das Eis und in den Meeren gibt es dank uns immer weniger Fische. Ganze Inseln versinken in den steigenden Meeresfluten und in der Arktis kommt neues, ödes Land zum Vorschein.
Während meiner Laufbahn als Wissenschaftsjournalistin hatte ich häufig mit Berichten über den Wandel der Biosphäre zu tun. Die entsprechenden Untersuchungen häuften sich. Eine Studie nach der anderen landete auf meinem Schreibtisch, mit Schilderungen von sich ändernden Schmetterlingswanderungen, der Geschwindigkeit der Gletscherschmelze, dem Stickstoffgehalt der Meere, der Häufigkeit von Flächenbränden … und alles einte ein großes Thema: der Einfluss des Menschen. Wissenschaftler, mit denen ich sprach, beschrieben mir, auf welch vielfältige Weise der Mensch in die Natur eingegriffen hat, selbst wenn es um scheinbar unergründliche physikalische Phänomene wie Wetter, Erdbeben und Meeresströmungen ging. Und sie sagten noch größere Umwälzungen voraus. Klimaforscher, die die Erderwärmung verfolgten, sprachen von todbringenden Dürren, Hitzewellen und einem meterhohen Anstieg des Meeresspiegels. Naturschutzbiologen erläuterten den Zusammenbruch der Artenvielfalt bis hin zum Massenaussterben, Meeresbiologen redeten von „Inseln aus Plastikmüll“ in den Ozeanen, Weltraumforscher besprachen auf Tagungen, was mit all dem Abfall im All zu tun sei, der unsere Satelliten bedrohe, Ökologen schilderten die Abholzung der letzten intakten Regenwälder, und Agrarökonomen warnten vor Wüsten, die sich über die letzten fruchtbaren Landstriche ausbreiten. Jede neue Studie schien schonungslos klarzumachen, wie sehr die Welt im Wandel begriffen war – sie entwickelte sich zu einem ganz anderen Planeten. Wir selbst waren dabei, unsere Welt in ihren Grundfesten zu erschüttern, und indem ich und andere diese Geschichten zu Papier brachten, erfuhren Menschen weltweit und unmissverständlich von den Umweltkrisen, die wir alle heraufbeschworen hatten.6 Es war zutiefst beunruhigend und oft erdrückend.
Die neuesten Forschungen, mit denen ich mich beschäftigte, gingen mit einer Fülle düsterer Vorhersagen über unsere Zukunft auf der Erde einher. Zur gleichen Zeit verfasste ich jedoch einen Text über unsere Triumphe, die Genialität des Menschen, unsere Erfindungen und Entdeckungen, darüber, wie Forscher auf neue Methoden stießen, um Nutzpflanzen zu optimieren, Krankheiten zu bekämpfen, Strom zu transportieren und völlig neue Materialien herzustellen. Wir sind eine unglaubliche Naturgewalt. Der Mensch hat die Macht, den Planeten weiter aufzuheizen oder ihn abzukühlen, Arten auszumerzen und ganz neue zu kreieren, das Gesicht der Erde umzugestalten und ihre Biologie zu bestimmen. Kein Teil dieses Planeten bleibt vom menschlichen Einfluss unberührt – wir haben Naturzyklen außer Kraft gesetzt und die physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse der Erde verändert. Wir können neues Leben in der Retorte erschaffen, ausgestorbene Arten wiederauferstehen und aus Zellen neue Körperteile wachsen lassen oder mechanische Ersatzteile für diese konstruieren. Wir haben Roboter erfunden, die uns als Sklaven dienen, Computer, die als Außenposten unseres Gehirns fungieren, und ein neues Ökosystem aus Netzwerken, das der Kommunikation dient. Wir haben unseren evolutionären Pfad dank medizinischer Errungenschaften so manipuliert, dass diejenigen, die normalerweise im Säuglingsalter sterben, gerettet werden. Die Grenzen, die anderen Spezies gesetzt sind, haben wir durch die Schaffung künstlicher Umgebungen und externer Energiequellen überwunden. Ein 72-jähriger Mann von heute ist so vital wie ein 30-jähriger Höhlenmensch. Wir besitzen übernatürliche Kräfte: Wir können ohne Flügel fliegen und ohne Kiemen tauchen, todbringende Krankheiten überstehen und nach dem Tod wiederbelebt werden. Und wir sind die einzige Art, die den Planeten verlässt und unserem Mond einen Besuch abstattet.
Die Erkenntnis, dass wir eine solch globale Macht ausüben, erfordert einen ganz außergewöhnlichen Perspektivwechsel. Sie kehrt das wissenschaftliche, kulturelle und religiöse Gedankengut, das unseren Platz in der Welt, in der Zeit und in Relation zu allen anderen bekannten Lebensformen definiert, ins Gegenteil um. Bis ins Mittelalter glaubte man, der Mensch sei der Mittelpunkt des Universums. Im 16. Jahrhundert kam dann Nikolaus Kopernikus, der der Erde ihren Platz zwischen mehreren Planeten zuwies, die um die Sonne kreisten. Und im 19. Jahrhundert identifizierte Charles Darwin den Menschen als lediglich eine Spezies unter vielen – ein Zweiglein nur am gewaltigen Baum des Lebens. Doch nun hat sich erneut ein Paradigmenwechsel vollzogen: Der Mensch ist nicht länger eine Spezies unter vielen. Wir sind die Ersten, die bewusst die Biologie und Chemie der Erde umgestalten. Wir sind zu den Herren unseres Planeten geworden und bestimmen das Schicksal des irdischen Lebens.
Das letzte Mal trat unser Planet vor etwa 10.000 Jahren in ein neues geologisches Zeitalter ein, was sich grundlegend auf das Überleben und den Erfolg unserer Spezies auswirkte. Mit dem Ende der letzten Eiszeit begann eine neue Epoche der Erderwärmung, die man als Holozän bezeichnet. Die Eisdecke zog sich bis zu den Polen zurück und die Tropen wurden feuchter. Die Menschen verließen ihre Höhlen und profitierten zunehmend von den neuen Lebensbedingungen: Gräser sprossen, und diejenigen mit nahrhaften Samen, wie Weizen und Gerste, ließen sich anbauen. Überall auf der Welt siedelten sich Menschen in größeren Gemeinschaften an und produzierten ihre Nahrung selbst, statt sie nur zu jagen und zu sammeln. Diese Stabilität führte zur Entwicklung von Kultur und Zivilisationen – unsere Spezies nahm zahlenmäßig zu und war so erfolgreich, dass sie sich über sechs Kontinente ausbreitete. Die Auswirkungen des Anthropozäns werden ebenso tiefgreifend sein.
Den Begriff Anthropozän prägte der Nobelpreisträger Paul Crutzen. Wie der niederländische Chemiker mir erzählte, war er bei einer wissenschaftlichen Tagung zu der plötzlichen Einsicht gelangt: All die biophysikalischen Veränderungen, über die die Forscher diskutierten, „bedeuteten, dass wir uns nicht mehr im Holozän befanden. Der Planet hatte sich zu weit von den Bedingungen entfernt, die man für das Holozän als normal betrachten würde.“ In einem Artikel in der Zeitschrift Nature von 2002 plädierte Crutzen für die Einführung des Begriffs Anthropozän, und dieser fand im Lauf der letzten zehn Jahre in der Wissenschaftsgemeinde immer stärkere Verbreitung.7 Mittlerweile hat die British Geological Society den langsamen Prozess in Gang gesetzt, das neue Zeitalter formal anzuerkennen und zu erfassen. Grundlage dafür sind die vom Menschen hervorgerufenen Veränderungen der Biosphäre, die sich in der Geologie, Chemie und Biologie unseres Planeten für Tausende oder Millionen von Jahren niederschlagen werden.8 Dazu gehören eine geänderte Flächennutzung, wie die Umwandlung von Wald in Ackerland, oder auch radioaktiver Fallout. Die Übergänge zwischen geologischen Zeitaltern sind unscharf und ziehen sich häufig über Tausende von Jahren hin; dennoch versuchen Wissenschaftler, sie anhand von Streifen im Gestein überall auf der Welt zu ermitteln. Die Geologen werden festlegen müssen, wann das Zeitalter begonnen hat – war es vor Tausenden von Jahren, als der Ackerbau einsetzte, oder vor einigen Generationen mit der Industriellen Revolution oder in den 1950er-Jahren zu Beginn der Great Acceleration? Diese Festlegung wird davon abhängen, welche Marker die Geologen wählen, um das Anthropozän zu definieren, etwa die Atombombentests von 1949 oder den Anstieg der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre vor rund 150 Jahren.
Doch während die Geologen mit dem begrifflichen Problem ringen, eine Ära paläontologisch zu datieren, deren Paläontologie und Geologie noch im Entstehen begriffen ist, hat das Anthropozän bereits die Mauern der akademischen Welt überwunden und Einzug in die Gesellschaft gehalten. Die Vorstellung, dass die Menschheit einen buchstäblich globalen Einfluss ausübt, hat das Interesse von Künstlern und Dichtern, Soziologen und Umweltschützern, Politikern und Anwälten geweckt. Wissenschaftler verwenden den Begriff, um vielfältige Veränderungen für unseren Planeten und das Leben auf ihm zu beschreiben. Und im Geiste dieser weiteren Definition – und weil zunehmend Einigkeit darüber besteht, dass wir dabei sind, die Grenze zum Zeitalter des Anthropozäns zu überschreiten – schreibe ich dieses Buch.
Woran also lässt sich das Anthropozän festmachen – was sind die Anzeichen für den Übertritt in ein neues geologisches Zeitalter? Die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre liegt fast um 50 Prozent über dem Mittelwert des Holozäns. Die industriellen und privaten Emissionen von Treibhausgasen erwärmen weltweit die Atmosphäre, verändern das Klima und bringen Wetterverläufe aus dem Takt.9 Die Auswirkungen des Klimawandels sind global und betreffen mehr oder weniger stark alle Lebewesen auf der Erde. Neuerdings sammeln sich in der Atmosphäre zudem eine Reihe weiterer chemischer Verbindungen an. Auf den Bergen schmelzen die Gletscher, die sie Jahrtausende lang bedeckt haben, was zur Folge hat, dass sich das Gestein schneller zersetzt – und für den Bergbau zugänglich wird. Flüsse werden umgeleitet, aufgestaut, ausgetrocknet und transportieren sehr viel weniger Sediment. Natürliche Landschaften werden zu Ackerland, und durch die von uns zugesetzten Düngemittel hat der weltweite Gehalt an freiem Stickstoff massiv zugenommen. Dieser Stickstoff hat die Ernteerträge erhöht, was einen starken Zuwachs der menschlichen Populationen zur Folge hatte. In den letzten 50 Jahren hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt, und das hat weitreichende Konsequenzen für den gesamten Planeten. Die Meere versauern immer mehr, weil sie unsere CO2-Emissionen aus der Atmosphäre aufnehmen, und ihre Artenvielfalt nimmt ab, weil Korallen sterben und die Fischbestände wegen Überfischung, Umweltverschmutzung und steigenden Wassertemperaturen schrumpfen. Das Eis der Arktis schmilzt und Küsten erodieren, weil Stürme an Häufigkeit und Stärke zunehmen, der Meeresspiegel steigt und schützende Sedimente, Mangroven und Feuchtgebiete verschwinden.
Wüsten breiten sich über Savannengebiete aus, Wälder vertrocknen und werden abgeholzt. Wildtiere werden gejagt und sterben aufgrund von Habitatverlust, Klimawandel und invasiven Arten. Das sechste Massensterben in der Geschichte unseres Planeten rückt näher. Zur gleichen Zeit fördern wir die Verbreitung unserer domestizierten Arten und verschleppen andere gedankenlos über die ganze Welt. Wir beuten den Planeten aus durch Bergbau, Ölbohrungen und die Förderung anderer Rohstoffe und vermüllen ihn mit neuartigen chemischen Verbindungen und Materialien, Geräten und Objekten, die auf natürlichem Wege niemals hätten entstehen können. Und wir bauen riesige Städte aus Stahl, Beton und Glas, die den Nachthimmel erhellen und noch vom Weltall aus zu sehen sind.
Welche Auswirkungen hat der Wandel unseres Planeten eigentlich auf uns Menschen? Schließlich hat unsere Evolution im Holozän stattgefunden, wir sind an ein entsprechendes Leben angepasst und die neuen Veränderungen erfolgten außerordentlich schnell. Der Wandel, dem wir unseren Planeten unterworfen haben, hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir zu dieser Superspezies werden konnten – und zugleich war er eine Folge unseres kometenhaften Aufstiegs. Die Umgestaltung der Erde hat uns in die Lage versetzt, in größerem Wohlstand, länger und gesünder zu leben, und das selbst bei größeren Bevölkerungszahlen mit mehr Komfort als je zuvor. Dennoch sind Menschen, zumindest bislang, ein Teil der Natur – wir haben uns auf diesem Planeten entwickelt, wir bestehen aus Zellen, wir atmen Luft, trinken Wasser und essen Proteine. Wir benötigen die biologischen, chemischen und physikalischen Bestandteile unseres Planeten als Grundbausteine für alles, einschließlich unserer gesamten Materialien, Treibstoffe, Nahrungsmittel und Kleidungsstücke, sowie zum Reinigen unserer Luft, zur Aufbereitung unseres Wassers und zur Beseitigung unseres Mülls. Die wachsende Weltbevölkerung und unser Lebensstil in dieser neuen Menschenwelt machen uns abhängiger denn je von den Ressourcen und Prozessen unseres Planeten. Wenn wir jedoch fortfahren, die Erde zu verändern, wird sie immer weniger in der Lage sein, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Damit beschwören wir Krisen herauf, die mit der Verfügbarkeit von Süßwasser, der Erzeugung von Lebensmitteln, dem Klimawandel und den „Ökosystemdienstleistungen“ zusammenhängen, jenen unermesslichen Funktionen, die die Biosphäre erfüllt und mit denen sie unser Überleben sichert.
Im Anthropozän haben wir bereits damit begonnen, globale Prozesse aus dem Gleichgewicht zu bringen. In einigen Fällen könnten schon winzige weitere Veränderungen desaströse Folgen für die Menschheit haben; in anderen bleibt uns noch eine kleine Gnadenfrist, bevor uns die Konsequenzen ereilen. Meistens gibt es dabei eine Art Tipping-Point (einen Umschlagspunkt) – ist er einmal überschritten, wird es nahezu unmöglich, Bedingungen, wie sie im Holozän herrschten, wiederherzustellen. So könnte das Schmelzen der Polkappen einen Tipping-Point erreichen, an dem die Schmelze unkontrollierbar wird und der Meeresspiegel um mehrere Meter ansteigt. Die Angst vor großen Umwälzungen wie dieser hat Wissenschaftler zur Formulierung von „planetaren Grenzen“ veranlasst – biophysikalischen Grenzwerten für die Sicherheit des Menschen, wie etwa das Ausmaß der veränderten Flächennutzung und der Verlust der Biodiversität –, die teilweise bereits überschritten sein sollen.10 Wenn wir die relative Sicherheit der stabilen Lebensbedingungen des Holozäns hinter uns lassen, werden wir uns unweigerlich nie da gewesenen Herausforderungen gegenübersehen.
Entscheidend ist hier, wie wir mit den Folgen umgehen. So mag es erstrebenswert gewesen sein, an dem international festgelegten „sicheren“ Grenzwert für die Erderwärmung von zwei Grad Celsius (über dem Wert vor Beginn der Industrialisierung) festzuhalten, doch zum Ende dieses Jahrhunderts wird dieser Wert so gut wie sicher übertroffen. Demnach haben wir es mit der neuen Frage zu tun, wie unser Leben in der wärmeren Welt des Anthropozäns aussehen wird.11 Wir haben schon immer Ökosysteme an unsere Bedürfnisse angepasst und werden das vermutlich auch in Zukunft tun. So beschränkt sich unser Lebensraum nicht auf die Tropen, weil wir Kleidung und andere Möglichkeiten erfunden haben, um uns warm zu halten, genau wie uns die Klimatechnik Kühlung verschafft. Wir haben den Planeten im Hinblick auf unsere Überlebenschancen in vielerlei Hinsicht verbessert – zum Beispiel, indem wir die nächste Eiszeit in Schach halten –, doch wir haben seine Lage auch verschlechtert. Einige dieser negativen Folgen können wir durch technischen Fortschritt, Migration oder andere Anpassungen überwinden. Andere werden wir umkehren müssen. Und mit noch anderen müssen wir zu leben lernen.
Die gute Nachricht lautet, dass sich einige Probleme bereits kontrollieren lassen. Die Umweltverschmutzung wird in vielen Ländern durch Gesetze und technische Verbesserungen eingedämmt; das internationale Atomteststoppabkommen begrenzte die radioaktive Verschmutzung. Mit dem Montrealer Protokoll, das die Verwendung ozonzerstörender Chemikalien untersagt, hat sich auch die Ausdehnung des Ozonlochs verlangsamt. Entscheidend ist, dass auch die Bevölkerung weniger rasch wächst und in vielen Ländern mittlerweile negative Werte aufweist.12 Andere Probleme hingegen sind nach wie vor zunehmende und ernste Bedrohungen. Die Wissenschaft kann zwar möglicherweise die neuralgischen biophysikalischen Punkte benennen, aber sie kann uns nicht sagen, wie darauf zu reagieren ist – darüber muss die Gesellschaft entscheiden. Der Mensch ist nicht länger nur ein Tier unter anderen. Es gibt spezifische Menschenrechte, deren Einhaltung durch Entwicklung zu gewährleisten ist, beispielsweise der Zugang zu sanitären Anlagen und Elektrizität, ja sogar zum Internet.13 Soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz sind eng miteinander verwoben; auf welche Art und Weise Arme reicher werden, wird das Anthropozän nachhaltig prägen.
Der gewaltige Einfluss, den wir im Anthropozän auf unseren Planeten ausüben, ergibt sich unmittelbar aus den immensen gesellschaftlichen Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind und die unser Leben als Spezies betreffen. Zu ernähren ist heutzutage eine riesige Weltbevölkerung, wobei wir aber nicht einfach die Zahl kleiner Jäger-und-Sammler-Gemeinschaften vervielfacht haben. Über die Hälfte der Menschen lebt heute in Großstädten – künstlichen Konstrukten aus dicht gedrängten, zweckmäßigen Lebensräumen. Sie fungieren als riesige Fabriken, die Pflanzen, Tiere, Wasser, Gestein und Minerale des Planeten konsumieren. Die Menschheit funktioniert als industrielles Unternehmen und braucht aktuell ständig 18 Terawatt Energie, 9 Billionen Kubikmeter Süßwasser pro Jahr sowie 40 Prozent der weltweiten Landfläche für die Erzeugung von Nahrung. Sie hat sich zu einem Superorganismus entwickelt, zu einem Geschöpf des Anthropozäns, einem Produkt der Industrialisierung, des Bevölkerungswachstums, der Globalisierung und der Revolution in der Kommunikationstechnologie.
Die Intelligenz, Kreativität und Soziabilität dieses Menschheits-Superorganismus erwächst aus der Vernetzung aller Menschengehirne, einschließlich jener der Vergangenheit, die ein kulturelles und intellektuelles Erbe hinterlassen haben, sowie der künstlichen Gehirne unserer technischen Erfindungen, etwa Computerprogrammen und Online-Nachschlagewerken wie Wikipedia. Die Menschheit ist ein globales Netzwerk von Zivilisationen mit einem Wissensstrom, der zum Schutz der Menschen bereits kanalisiert wurde. Und so wie bei einem Schwarm von Staren, der urplötzlich geschlossen die Richtung wechselt, ist es schwierig, das Verhalten der Menschheit vorherzusagen. Auch wenn er eine enorme planetare Macht ist, lässt sich unser Superorganismus von Individuen lenken und sein Verhalten von den Gesellschaften in ihm formen – und Problemlösungen finden sich oft auf lokaler Ebene. Wir sind im Grunde eine Ansammlung chemischer Verbindungen, die andere Chemikalien recyceln, und die Biosphäre ist in der Lage, 10 Milliarden von uns zu ernähren. Die Schwierigkeit besteht darin, dies im Rahmen sozialer und ökologischer Beschränkungen zu tun.
Die Selbstwahrnehmung, die mit der Erkenntnis einhergeht, dass wir als planetare Macht großen Einfluss ausüben, fordert zudem von uns, dass wir unsere neue Rolle hinterfragen. Sind wir einfach nur ein Teil der Natur, der das tut, was die Natur tut – sich bis an die Grenzen der ökologischen Belastbarkeit reproduzieren, bis die Populationsblase platzt? Oder sind wir die erste Art mit der Fähigkeit zur Selbstbestimmung, die ihre natürlichen Triebe, ihre Auswirkungen und ihre Umwelt modifizieren kann, sodass wir auch in Zukunft auf diesem Planeten leben können? Und was ist mit unserem Verhältnis zum Rest der Biosphäre? Sollten wir sie – wie jede andere Spezies – als Ressource betrachten, die sich im Dienste unserer Vergnügungen und Bedürfnisse gnadenlos plündern lässt, oder verleiht uns unsere neue globale Macht ein Gefühl der Verantwortung für den Rest der Natur? Die Gestaltung unserer Zukunft hängt davon ab, wie gut wir diese beiden entgegengesetzten und doch verwobenen Kräfte miteinander vereinbaren können.
Im Leben jedes Kindes kommt irgendwann der Moment, in dem es erkennt, dass die Nahrung, die es genießt – das Fleisch, das es isst – von einem Tier stammt. Dass das süße, flauschige Lebewesen, das es streichelt, auch zum Essen da ist. Manche Kinder werden dann zum Vegetarier und essen nie wieder Fleisch. Die meisten aber nicht. In diesem Moment der Menschheitsgeschichte sind wir wie Kinder, die erkennen, dass die Dinge, die wir in unserem Leben genießen und von denen wir abhängig sind, von Elektrizität über Wasser bis zu Konsumgütern, allesamt ökologische und soziale Konsequenzen haben. Die Art und Weise, wie wir uns mit diesem Problem auseinandersetzen, wird den Verlauf des Anthropozäns in den kommenden Jahren bestimmen. Wir sind Pioniere dieser Ära, aber wir verfügen über ein überragendes wissenschaftliches Verständnis sowie eine exzellente Kommunikation und Vernetzung, was die Zusammenarbeit im Denken fördert. In der Post-Natur-Phase des Anthropozäns werden wir entweder die Natur bewahren müssen oder ihre Tricks künstlich imitieren. Ich wollte herausfinden, wie das gelingen kann, und musste dafür meinen Schreibtisch in London verlassen.
So wie uns Längen- und Breitengrade alles und nichts über einen Ort verraten, schienen mir auch die von Forschern produzierten abstrakten Zahlen und Diagramme nichts über die neue Welt, in der wir leben, mitzuteilen. Überdies gibt es keinen anderen Forschungsbereich, dessen wissenschaftliche Ergebnisse in der Gesellschaft dermaßen umstritten sind. Die Ansichten über Lösungen für die Probleme des Anthropozäns sind häufig extrem – viele Leute zweifeln sogar anerkannte wissenschaftliche Fakten an. Das faszinierte mich, und ich wusste, dass ich unseren Planeten in dieser einschneidenden Phase seiner Geschichte erkunden wollte. Ich hatte das Gefühl, dass die wichtigsten Personen, die ich noch nicht kannte, die menschlichen Versuchskaninchen dieser neuen Epoche waren – diejenigen, die die Auswirkungen jener veränderten Welt bereits zu spüren bekommen. Und ich wollte wissen, wie sie damit umgehen. Ich wollte hinter die Schlagzeilen blicken, die Flut an Statistiken, die Computermodelle, die Wie-du-mir-so-ich-dir-Argumente zwischen Umweltaktivisten und Unternehmen, die Schockstrategien und abgegriffenen Slogans. Ich wollte für mich selbst die Wahrheit herausfinden, die Situation vor Ort kennenlernen, persönlich mit den Protagonisten dieser Ära reden, mit meinen eigenen Augen die Realität des Anthropozäns sehen.
Ich beschloss, meinen Job in London zu kündigen, und begab mich auf eine Erkundungsreise, die mich an einem entscheidenden Moment der Erdgeschichte, auf der Schwelle zu diesem außergewöhnlichen neuen Menschenzeitalter, um den Globus führen sollte. Ich sah mir an, wie Menschen lernen, die Aufgaben der Natur zu übernehmen. Ich fand Menschen, die künstliche Gletscher schaffen, um ihre Nutzpflanzen zu bewässern, die künstliche Korallenriffe bauen, um ihre Inseln zu schützen, und künstliche Bäume konstruieren, um die Luft zu reinigen. Ich traf auf Menschen, die versuchen, bedeutende Überreste der Natur im Anthropozän zu bewahren, und andere, die versuchen, an einigen Orten die alte Welt wieder erstehen zu lassen. Und ich traf Menschen, die nach einer Lösung für die große Frage suchen: Wie können 10 Milliarden Menschen angenehmer leben, mit genügend Nahrung, Wasser und Energie, und wie reduzieren wir zugleich die Folgen unseres Handelns für die Natur und ihre Fähigkeit, die für uns überlebenswichtigen Prozesse zu gewährleisten?
Auf meinen Reisen über unseren sich wandelnden Planeten betrachtete ich die Welt, die wir erschaffen, und fragte mich, welche Art von Anthropozän wir anstreben. Werden wir lernen, die von uns erzeugte neue Natur zu lieben, oder um die alte trauern? Werden wir uns bereitwillig mit dem begnügen, was wir haben, oder werden wir nun eisfreie Landstriche für uns erobern? Werden wir neuartige Nahrung zu uns nehmen, neue Nutzpflanzen anbauen, neue Tiere züchten? Werden wir den Wildtieren in dieser Menschenwelt noch einen Platz einräumen? Ich habe das Anthropozän aus verschiedenen Blickwinkeln wahrgenommen und die Pioniere kennengelernt, die aushandeln, welchen Weg die Entwicklung durch die komplexe Welt unserer gemeinsamen Biosphäre nehmen wird. Dieses Buch ist eine Reise um unsere neue Welt, eine Sammlung von Geschichten über bemerkenswerte Menschen in einer außergewöhnlichen Zeit. Es ist die Geschichte genialer Erfindungen und unglaublicher Landschaften, und es erzählt, wie wir auf Gedeih und Verderb von Mutter Erde Besitz ergriffen haben.
Die Menschheit sieht sich der größten Herausforderung seit 10.000 Jahren gegenüber. Und ich bin losgezogen, um zu entdecken, ob und wie unsere Spezies überleben wird.