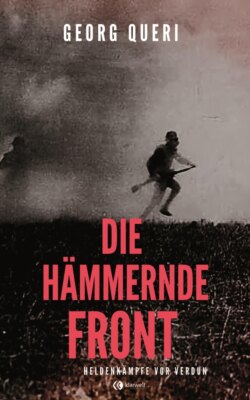Читать книгу Die hämmernde Front - Georg Queri - Страница 7
Quartier an der Maas.
ОглавлениеIm Felde, 27. April.
ach zehn Uhr abends erscheinen die großen Fledermäuse des Krieges über der Maaslandschaft. Der Alarm geht ihnen voraus, und Dorf um Dorf blendet sich ab, die Lichter in den Quartieren erlöschen, und die Scheinwerfer leuchten auf und zeichnen helle Straßenzüge in den Himmel. Die Sirenen heulen so durchdringend, dass das heranziehende Rattern der Motore verstummen muss. Jetzt hämmern schon die Maschinengewehre des Nachbardorfes, und hoch oben sprüht ein berstendes Schrapnell Funken. Und wie farbige Seifenblasen tropfen die Leuchtkugeln von Raketen ab in die Tiefe.
Tak-tak-tak-tak — das Nachbardorf. Und wieder ein Dörfchen: tak-tak-tak-tak. Jetzt schlagen auch die beiden Maschinengewehre vor meinem Fenster an, und es ist nicht anders, als ob von Dorf zu Dorf kläffende Hunde Zwiesprache halten wollen. Dann wieder der hohle Klang platzender Schrapnelle und die stärker hallende Detonation einer Bombe. Die Häuser und die Fenster sind erschrocken und beben und klirren, und man wundert sich, dass das Ohr allmählich den Kriegslärm unbefangen aufnimmt, die Geräusche unterscheidet und trennt und fast den Genuss des groben Lärmens kosten will.
Jetzt pfeifen Gewehrgeschosse durch die Straße und picken an die Mauern — der Mann in der großen Fledermaus hat seine Bomben verschleudert und fegt mit seinem Maschinengewehr nach. Vielleicht gehen Patrouillen? Vielleicht findet die Kugel durchs Fenster einen müden Schläfer? Pft-pft-pft, wie ein pustender Motor beim Anwerfen. Pft-pft-pft. Fünfundzwanzig Geschosse schwirren nacheinander in die Tiefe und ticken unten auf, spritzen auf der Straße und klatschen im Bach. Dann Pause. Der Mann in der großen Fledermaus setzt einen neuen Patronenstreifen ein, dann tickt er wieder. Er ist schon weit weggeflogen. Vielleicht sucht er eine Kolonne auf der Straße? Und bellen jetzt nicht ein paar Karabiner hinauf?
Alle Tage wiederholt sich das. Wer regt sich noch darüber auf? Die Eindrücke schwächen sich ab, und was dem plötzlich vom tiefen Deutschland hierhergekommenen Menschen ein kräftiges, vielleicht tolles Erlebnis bedeuten würde, rüttelt hier nur mehr Erinnerungen auf: etwa an einen Dorfzirkus, der mit Tamtam und Schießerei beim Schein von Fackeln und Raketen Künste übt, die die Nacht wilder und rarer machen muss. So sehr hat der Krieg das Schreckliche gehäuft, dass der nächtliche Flieger nicht mehr als eine grellere Figur in den großen Totentanz eintreten kann. Einmal, zweimal, dreimal in der Nacht weckt der Lärm. Man sieht verdrossen durchs Fenster und blickt schließlich interessierter dem nächtlichen Scheinwerferspiel nach. Breite Lichtbündel zucken Himmelauf, Himmelab. Pfumm — da fiel eine Bombe. Wenn sie nur nicht das Lazarett . . . Die Bombenwerfer arbeiten nicht allzu peinlich. Warum griffen sie in diesen Nächten wieder Dun an? Ein Lazarett am anderen, nichts weiter in dem Dorf. Ein armer fiebernder Mensch wurde in seinem Bett zerrissen. General Bazêlaire wird‘s bedauern; so brutal manche seiner Befehle klingen — das wird er doch nicht wollen wie?
*
Ich traute gestern meinen Augen kaum: ein Unteroffizier geleitete einen alten Herrn durch die Straßen, einen schwarzgekleideten Mann mit schwarzem Regenschirm.
Der Fahrer auf meinem serbischen Korbwägelchen riss die Augen auf und beguckte den fremden Menschen wie etwas nie Gesehenes. „Was will denn der da?!“ Ich zuckte die Achseln, ein Denkmalprofessor vielleicht, vielleicht ein Nationalökonom. In großen Zwischenräumen schickt eine Inlandsfrage so jemanden hinaus.
Jetzt war der alle Mann an uns vorüber. Er hatte nicht rechts und nicht links gesehen. Die zerfetzte Kriegslandschaft und das unvergleichliche Lagerbild ließen ihn stumpf. Er ging gedrückt und fast willenlos mit dem Unteroffizier und bog in den Soldatenfriedhof ein, in den ihn einer Mutter verzweifelter Willen gejagt hatte.
Ein Elend. „Hans, fahr weiter!“ Und mein Fahrer ließ die russischen Füchse wieder traben. „Jetzt woaß ich‘s“, sagte er nachdenklich, „jetzt woaß ich‘s, was der will.“
Dann schwieg er und spitzte die Lippen, nicht zum Pfeifen, wie er‘s sonst auf seinem Wagenbänkchen gern tat.
Ich weiß: jetzt war dieser reale Bauernknecht mit seinen ganzen Gedanken genauso ruckartig in seinem Bauernhof im Chiemgau eingekehrt, wie ich in meinem Häuschen am See. Du harte Zeit.
Zu wissen, wie die zu Hause das Verwaistsein nicht ertragen können. Keinen Grabhügel haben, um ihn zu pflegen und auf Schwarzveilchen zu weinen.
Wie diesem alten Mann jeden Tag das Elend der Mutter ins Herz geschnitten haben musste! Und eines Tages reiste er. Weite Fahrt. An Tausenden von kleinen Kreuzen vorbei in ein Land, in dem der Tod noch immer hungrig brüllte.
Der Tag ist sommerblau und warm und schön. Ich werfe von der Höhe noch einen Blick auf den Soldatenfriedhof: jetzt wird der alte Mann an dem Grabe stehen. Jetzt greifen die Spaten an. Dann wird er ihn sehen.
Unsere Rosse machen einen erschreckten Sprung vor einem Granattrichter und hindern mich, den Schrei zu hören, den meine Phantasie mir hatte vorgaukeln wollen.
Harte, harte Zeit.
*
Es toben draußen wieder die Quartiergranaten. Volles lautes Dröhnen, fast als ob sie am Ortseingang niedergezischt wären. Dabei sind die Einschläge reichlich fünf Kilometer von meinem Quartier entfernt; aber das Kaliber 34 der schweren französischen Schiffsgeschütze gibt der Schallwelle auf große Weiten noch Druck und Kraft, und die Häuser machen hier noch leise die Erschütterung mit, die drüben an einem ganzen Orte rüttelt.
Jetzt weiß ich, dass die kleine Bäuerin nebenan in der Kammer wieder zu beten beginnt. Sie ist eine von den wenigen, die hier noch zurückgeblieben sind. Sie wäscht wie die anderen Frauen und Mädchen für die Soldaten und verdient gut, reichlich mehr sogar als im Frieden. Sie hat sich einigermaßen an den Krieg gewöhnt und zeigte nur jüngste Woche noch schwach die Krallen, als man einen ihrer Kessel für die französischen Gefangenen entleihen musste. „Die wollen doch auch essen, Ihre Landsleute, Madame!“ - „Aber warum denn in meinem Kessel kochen!?“ Dann gab sie das Küchengerät der höheren Gewalt.
Der Unteroffizier ging kopfschüttelnd zu seinen Kameraden und zeigte die Spuren von Madames Fingernägeln. „Warum hast du dich denn nicht gewehrt!?“ „O mei Gott, geg‘n a schwaches Weibsbild was willst denn da mach‘n. Und den Kess‘l Hab ih ja.“
Die Kriegsschicksale der Madame Verjus interessierten mich; aber sie erzählt nicht gern von den Zeitläuften und sagt mir, dass ihr Sohn Leon in Deutschland gefangen sei. Und die Tochter sei während des Krieges gestorben, die noch nicht ganz vierzehnjährige Germaine. „Krieg oder Krankheit, Madame Verjus?“ – Krieg und Krankheit, mein Herr.“
Mehr war nicht herauszubringen. Aber ich ging dem Falle nach und fragte Soldaten, die den Maasübergang vom ersten September Vierzehn mitgemacht hatten. Die Franzosen wurden damals rasch zurückgetrieben und konnten erst auf der Höhe von Montsaucon wieder Fuß fassen. Die Einwohner der Orte, durch die ihre Flucht zog, hatten sie nach Möglichkeit mitgenommen; nur ein kleiner Teil der Bevölkerung war Freund wie Feind ausgewichen und war in die Wälder geflüchtet. Madame Verjus aber blieb resolut in ihrem Häuschen. Leon, der damals neunzehnjährige Bäckergeselle, musste auf ihr Geheiß in den Keller gehen, und sie ließ ihn erst recht nicht ans Licht, als die Deutschen in dem Dorf Quartier machten. Das ganze Häuschen war bis unters Dach voll beseht, und es war für den jungen Mann unmöglich, zu entkommen, ohne über die Strohlager von mehreren Offizieren zu steigen. Also verhielt er sich in seinem Keller mäuschenstill und sein Schwesterchen Germaine versorgte ihn mit Nahrung.
Da erkrankte die Kleine. Der Stabsarzt stellte Typhus fest und verlangte völlige Räumung des Hauses bis zur ausreichenden Desinfektion. Dass Madame Verjus allen erdenklichen Widerstand leistete, muss ihren Mutterinstinkten zugute gerechnet werden. Sie musste zwangsweise entfernt werden, und eine eingehende Untersuchung des Hauses ließ dann den furchtsamen hungrigen Jungen entdecken.
Und Germaine starb an nichts anderem als an der Bruderliebe, und Leon kam in ein deutsches Gefangenlager. „Gut geht‘s ihm“, sagt Madame Verjus. Und ist noch froh, eines von ihren Kindern gerettet zu haben.
Vor der Kirche stand heute wieder das übliche Häuflein Leichtverwundeter. Nur Leichtverwundete aber man müsste so ein Bild mit aller Genauigkeit festhalten und aller noch neutralen Welt vor Augen führen: über und über mit Lehm bekleisterte Menschen, hockend, kauernd oder stehend, müde, hundemüde. Die Hälfte nur hat Stiefel, einige habe, Verbände an beiden Füßen, die anderen haben rechts oder links noch den einen Stiefel, den ihnen der Lehm beließ, der andere Fuß steckt in Gaze und Watte,
Beide Füße erfroren. Ein Fuß erfroren, der andere zerschunden und offen. Darmkrankheiten. Eine zerschossene Hand. Leichte Kopfverletzungen. Fleischwunde in Arm oder Bein. Streifschüsse, Quetschungen. Notverbände mit rostbraunen Blutsickerungen.
Wenn die Leute in den sauberen korrekten Betten liegen werden, wird man ohne die Beklemmungen des großen Mitleidens durch den Krankensaal gehen können. Er sieht so freundlich und beruhigend aus, die Ordensfrauen sind huschende Güte. Und die besonnenen fleißigen Arzte. Da ist gute Hut und Heilung.
Aber wenn sie da draußen stehen und von Schmutz und Lehm starren, kann man die Geschichte ihrer Leidenswege lesen, ohne dass die Leute den schweigsamen Mund öffnen müssen. Man fragt hier nicht viel: man sieht. Man weiß den Weg, den sie gehen: durch die Gräben im Wald von Avocourt. Die Sonne strahlt schon drei, vier Tage über die zerschossenen Baumstümpfe und saugt gierig das braungelbe Wasser aus den langen Lehmbottichen. Und langsam wird der Lehmgrund wieder dick und feist und zäh. Er klebt sich wie Leim an die Sohlen, dann an die Knöchel. Er ist noch etwas breiig, und du sinkst bis zum Knie mit dem einen Bein, mit dem anderen bis zur Hüfte. Du stolperst und fällst und bis über die Ellenbogen rutschen deine sich spreizenden Arme in die klebrige Masse. Behutsam ziehst du dich Zoll um Zoll wieder heraus. Die Brust stemmst du flach vor, um dich breiter und fester zu stützen und die Beine und Arme loszubringen.
Und endlich stehst du wieder. Wo sind deine Stiefel? Bücke dich vorsichtig und suche und ziehe. Aber der Lehm fasst dich wieder und reißt dich tiefer, bis du ihm deine Stiefel lässt und barfuß deinen Weg weiter kämpfst.
Da vorne ist etwas Waldboden, nicht ohne Gefahr zu betreten, aber immerhin ein etwas fester Boden, auf dem sich‘s auftreten lässt.
Eine prächtige Sache, so aufzutreten wie auf einer Straße, und nicht hinabgezogen zu werden. Stehen, wieder stehen! Mit beiden breiten Beinen zumal eine Minute lang zu stehen! Zwölfhundert Meter sind es nur mehr bis dahin. Wie lange, nach der Uhr gemessen? Vierundeinehalbe Stunde hast du gebraucht . . . Rast. Breit auf dem Boden liegen, der ganzen Länge nach. Ach, wie ist die Sonne warm. Ein Küglein pfeift: pft! Hihihihaha! Ein Küglein!
Was will denn das kleine Küglein in diesem Revier. Da vorn gab‘s den kurzen Tag und die lange Nacht Trommelfeuer. Wumm! Ei, da ist sie ja schon wieder, die Granate. Achtundzwanzigerin, eine ganz grobe Nummer, schlägt durch wie der Satan.
Was will sie denn da hinten im Wald? Keine Menschenseele da. Und wenn sie den Lehm noch einmal so hoch aufspritzt, da kann sie keinen Kameraden zudecken und verscharren.
Weitergehen, weitergehen. Vor dem Wald ist die große, große Wiese. Tief unter ihr muss die Hölle sein, zu der sie gehört. Der Teufel kommt alle Tage heraus und fährt sie ein dutzendmal mit seinen Pflügen durch. Er zischt, saust, gurgelt, winselt und höhnt. Dann lässt er die Bässe aller Höllen brummen und pflügt und reißt die Scholle und wirft und schneidet und wütet.
Über diese Wiese musst du gehen.
—— Das sind die Leidenswege dieser lehmbekleisterten Menschen. Vielleicht schlimmer, als ich sie beschrieben habe.