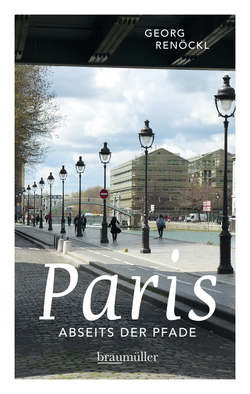Читать книгу Paris abseits der Pfade (Jumboband) - Georg Renöckl - Страница 13
Der Königsweg: Teil 2 Ins dunkle Herz von Paris
ОглавлениеAn den Bouffes du Nord gehe ich heute nur vorüber, sollten Sie aber die Gelegenheit dazu haben, besuchen Sie eine Vorstellung dieses magischen Theaters, das so wirkt, als habe es Peter Brook mit seinem Team in seinem Verfall eingefroren. Für mich geht es unter der in diesem Abschnitt überirdisch verlaufenden Linie 2 der Métro weiter – die Gleise der Nord- und Ostbahn sowie der Canal Saint-Martin machten einen herkömmlichen Tunnel technisch unmöglich. Gut fürs Stadtbild: Die Gusseisensäulen, die Bögen und die unzähligen Nieten dieser überirdischen Bahn zeugen selbstbewusst von der technischen und ästhetischen Meisterleistung, die der Bau damals darstellte.
Über die Nordbahnbrücke spaziere ich in Richtung Rue de Jessaint und weiche einmal mehr von der royalen Direttissima ab, die mich eigentlich in die Rue Marx-Dormoy geführt hätte. „Goutte d’Or“ heißt das Viertel, in dem ich stattdessen ankomme und wo ich mir für die Recherchen ein Zimmer gemietet habe. Die Gegend hat seit jeher einen schlechten Ruf. Schon in Émile Zolas „L‘assommoir“ (Der Totschläger) soffen sich hier die Proletarier um ihre Existenz, heute gilt das Viertel vielen noch als Immigrantenghetto, verdreckt und gefährlich, als Drogen- und Hurenviertel, No-go-Area – dabei wird man als Spaziergänger so freundlich begrüßt. Am Eck Rue Stephenson/Rue de Jessaint/Rue de Tombouctou befinden sich vier kleine Läden, in denen ausschließlich frische Kräuter verkauft werden, vor allem Minze, Koriander und Petersilie. Es duftet betörend vor diesen Läden, aus denen stets das Wasser, mit dem die Kräuter frisch gehalten werden, auf die Straße rinnt. Ein Kraut kenne ich nicht. Ein freundlicher Verkäufer drückt mir ein Büschel davon in die Hand, lässt mich raten. Blassgrün sieht es aus, wie eine überdimensionierte Flechte, es riecht süßlich-würzig, ich habe keine Ahnung. Absinth! Hat aber nichts mit grünen Feen oder sonstigen verbotenen Räuschen zu tun, man trinkt es als Kräutertee, es soll gut für die Verdauung sein. Behalten Sie es doch gleich! Mit dem Kräuterbuschen in der Hand betrete ich die Goutte d’Or. „Goldener Tropfen“ so hieß der Wein, der einmal an den Hängen des Montmartre angebaut wurde, ein ehemals sehr beliebter Weißwein, der die Reblaus-Epidemie nicht überlebte, aber auch so dem raschen Wachsen der Stadt zum Opfer gefallen wäre. Viele nennen das Viertel nach dem angrenzenden Boulevard auch Barbès. Leila erwartet mich, meine aus dem Bénin stammende Zimmerwirtin, die mir versprochen hat, mir heute Nachmittag die Highlights ihres Viertels zu zeigen, das sie so unendlich viel besser findet, als sein Ruf es vermuten lässt.
Rue Stephenson
Ali-Baba-Grotte für Bibliophile
Unsere Tour beginnt mit einem echten Insidertipp: In der Rue Pierre-l’Ermite Nummer 3 drückt Leila auf eine Klingel, neben der schlicht Librairie steht. Wenig später öffnet sich die Tür, wir stehen in einer wahren Ali-Baba-Grotte für Bibliophile – ein wunderschöner, weitläufiger, von eisernen Säulen abgestützter Raum voller alter und seltener Bücher. Leila, die mir vorher nicht allzu viel verraten hat, freut sich über meinen offen stehenden Mund. Früher sei das eine Schmiede gewesen, erklärt Nicolas, der hier arbeitet. Neben dem Erdgeschoß gibt es noch ein Kellergeschoß, in dem die Buchhändler regelmäßig Ausstellungen organisieren. Ein großzügiger Ort, der in dieser Form nur in dieser Gegend denkbar ist: Im Quartier Latin oder in Saint-Germain, wo man viel eher mit einer solchen Buchhandlung rechnen würde, wären die Mieten viel zu hoch. Vorsichtig schmökere ich in ein paar kostbaren Bänden, ein frivol-heiterer Erotik-Ratgeber aus dem frühen neunzehnten Jahrhundert wäre ein hübsches Souvenir, ist mir aber zu teuer. Viel günstiger und braver, aber dennoch schön sind hingegen die fantasievollen Klappbücher für kleine und größere Kinder, die die Librairie im Eingangsbereich aufgestellt hat.
Durch die Rue de la Charbonnière geht es, mit Blick auf das nahe Sacré Cœur, das von hier geradezu unwirklich aussieht, zum Centre Barbara. Seit acht Jahren gibt es dieses Kulturzentrum bereits. Neben einem reichhaltigen Konzertprogramm und Ausstellungen richtet sich das Zentrum vor allem an Künstler und Sozialprojekte: Dreihundert Künstler nützen derzeit die Ateliers, Proberäume und Aufnahmestudios, auch diverse Therapie- und Präventionsprogramme finden hier Platz. Sonja Lambert führt uns durch das Gebäude. Die gebürtige Serbin, die schon seit vielen Jahren im Viertel wohnt, ist hör- und sichtbar stolz auf das moderne, sich diskret in seine Umgebung einfügende Zentrum, das ehrgeizige Programm der Konzerte, aber auch auf die Rolle, die es für das Ansehen der Goutte d’Or spielt: Weit über die unmittelbare Umgebung hinaus bekannte Festivals wie „La Goutte d’Or en Fête“ oder „Magic Barbès“ werden vom Centre Barbara mitveranstaltet – hinschauen und hineingehen lohnt sich, irgendetwas ist immer los.
Leila führt mich weiter zur Brasserie de la Goutte d’Or an der Ecke zur Rue des Gardes. Fred und Tristan, die mit ihren Bärten und Kappen genauso aussehen, wie man sich junge Craftbeer-Brauer vorstellt, brauen fünfhundert Hektoliter Bier pro Jahr, das man in einigen Pariser Lebensmittelläden sowie in ausgewählten Monoprix-Filialen zu kaufen bekommt. Ein wenig Hipsterflair liegt neben der hopfigen Note natürlich in der Luft, die beiden sind mit viel Lust und Einsatz bei der Sache. Auch sie lieben ihr Viertel und legen Wert auf den lokalen Charakter ihrer Biere, selbst wenn der Hopfen aus Flandern stammt: Für das vollmundige Aroma des belgisch inspirierten Triple-Biers sind Kaffeebohnen aus einer Rösterei in der Nähe verantwortlich, die Gewürze, die das fein aromatische Château-Rouge-Bier unverwechselbar machen, kommen aus dem nächsten Gewürzladen, und in Erinnerung an die Kohlenlager des alten Nordbahnhofs brauen sie ein Charbonnière-Bier mit getoastetem Malz, dessen rauchig-milde Note einfach ideal zum noch sehr kühlen Frühlingswetter passt.
Die Rue des Gardes ist eine Designer-Straße, hinter deren Auslagen zahlreiche Nähmaschinen surren – die Stadt Paris stellt hier Pariser Jungdesignern günstigen Arbeitsraum zur Verfügung, der im Rest der Stadt kaum aufzutreiben ist. In der Rue Cavé kommen wir am Echomusée vorbei. Vor vierundzwanzig Jahren hatte Museumsgründer Jean-Marc Bombeau die Vision, in dem ehemaligen Eckcafé mit Stuckdecke einen Raum zu schaffen, der die Kultur in den Alltag der Jugendlichen des Viertels bringt und in dem auch ihre Kultur – Hip-Hop und Streetart – Platz hat. Viel Engagement und Herzblut steckt in diesem Ort, Jean-Marc ist stolz auf „seine“ Kinder, die mittlerweile erfolgreiche Hip-Hopper sind oder ihre Fotos ausstellen. Jeden Mittwoch findet eine Jamsession statt, Poetry Slams und Hip-Hop-Konzerte stehen regelmäßig auf dem Programm.
Doch wo ist nun, nach so viel Kultur, Mode, Craft Beer und Design, das mythenumrankte afrikanische Barbès, das wahlweise als Projektionsfläche für Ängste oder exotische Fantasien dient? Gleich ums Eck. Die Rue Myrha ist wohl die afrikanischste Gasse der Hauptstadt. Wir biegen nach rechts und stehen nach wenigen Schritten vor der Ferme de Paris, in der es lebende Hühner zum Selberschlachten zu kaufen gibt. Fotos darf ich keine machen, aber hineinschauen: In einem Verschlag drängen sich verschiedenfarbige Hühner, ein paar Enten, einige Perlhühner. 18 Euro kostet ein normales Huhn, 33 Euro ein schwarzes – anscheinend ist es nicht nur schwerer, sondern auch ungleich besser. Genaueres will mir der Verkäufer nicht verraten. Wenige Meter weiter liegt die Weinhandlung La Cave de Don Doudine, in der Leila gern einkauft – die Weine stammen von Kleinproduzenten, vieles ist bio, und sogar eine „Goutte d’Or“-Cuvée kann man kaufen, gekeltert freilich nicht in Paris, sondern in der Touraine.
Leila schickt mich nun alleine weiter, da sie ihre Tochter von der Schule abholen muss, gibt mir aber noch ein paar empfehlenswerte Adressen mit auf den Weg. Vorbei an islamischen Buchhandlungen, afrikanischen Lebensmittel- und Stoffläden, finsteren Kaschemmen sowie topmodernen, in schmale Baulücken gesetzten Wohnhäusern spaziere ich in Richtung Rue des Poissonniers. Ich lasse mir Zeit, um die Atmosphäre der kontrastreichen Straße wirken zu lassen. Auffallend sind die vielen „Associations“, die entweder Nachhilfestunden oder kreative Freizeitaktivitäten für Kinder anbieten, den gemeinsamen Einkauf von Bio-Lebensmitteln organisieren oder gegen die Abrissbirne kämpfen, die das Viertel, dessen Altbauten oft in sehr schlechtem Zustand sind, gerade von Grund auf verändert. Es ist ein typischer Aspekt des Pariser Lebens, den viele Besucher übersehen: Die Bewohner dieser Stadt verbringen überdurchschnittlich viel Zeit damit, sich zu engagieren, ihr Wohnviertel zu verändern, sich für die Verbesserung ihrer Lebensqualität oder der ihrer Nachbarn einzusetzen. „Association“ heißt „Verein“, doch wo man bei uns an Sparer- oder Blasmusiktreffs denkt, geht es in Paris meist um soziale oder politische Anliegen. Vielleicht ist diese Bereitschaft zum Engagement über die eigenen Interessen hinaus ja ein Erbe der revolutionären Epochen der Stadt, deren aufmüpfige Einwohner den Königen beziehungsweise führenden Köpfen der Republik seit jeher eine Mischung aus Angst und Respekt einflößen. Die Stadt profitiert letztendlich enorm von der Zivilcourage und dem Willen zur Mitbestimmung ihrer Bevölkerung, auch wenn man nicht mit jeder Bürgerinitiative, jedem Streik und jeder Demo einverstanden sein muss. Auch die Goutte d’Or ist heute nicht zuletzt deswegen eines der spannendsten Viertel der Stadt, weil sich die Menschen, die hier wohnen, die Gestaltung nicht aus der Hand nehmen lassen wollen und sich mit viel Einsatz auch um diejenigen kümmern, die von der Gentrifizierung verdrängt zu werden drohen.
Die Rue des Poissonniers, in der ich nun lande, ist, unschwer zu erraten, die Verlängerung der Rue Montorgueil und der Rue Poissonnière. Außer dem Namen erinnert nichts an die Karren, die einst den „frischen“ Fang von der nahen Küste über Nacht in die Hauptstadt gebracht haben. Heute ist sie ein Stück Afrika, bunt und laut. Beim Marché Dejean in der gleichnamigen Straße packe ich den Fotoapparat ein: Hier sind viele „wilde“ Händler an der Arbeit, die nicht fotografiert werden wollen und darauf meistens wütend reagieren. Auf improvisierten Ständen aus Karton bieten sie zwischen den Lebensmittelhändlern gefälschte Markensonnenbrillen, Gürtel oder Uhren an. Sehenswert ist ihre Wegräumtechnik, wenn eine Gruppe Polizisten am Ende der Straße auftaucht: In Sekundenbruchteilen ist die Ware zusammengerafft, der Stand per Fußtritt abgebaut, der Händler verschwunden. Am Ende des Marktes gibt es Maniok zu kaufen, in Bananenblätter verpackt, Kräuter in Plastiksäcken, schwarze, für europäische Augen nicht gerade appetitlich aussehende getrocknete Seehechte. Ein ungewöhnliches Fisch-Einkaufserlebnis bietet ein Geschäft am Ende der Rue de Suez: Dort werden riesige „afrikanische“ Fische, die oft aus Asien kommen, tiefgefroren im Ganzen verkauft, man kann sie sich aber auch per Kreissäge in Scheiben schneiden lassen.
Die Rue Doudeauville ist eine weitere afrikanische Lebensader des Viertels, in der sich zahlreiche Stoffhändler und Schneider niedergelassen haben. Die bunten Baumwollstoffe, die viele Auslagen komplett füllen, heißen „Wax“ und werden in den Niederlanden hergestellt: ein Erbe des Kolonialismus, als die niederländischen Kolonialherren Soldaten aus Afrika in ihren asiatischen Besitzungen kämpfen ließen, wo diese die Technik, gebatikte Stoffe mit Wachs wasserabweisend zu machen, kennen- und schätzen lernten. Die Stoffe verbreiteten sich in der Folge im subsaharischen Afrika, die Muster vervielfältigten sich – wer sie zu „lesen“ versteht, für den sprechen die Gewänder aus Wax einmal mehr, dann wieder weniger subtile Botschaften aus, vom Stolz auf erreichten Wohlstand bis zur Warnung an den untreuen Ehemann, es ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen. Ein Händler an der Ecke zur Rue Léon erklärt mir einige der Muster, doch schon bei der nächsten bunten Auslage habe ich sie wieder durcheinandergebracht. Die Rue Léon ist weit über das Viertel hinaus bekannt, am Eck zur Rue Doudeauville liegt die beliebte L´Omadis-Bar, und an Wochenenden gibt es ein paar Schritte entfernt, im freundlichen Bistro Les Trois Frères, gratis Gemüse-Couscous zu essen, Gäste bezahlen nur die Getränke – was für ein volles Haus, studentisches Publikum und gute Stimmung sorgt. Ich gehe in der Rue Doudeauville weiter bis zum Centre des Cultures d’Islam, einem Islamzentrum, das nicht nur über eine Moschee verfügt, sondern auch Ausstellungen zeigt, wie derzeit eine sehenswerte Fotoausstellung über die Hamams von Tunis. Im Shop im Erdgeschoß kann man schöne baumwollene Hamam-Tücher, Massageöle, Arganseifen und ähnliche Souvenirs aus Nordafrika mitnehmen.
Rue Doudeauville „Wax“
Etwas weiter stadtauswärts, in der Rue Ordener, befindet sich das Café Lomi in einem schicken Neubau mit viel sichtbarem Stahl und Beton. Es weist eine hohe Laptop- und Hipsterbartdichte auf und gleicht an Nachmittagen einem Co-Working-Space für junge Kreative. Ohne Apple-Notebook fühlt man sich hier schnell als Außenseiter, der selbst geröstete Kaffee (der in der Brasserie weiter unten ins Triple-Malt-Bier kommt) und die Schokoladentarte sind aber trotzdem sehr gut, und eine kurze Pause kommt mir gerade recht. Beim Verlassen des Cafés fällt mein Blick auf eine Mauer voller Graffiti, ich folge ihr nach rechts, überquere die Nordbahn und lande in der Rue Marx-Dormoy beziehungsweise an der Place Paul-Éluard, einem weiteren Abschnitt des Königswegs, den ich vor lauter Afrika ein wenig aus den Augen verloren habe. Leila hat mir geraten, in dieser Gegend den Marché de l’Olive zu besuchen. Nach dem Platz geht es links in die Rue de l’Olive, vorbei an der hübschen Weinhandlung En Vrac, in der man auch gut essen kann. Der Markt lohnt tatsächlich einen Umweg: Man kann hier in etwa nachvollziehen, was im Hallenviertel – war ich dort wirklich erst heute Vormittag? – verloren ging, als man zwölf vergleichbare Hallen wegriss: Ein großzügiger, luftiger Rahmen für ein Einkaufserlebnis, wie es eben nur Paris zu inszenieren versteht, von karibischen und thailändischen Garküchen im Eingangsbereich bis zum typischen Marktangebot von Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst, Käse, Brot – alles verlockend, reichlich, schön präsentiert. Wie selbstverständlich gibt es bei der Markthalle eine hübsche kleine Buchhandlung, allerlei Schnellimbisse, Bäckereien und kleine Läden. Ich umrunde die Halle mit nun schon etwas müden Beinen, doch eine Besonderheit möchte ich noch besichtigen, die vor allem besonders an heißen Tagen für Spaziergänger interessant ist: Aus einem Brunnen im Square de la Madone, einem kleinen Park hinter dem Markt, sprudelt gratis Quellwasser aus über 700 Metern Tiefe. Bei hochsommerlichen Temperaturen füllen die Bewohner des Viertels sich ihre Wasserflaschen auf, heute ist niemand außer mir da – und ich gehe auch gleich wieder, da Regen einsetzt. Bei bernsteinfarbenem Bier und ein paar Knabbereien lasse ich in der schmuddelig-coolen Brasserie l’Olive den Tag Revue passieren, der so reich an Eindrücken war, dass das Prädikat „königlich“ gar nicht so vermessen klingt, wie ich das anfangs angesichts der so gar nicht eleganten Viertel, durch die mich der Weg geführt hat, vermutet habe. Nur ein paar Kilometer weiter nördlich von hier liegen die Könige und Königinnen Frankreichs in der Basilika von Saint-Denis begraben, jedenfalls das, was die Revolutionäre von ihnen übrig gelassen haben: Während der Terrorherrschaft wurden die Königsgräber geschändet, die teils erstaunlich gut erhaltenen Leichen aus den Stein- und Bleisärgen gerissen und in einer mit Kalk gefüllten Grube verscharrt. Dem unverwesten Leichnam Henri IV. wurde damals der Bart abgerissen – seither gibt es an mehreren Orten Frankreichs angeblich originale Barthaare des ermordeten Königs zu bestaunen. Erst nach Napoleons Sturz wurden die Gräber wieder instand gesetzt. Die Basilika hat zwar gehörig gelitten, ist aber nach wie vor besuchenswert – wenn man noch Energie dafür hat, was ich für mich heute verneinen kann. Statt zu den royalen Resten spaziere ich zurück in mein Zimmer in der Goutte d’Or.
Rue de Suez