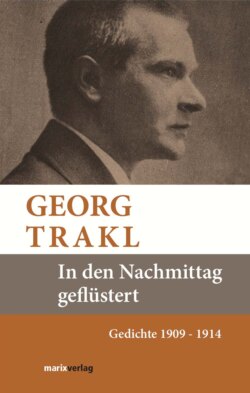Читать книгу In den Nachmittag geflüstert - Georg Trakl - Страница 6
»Der Raum im Spiegel« Ein Vorwort zu Trakls Dichtung
Оглавление»Inzwischen habe ich den Sebastian im Traum bekommen und viel darin gelesen; ergriffen, staunend, ahnend und ratlos; denn man begreift bald, daß die Bedingungen dieses Auftönens und Hinklingens unwiederbringlich einzige waren, wie die Umstände, aus denen eben ein Traum kommen mag. Ich denke mir, daß selbst der Nahestehende immer noch wie an Scheiben gepreßt diese Aussichten und Einblicke erfährt, als ein Ausgeschlossener: denn Trakl’s Erleben geht wie in Spiegelbildern und füllt seinen ganzen Raum, der unbetretbar ist, wie der Raum im Spiegel. (Wer mag er gewesen sein?)« – So schreibt Rainer Maria Rilke 1915 nach seiner Lektüre von Georg Trakls zweitem Gedichtband, dem posthum erschienenen Sebastian im Traum, den Trakl nicht lange vor seinem Tod im Alter von 27 Jahren noch selbst zusammengestellt hatte. »Unbetretbar« nennt Rilke den Raum dieser Dichtung und scheint so zu derselben Ansicht zu tendieren wie so viele nach ihm; immer noch heißt es von Trakls Werk, es sei ›hermetisch‹, ›dunkel‹, ›unzugänglich‹. Aber Rilke spricht auch von Scheiben und von Spiegeln, gegen die sich der Leser presst, von der unwiderstehlichen Anziehungskraft getrieben, die diese Dichtung auf ihn ausübt; das impliziert, dass, so ›abgeschlossen‹ Trakls Raum sein mag, doch ein Fenster existiert, durch das der Leser hineinblicken kann und aus dem ihm sowohl das Andere als auch das eigene Selbst entgegenschauen mag – ewig Getrennt, doch ewig Angesehen. Es ist eine Art Verbundenheit, die gerade durch dieses getrennte Anschauen entsteht, kein wahrhaftes Ausschließen: der Leser ahnt, staunt, wird ergriffen, so Rilke, wenn er auch letzten Endes »ratlos« bleibt. Doch es ist eben eine ergriffene, eine staunende, eine ahnende Ratlosigkeit, welche den Blick in eine andere Wirklichkeit lenkt, die hinter dem Spiegel liegt – die wir vielleicht nicht betreten können, die uns aber etwas zeigt und erahnen lässt. Man fühlt sich fast an Paulus’ Wort vom »Spiegel in einem dunklen Wort« erinnert, mit dem der späte Apostel die einzige Form der Erkenntnis beschreibt, die uns im diesseitigen Leben offensteht. Und Trakls Lyrik tut nicht zuletzt das: uns die Dunkelheit unserer eigenen Erkenntnisfähigkeit bewusst machen, dieses Schauen durch Spiegel über Spiegel, aus denen uns etwas grauenhaft Wunderbares und herrlich Fürchterliches entgegenblicken mag – oder, in Trakls Worten aus dem Nachtlied: »O! ihr stillen Spiegel der Wahrheit. / An des Einsamen elfenbeinerner Schläfe / Erscheint der Abglanz gefallener Engel.«
Georg Trakl wurde am 3. Februar 1887 in Salzburg geboren. Sein Geburtsjahr fällt also in jenen engen Zeitraum, innerhalb dessen auch die Mehrheit der übrigen expressionistischen Dichter, zu denen Trakl gerechnet wird, das Licht der Welt erblickte: eine Generation von Gründervätersöhnen (und -töchtern), die zwanzig Jahre später als Bohemiens und Rebellendichter gegen literarische wie tatsächliche Väter aufbegehren, in grellen wie dunklen Farben und eruptivem Aufschrei den apokalyptischen Untergang und Neubeginn predigen und sich in den Wirren und Nachwehen des Ersten Weltkriegs hineindichten oder verlieren würden. Trakl, der schon 1914, zu Beginn des Großen Krieges und in der frühen Phase des Expressionismus, verstarb, ordnet sich in vieler Hinsicht in die Gruppe dieser Dichter ein, die in ihrer Lyrik Sprache, Selbst und Welt zerschlugen, um Neues erstehen zu lassen; und doch bleibt er eine Erscheinung für sich, die sich gegen jegliche Epochenzurechnung sperrt.
Wie viele der dem Expressionismus zugerechneten Dichter stammte auch Trakl aus einem gutbürgerlichen Milieu: Der Vater war Eisenhändler, der sich vom Klein- zum Großbürgertum hochgearbeitet hatte, ein sanfter oder vielleicht auch harter Patriarch; die Mutter sammelte kunstbegeistert Antiquitäten und überließ, mit Ausnahme der musischen Bildung, die Erziehung ihrer sechs Kinder der Gouvernante. In Trakls Lyrik, in der gewisse Bilder und Begriffe immer wieder aufgegriffen und in immer neuen Verbindungen wiederholt werden, so dass sie sich mit ihren ganz eigenen Bedeutungen aufladen, ist das Wort »Kindheit« stets von einer Aura der Düsternis umgeben, wohl am deutlichsten in dem Prosagedicht Traum und Umnachtung: »Manchmal erinnerte er sich seiner Kindheit, erfüllt von Krankheit, Schrecken und Finsternis, verschwiegener Spiele im Sternengarten, oder daß er die Ratten fütterte im dämmernden Hof.« Die Kindheit erscheint als etwas unwiederbringlich Verlorenes, aber zugleich als etwas, das nie wirklich besessen wurde. Dieses Gefühl des Verloren-Habens eines Nie-Besessenen durchwirkt Trakls Lyrik von Anfang bis zum Ende. Es bleibt keineswegs auf das Besondere der Kindheit beschränkt, sondern steigert sich zu einem Allgemeinen, das die gesamte menschliche Existenz umfasst und sowohl auf die Vergangenheit (»Kindheit«) als auch auf die Zukunft (»Ungeborenes«) gerichtet ist. Besonders erschütternd geschieht dies in Trakls letztem Gedicht Grodek, das die Perspektive vor dem Hintergrund des unmittelbar erfahrenen Ersten Weltkriegs von innerem Leiden hin auf die Menschheitspein lenkt: »O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre, / Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz, / Die ungeborenen Enkel.«
»Der Einsame« ist eine häufig auftretende Gestalt in Trakls Lyrik, und auch die Kindheit und Jugend des Dichters war von Einsamkeit geprägt. Innerhalb der Familie scheint er isoliert gewesen zu sein, unter seinen Schulkameraden galt der junge Trakl, der sich schon früh in existentielle, philosophische Fragen in der Nachfolge Nietzsches versenkte und Gedichte von verstörender Bildlichkeit verfasste, als Sonderling und ›Spinner‹. Bereits zu jener Zeit erwarb sich der adoleszente Trakl in gewisser Weise den Ruf eines poète maudit, eines ›Dichters des Bösen‹ ganz im Geiste seiner Vorbilder Baudelaire und später Verlaine und Rimbaud; wie jene experimentierte er mit Alkohol und Drogen, besuchte regelmäßig Bordelle und gab sich dem Lebensgenuss hin, um sich so im Baudelaire’schen Sinne paradis artificiels (künstliche Paradiese) zu kreieren – und letzten Endes daran zu scheitern.
Trakl scheint sich abwechselnd seiner Drogensucht selbstvergessen und lustvoll ergeben und sie verbittert verflucht zu haben; immer wieder erwähnt er in Briefen an Freunde Selbstmordabsichten, die jedoch möglicherweise ebenso Hilfeschrei wie Teil seiner Selbstinszenierung als poète maudit gewesen sein mögen. Der junge Dichter, der trotz offensichtlicher Intelligenz in seiner Gymnasialzeit mehrmals das Klassenziel nicht erreichte, musste die Schule schließlich abbrechen, ein erstes Scheitern an der (groß)bürgerlichen Existenz, die er nicht weniger verachtete als die anderen jungen, avantgardistischen Intellektuellen seiner Generation. Er flüchtete sich nicht zuletzt in die bewusste Selbstinszenierung als Künstler und Bohemien über Kleidung, Lebensstil und Geisteshaltung; sein Freundeskreis bestand aus jungen Gleichgesinnten, die die Salzburger in unnachahmlich österreichisch-bürgerlicher Manier »das spinnerte Krezl« nannten. Doch ganz verabschieden konnte sich Trakl nie von der bürgerlichen Existenz. Nach seinem Schulabbruch begann er eine Ausbildung als Pharmazeut, ein gerade noch angesehener Beruf, und nach seinem dreijährigen Studium in Wien und einem einjährigen Wehrdienst versuchte er beständig, Fuß zu fassen und trotz seiner neurotischen Angstzustände einen Arbeitsplatz zu halten – ohne Erfolg. Beispielsweise trat der junge Dichter Ende 1912 eine Stellung im Arbeitsministerium in Wien an, nur um nach seinem ersten Tag dort das Entlassungsgesuch einzureichen.
All den Kämpfen Trakls mit bürgerlicher und Bohème-Existenz, mit Drogensucht, Angstzuständen, Halluzinationen und Selbstmordgedanken lag ein tiefgehendes psychisches Leiden zugrunde, das bildreichen und ergreifenden Ausdruck in seinen Gedichten findet und doch ungreifbar bleibt – es sind jene unwiederbringlichen »Bedingungen dieses Auftönens und Hinklingens«, von denen Rilke spricht, und die Trakls Lyrik so einmalig, fremdartig und doch zutiefst anrührend machen: »Tönend von Wohllaut und weichem Wahnsinn«, wie es in Trakls In ein altes Stammbuch heißt.
»Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Konfession«, schreibt Johann Wolfgang von Goethe in seinem autobiographischen Meisterwerk Dichtung und Wahrheit, und der Leser Trakls kann sich des Eindrucks kaum erwehren, dass dieser Ausspruch auch auf die Lyrik des Salzburgers zutreffen könnte, die den Charakter eines intimen, wenn auch nur schwer fassbaren Bekenntnisses hat. Doch was bekennt der Autor hier?
Trakls Gedichte durchzieht ein großer Schmerz und das Bewusstsein einer ebenso überwältigenden Schuld: »Groß ist die Schuld des Geborenen. Weh, ihr goldenen Schauer / Des Todes / Da die Seele kühlere Blüten träumt«, heißt es in Anif. Eng verbunden mit diesem allumfassenden Schuldig-Sein, und damit auch mit dem Motiv des Todes und des ewig Sterbenden, ewig Vergehenden, das so prominent in Trakls Lyrik ist, ist das Bild der »Schwester«, die die Verse des Dichters von Anfang bis ganz zum Ende durchwandert wie ein Geist oder ein blasser Engel. »Karfreitagskind« nennt Trakl diese Gestalt in An die Schwester, deren »Mund in schwarzen Zweigen flüstert« (Seele des Lebens); noch in Trakls letztem Gedicht Grodek ist sie es, deren »Schatten durch den schweigenden Hain« schwankt, um »zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter«. Es gilt für das gesamte Werk des Salzburger Dichters, was er in Geistliche Dämmerung schreibt: »Immer tönt der Schwester mondene Stimme / Durch die geistliche Nacht.« Zuweilen erscheint es tatsächlich so, dass die Schwester das »Tönenende« in Trakls Lyrik repräsentiert: Sie ist Tod- und Lebenbringende, sie gibt Halt und stürzt ins Unheil, sie tritt auf als Dämon und Heilige, Kind und Verführerin und repräsentiert ewige Verbundenheit wie stete Trennung.
»Die Schwester« ist keineswegs die einzige immer wiederkehrende Gestalt in Trakls Lyrik; da sind die Mutter, der Jüngling, der Einsame, der Fremdling, der Engel, das Wild, um nur einige Protagonisten in Trakls großem lyrischen Drama zu nennen, die alle verschieden und doch alle dieselben sind. Aber »die Schwester«, das »Karfreitagskind«, umgibt eine ganz besondere Aura, nicht nur, aber auch, weil wir ihre Spiegelung in Trakls Leben wohl am deutlichsten wiederfinden. Es handelt sich dabei um die jüngste Schwester des Dichters, Margarethe, genannt Grete, die unter all ihren Geschwistern Georg selbst nicht nur äußerlich am ähnlichsten war. Sie war diejenige Person, zu der der einsame Adoleszente wohl die engste Bindung knüpfte – eine Bindung, die berühmt-berüchtigterweise nicht rein geschwisterlicher Natur bleiben sollte. »Im Park erblicken zitternd sich Geschwister«, heißt es in Traum des Bösen, und in Passion wird die »Dunkle Liebe / Eines wilden Geschlechts« heraufbeschworen. Der Inzest mit Grete, der wohl irgendwann in der Zeit der Adoleszenz zum ersten Mal vollzogen wurde, war vielleicht nicht der einzige, aber doch der machtvollste Dämon, der Trakl umtrieb; vermutlich verschärfte sich sein Schuldbewusstsein, weil er seine Schwester spätestens während des gemeinsamen Jahres in Wien 1909 mit Drogen in Kontakt brachte, eine Sucht, die auch sie nicht brechen würde können.
Diese »große Schuld« Trakls lieferte zumindest einen Interpretationsansatz für die enge Verschränkung von Liebenden und Tod, von Ekel und Geschlechtlichkeit in Trakls Lyrik. Hand in Hand geht die Gestalt der Schwester mit der der Mutter. Diese wiederum steht stets mit Motiven von Klage, Schmerz, Einsamkeit in Verbindung und kann als eine Spiegelung von Trakls eigener, distanzierter Mutter gesehen werden. Sie wird zur Verkörperung des anklagenden Bewusstseins um die Schuld: »Weh der steinernen Augen der Schwester, da beim Mahle ihr Wahnsinn auf die nächtige Stirn des Bruders trat, der Mutter unter leidenden Händen das Brot zu Stein ward.« (Traum und Umnachtung) Gleichzeitig ist sie kaum zu trennen von der liebenden Schwester. »Mutter trug das Kindlein im weißen Mond«, heißt es in Sebastian im Traum; der Mond ist aber auch ein Attribut der Schwester, vor allem dann, wenn sie einen Schimmer von Hoffnung mit sich trägt: »und es hob sich der blaue Schatten des Knaben strahlend im Dunkel, sanfter Gesang; hob sich auf mondenen Flügeln über die grünenden Wipfel, kristallene Klippen das Antlitz der Schwester.« (Offenbarung und Untergang) Das Bild der Schwester, genau wie das der wilden Liebenden, mögen sie auch todgeweiht sein, bringt letzten Endes eine unterschwellige Vitalität in Trakls Verse hinein, wie in Auflehnung gegen die eigene Selbstnihilierung. Die Liebe ist stets dunkel bei Trakl, bleibt an den Ekel des Verfalls und des Todes gebunden, aber gleichzeitig verwandelt ihre Präsenz Tod und Untergang in etwas Sanftes, selbstverständlich Geschehendes, und leise tönt immer die Hoffnung auf ein Wiederauferstehen; Trakls Tote sind nie wirklich tot, sowie seine Lebenden nie wirklich lebendig sind. Seine Lyrik verschmilzt alle Gegensätze, selbst die großen von Leben und Tod und Gut und Böse, zu einem ambivalenten Ganzen, das in sich selbst unbestimmbar bleibt.
So wie das Bildnis der Schwester Trakls ganzes Werk durchwebt, blieb auch das Leben von Georg und Grete eng verbunden, selbst nachdem die junge Frau 1910, nach dem Tod des Vaters, nach Berlin zog und 1912 eine unglückliche Ehe mit dem um vieles älteren Arthur Langen schloss. Als Grete im März 1914 eine Fehlgeburt erlitt (unheimlicherweise schon zuvor ein oft wiederkehrendes Motiv in Trakls Lyrik), eilte ihr Bruder an ihr Krankenbett; das Ereignis zeichnete ihn schwer. Zuvor hatte der junge Dichter, der 1912 eine zeitweise Anstellung als Militärapotheker in Innsbruck gefunden hatte, zum vielleicht ersten Mal tatsächliche Stabilität und Gemeinschaft im dortigen Kreis um Ludwig von Ficker und den Brenner gefunden, nicht zu schweigen eine Plattform für seine Gedichte. Hier wurde zum ersten Mal die Außergewöhnlichkeit und Genialität von Trakls so befremdlich anderer Lyrik in vollem Ausmaß erkannt. Bis dahin war dem jungen Poeten nur wenig Anerkennung zuteil geworden; vergeblich hatte er versucht, seine frühen Gedichte zu veröffentlichen, und die Aufführungen zweier Dramen aus der Feder des ›spinnerten‹Trakl im heimatlichen Salzburg errangen lediglich Achtungserfolge. 1913 jedoch erschien endlich Trakls erste Gedichtsammlung unter dem Titel Gedichte, und er arbeitete unermüdlich an der Zusammenstellung der zweiten, Sebastian im Traum; der junge Lyriker erlebte einen regelrechten kreativen Schub. Darüber hinaus bot der Kreis um von Ficker, der zu Trakls engstem Freund wurde, dem jungen Mann, der sich so unbehaust fühlte in der Welt und vielleicht sogar in sich selbst, eine Art Zuflucht (und nicht zuletzt auch immer wieder finanzielle Unterstützung). Doch an dem innerpsychischen Leiden Trakls änderte diese Situation nichts; »es ist ein so namenloses Unglück, wenn einem die Welt entzweibricht«, schrieb er in diesem Jahr nieder. Auch weiterhin litt er unter Geldsorgen, seiner Drogensucht und massiven Angstzuständen, was sich nach dem Besuch bei der leidenden Grete in Berlin nur verschärfte.
Inmitten der sich verschlimmernden persönlichen Krise wurde Trakl dann kurz nach Kriegsbeginn als Medikamentenakzessist eingezogen und erlebte die Kriegswirklichkeit unmittelbar. Als er nach der Schlacht von Grodek allein um die 90 Schwerverwunderte betreuen musste, unfähig, diesen Todgeweihten in irgendeiner Weise tatsächlich beizustehen, zerbrach Georg Trakl. »Ich verfalle recht oft in unsägliche Traurigkeit«, schrieb er an von Ficker Ende Oktober 1914, als er bereits nach einem von Kameraden verhinderten Selbstmordversuch in ein Garnisonshospital eingewiesen worden war. Und doch entstanden zu dieser Zeit große Gedicht, die letzten darunter Klage und Grodek, die er seinem Freund noch kurz vor seinem Tod sandte und in denen Trakl mit dem engen Bilderkosmos, den er aus seinem persönlichen Leiden geknüpft hatte, auf erschütternde Weise nun ein größeres, zugleich konkretes und umfassenderes Leiden in Worte zu bannen wusste. Zwar besingt er auch in früheren Gedichten schon expressionistisch-apokalyptisch den Untergang eines ganzen Geschlechts – denn so empfanden Trakl und seine Generation von Dichtern das Siechtum der späten Kaiserreiche. Aber in seinen letzten Gedichten, den Kriegsgedichten, öffnet sich die Perspektive auf eine Menschheit, die im Nichts versinkt, doch nicht ohne ein goldenes Aufflackern, das vielleicht Hoffnung ist. Georg Trakl selbst jedoch erlag seiner »unsäglichen Traurigkeit«; am 3. November 1914 starb er im Garnisonshospital an einer Überdosis Kokain, die er sich selbst verabreichte. Grete, deren lyrischen Abglanz er noch in seinen letzten beiden großen Gedichten anruft, ereilte ein traurig spiegelbildliches Schicksal. Nach dem Tod ihres Bruders verlor die junge Frau endgültig den Boden unter den Füßen; am 17. September 1917 erschoss sie sich im Alter von 25 Jahren.
Betrachtet man Trakls Werk von den Jugenddichtungen bis zu Klage und Grodek, ist eine deutliche Entwicklung seines Stils erkennbar. Die Jugendgedichte, die Trakl 1909 zu einem Band zusammenstellte, der jedoch zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht blieb, sind in einem an Baudelaire geschulten Décadence-Stil gehalten; der junge Dichter befindet sich noch auf der Suche nach der eigenen Stimme. Doch entfaltete sich schon hier die für Trakl so typische Bilderwelt, aus der sein ganz eigener lyrischer Kosmos entstehen würde. Von etwa 1910 an entwickelte sich Trakls Stil konsequent weiter und nahm seine ganz eigene, im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdige Klangfarbe an. Man spricht auch von Trakls impressionistischer Phase: Eindruck um Eindruck reiht sich hier scheinbar rein assoziativ aneinander, oft in ungewöhnlichen Kombinationen, die die gewohnte Wirklichkeitswahrnehmung des Lesers herausfordern. Diese von starken, aber zugleich sanften Naturbildern dominierten Verse erhalten eine traumhafte Qualität, doch eine, die den Blick nicht verschleiert, sondern verschärft. Der Übergang von dieser ›impressionistischen‹ zu Trakls expressionistischer Lyrik geschieht fließend. Trakls Bildhaftigkeit beginnt, sich von dem Rückbezug auf eine wiedererkennbare Wirklichkeit zu lösen; seine Verse kreieren immer mehr eine neue, poetische, zeichenhafte ›Wirklichkeit‹, die zutiefst rätselhaft, aber auch zutiefst bedeutungsvoll ist, nämlich voll eigener Bedeutung. Besonders deutlich erkennbar wird dies an Trakls Farbsymbolik, die einen wichtigen und äußerst faszinierenden Aspekt der Lyrik des Salzburgers darstellt.
In den früheren Gedichten ist trotz impressionistischer Verfremdung der konkrete Wirklichkeitsbezug der Farbsymbolik gegeben: »Golden reift der Wein am Hügel« in Frauensegen (1910), wo auch »Rot die Blätter niederfließen«, und In einem verlassenen Zimmer (1910) »beugt die heiße Stirne / Sich den weißen Sternen zu.« Doch ist bereits in Die schöne Stadt (1910) auch von »den braun erhellten Kirchen« die Rede; es beginnt ein Abstraktionsprozess, der sich beständig fortsetzt. Farben werden ihrer konkreten Bedeutung enthoben, in neue, noch nicht gesehene Zusammenhänge gebracht; berühmt ist beispielsweise das in Trakls Lyrik mehrfach auftretenden »blaue Wild«. Dies ist eine Farbsymbolik, die sich an der alltäglichen Wirklichkeitserfahrung reibt; gerade dadurch aber wird innerhalb der Verse eine zeichenhafte ›Wirklichkeit‹ erschaffen, in der Farben Gefühls- und Seinszustände bezeichnen können, ohne das, was sie bezeichnen, konkret festzulegen, wie etwa in Trakls spätem Gedicht Klage: »Jüngling aus kristallnem Munde / Sank dein goldner Blick ins Tal; / Waldes Woge rot und fahl / In der schwarzen Abendstunde.«
Doch Trakl gelingt mehr, als bloß expressionistisch-abstrakte Farbbilder zu malen. Gerade auch dadurch, dass der Abstraktionsprozess innerhalb seines Gesamtwerkes ein gradueller ist, sich die expressionistische Verfremdung Schritt um Schritt steigert, schafft Trakl ein eigenes Bedeutungsnetz, einen Bilderkosmos, in dem sich alle Zeichen aufeinander beziehen. Trakls Lyrik arbeitet im Grunde mit einem eng begrenzten Repertoire an Bildern und Begriffen, von denen Farben einen nicht unbedeutenden Teil ausmachen: blau, weiß, golden, schwarz, kristallen sind darunter wohl die prominentesten. Weitere elementare Begriffe dieses poetischen Zeichennetzes sind Zustände wie Kindheit, Stille, Tod und Verfall, zeitliche Momente wie der Abend, die Nacht, die Dämmerung, der Herbst und die Reihe von dramatis personae in Trakls Lyrik, darunter die vielbesprochene Schwester, die Mutter, der Fremdling, der Engel, das Wild, das Ungeborene, der Jüngling. All diese Bedeutungselemente werden schrittweise aus vertrauten Kontexten gelöst und in immer neue gesetzt, die für sich genommen oft rätselhaft sind, doch ein Netz weben, das Trakls Gedichte miteinander verknüpft und einen neuen Zusammenhang, einen neuen Bedeutungskosmos schafft.
Walther Killy, der Herausgeber der ersten kritischen Trakl-Ausgabe, hat die berühmte Behauptung aufgestellt, das Werk des Salzburgers sei in Wirklichkeit ein einziges großes, zusammenhängendes Gedicht – und diese Aussage hat durchaus ihre Berechtigung. In Trakls Bildwelt beziehen sich die einzelnen Zeichen stets aufeinander, schieben sich übereinander, verschmelzen gar miteinander, so dass fast ein einziges, wenn auch dissonantes, fragmentiertes, nie vollständiges Bild zu entstehen scheint. Am eingängigsten geschieht dies im Fall jener dramatis personae, die Spiegelungen der eigenen Lebenswelt Trakls sind, aber durch sein poetisches Verfahren zu einem Mehr werden: die tod- wie lebenbringende Schwester und die Masken, die den Dichter selbst bezeichnen können. Der Knabe, der Fremdling, der Jüngling werden durch ein relativ einfaches Verfahren unauflöslich mit der Gestalt der Schwester verknüpft: Nicht nur werden diese Figuren mit denselben Attributen in Verbindung gebracht (etwa den Farben blau, silbern und gold oder dem Mond und dem Wild), sondern die Schwester wird auch zu »der Jünglingin / Umgeben von bleichen Monden« (Das Herz) oder erscheint als »der schwarze Schatten der Fremdlingin« (Offenbarung und Untergang). Diese Gestalt wird also aufs Engste mit den Masken verschmolzen, die das dichterische Ich bezeichnen können.
Ähnliche, wenn auch meist komplexere, motivliche Verbindungen kreiert Trakl zwischen allen dramatis personae seines lyrischen Kosmos, so dass sich in seinen Gedichten zwar kaum je ein lyrisches Ich manifestiert, es uns aber dennoch aus all diesen Gesichtern gebrochen entgegenzublicken scheint. Dieses vielfach gespiegelte ›Ich‹ist hoffnungslos gespalten, schaut sich aus tausend Spiegeln selbst ins Gesicht und sucht in der Vielheit eine Einheit, die sich nicht zuletzt in der zaghaften Hoffnung auf die hermaphroditische Verbindung mit der Schwester-Gestalt manifestiert, die jedoch auch ins Nichts führen kann: »Aus blauem Spiegel trat die schmale Gestalt der Schwester, und er stürzte wie tot ins Dunkel.« (Traum und Umnachtung) Doch wie immer bei Trakl sind Gegensätze wie Ganzheit und Nichts nicht wirklich verschieden, sondern in letzter Konsequenz dasselbe – eine unaufgelöste Ambivalenz, die es auszuhalten gilt.
Jedes Gedicht in Trakls eng umgrenzten und doch so überbordenden Kosmos liest sich wie eine ganz eigene Variation eines Themas. Dieses Thema selbst jedoch bleibt stets dunkel und ungesagt. Es mag das Ringen des Menschen um eine psychische Ganzheit sein, der langsame Verfall als conditio humana, die unauflösliche Einheit von Leben und Tod, die Ambivalenz von Untergang und Rettung, das Ringen mit einer großen Schuld, die »vergebliche Hoffnung des Lebens« (Sommersneige) – all dies zusammen und nichts davon. Diese beständige Schwebe, dieses Umkreisen eines unbestimmbaren und doch erahnbaren Themas, macht Trakls Lyrik so anziehend und vielsagend. Hier sind die Dinge nie das, was sie beim ersten Hinsehen zu sein scheinen; sie erfordern ein tiefes Schauen, ein stetes Schauen, wie der Blick in den Spiegel, der immer dasselbe und stets Anderes zeigt. Schließlich gilt, um mit Trakls Worten aus seinem großen Gedicht Helian zu schließen: »Doch die Seele erfreut gerechtes Anschaun.«
Katharina Maier
Im Juli 2009