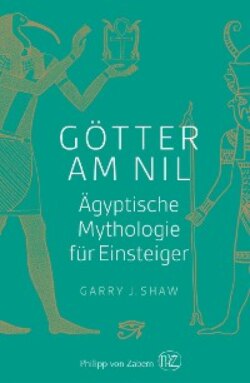Читать книгу Götter am Nil - Гэрри Шоу - Страница 15
Die Schöpfer
ОглавлениеNun – die unendlichen Wasser Das Universum vor der Schöpfung ist eine endlose Wassermasse, eine Zone der Dunkelheit, träge und reglos; eher der Ort für ein U-Boot als für ein Raumschiff. Es besteht keine Trennung zwischen den Elementen, keine Erde und kein Himmel, nichts hat einen Namen und es gibt weder Tod noch Leben. In dieser Form hat die Welt seit Ewigkeiten existiert, unendlich, still und stumm. Obwohl sie sich dem menschlichen Verstehen entzieht, personifizierten die Ägypter, um dieses grenzenlose Gewässer in ein Konzept zu bringen und darüber sprechen zu können, seine ineinander verwobenen Aspekte als unauflösliche Paare aus Mann und Frau – die Männer als Frösche und die Frauen als Schlangen. So gab es Nun und Nauhet als die uferlosen Wasser, Huh und Hauhet als die Unendlichkeit, Kuk und Kauket als das Dunkel sowie Amun und Amunet als das Verborgensein. Diese Kräfte bezeichnet man oft kollektiv als die acht Urgötter von Hermopolis (die „Achtheit“ oder griechisch „Ogdoas“).
Laut den Theologen von Hermopolis, die in ihren Mythen diese vor der Schöpfung bestehenden Kräfte in den Mittelpunkt stellten, schufen die acht Gottheiten vereint den ersten Erdhügel (oder eine Insel) und bildeten anschließend ein Ei, aus dem der Sonnengott schlüpfte. Je nach dem Mythos, den man befragt, soll die Sonne öfters aus einem Ei gekrochen sein, das eine Gans namens Großer Schnatterer – oder aber der Gott Thot in Gestalt eines Ibis – gelegt hatte. Nach anderen Lesarten schaffen die acht Gottheiten eine Lotosblüte in Nun, aus der die Sonne geboren wird und erst die Form des Skarabäus-Käfers Chepre, dann des Kindgottes Nefertem annimmt, dessen Augen, als sie sich öffneten, der Welt Licht schenkten.
Die Form dieses Pyramidions steht wahrscheinlich für den Urhügel der Schöpfung.
Unter den acht Aspekten des Universums vor der Schöpfung kam Nun als den uferlosen Wassern besondere Bedeutung zu. Obwohl er manchmal wie seine drei Gefährten als Frosch dargestellt wird, konnte man ihn auch als Menschen mit dreigeteilter Perücke oder als Fruchtbarkeitsidol abbilden, das für Fülle, Ergiebigkeit und reichen Ertrag steht, denn wie wir sehen werden, war Nun zwar träge und reglos, dunkel und unendlich, doch er war auch ein Hervorbringer – ein Ort der Geburt und des Möglichen. Das leuchtet auf den ersten Blick nicht ein: Wie kann ein Ort der Dunkelheit und Unordnung denn eine Wachstums- und Lebenskraft sein? Da die ägyptische eine optimistische Kultur war, sahen die Ägypter in Nun das Potential für Dasein und Erneuerung: Licht kommt aus dem Dunkel, Land steigt mit erneuerter Fruchtbarkeit aus dem Überschwemmungswasser, Blumen sprießen aus trockenen, leblosen Samenkörnern. In der Unordnung liegt das Potential zur Ordnung.
In Nun also nahmen alle Dinge ihren Anfang.
Amun: „der sich zu Millionen machte“ Amun, eine der acht Urgottheiten, war für den ägyptischen Staatskult um 1200 v. Chr. beispiellos wichtig geworden – so sehr, dass man die Achtheit von Hermopolis nunmehr als die erste Entfaltung von Amuns eigener, verborgener Macht und Majestät ansah.
Die Acht waren deine [= Amuns] erste Form …
Eine weitere seiner [= Amuns] Formen ist die Achtheit …
Großer Amunhymnus
Die Ägypter stellten Amun als einen blauhäutigen Mann dar, der eine Krone aus zwei hohen Federbüschen trägt. Sein Titel „der Große Schnatterer“ verweist auf Amuns Verbindung zur Gans, jenem Vogel, der das Schweigen am Anfang der Zeit durch sein Schnattern brach; außerdem konnte man ihn als Widder zeigen – ein Fruchtbarkeitssymbol. Obwohl als Amuns Gemahlin meist die Göttin Mut betrachtet wurde, fand er als eine der Urkräfte von Nun sein weibliches Gegenstück in Amunet (die manchmal mit der Krone von Unterägypten geschmückt und einem Stab mit Papyrusspitze erscheint).
König Sethos I. (rechts) neigt das Haupt vor dem Gott Amun-Re.
Im Mittleren Reich (2066–1780 v. Chr.) wurde Amun im Gebiet von Theben bekannt, im Neuen Reich (1549–1069 v. Chr.) herrschte er unbestritten als höchste Gottheit und wurde als König der Götter bezeichnet. Da er für alles Verborgene stand, existierte Amun innerhalb und zugleich jenseits von Nun: transzendent, unsichtbar, hinter allen Dingen, vor den Schöpfungsgottheiten existent und selbsterschaffen. Er „verknüpfte seine Flüssigkeit mit seinem Leib, um sein Ei in Abgeschiedenheit hervorzubringen“, so erfahren wir, und war „Schöpfer seiner eigenen Vollkommenheit“. Selbst die Götter kannten sein wahres Wesen nicht.
Er [Amun] ist vor den Göttern verborgen, und sein Anblick
ist unbekannt. Er ist ferner als der Himmel,
er ist tiefer als der Staub [das Totenreich].
Kein Gott kennt seine wahre Erscheinung,
keine Prozessionsstatue von ihm wird durch Inschriften enthüllt,
niemand zeugt zutreffend von ihm.
Großer Amunhymnus
Amuns Unzugänglichkeit ist wahrscheinlich etwas Gutes, denn wir hören auch, dass jeder, der „sein geheimes Wesen wissentlich oder unwissentlich ausdrückt“, sofort tot umfallen müsste.
Selbst zugleich innerhalb und jenseits von Nun, entschied sich Amun, die letzte verborgene Gottheit, die Welt zu erschaffen:
Er begann inmitten des Schweigens zu sprechen …
Er begann laut zu rufen, während die Welt in Stille lag,
seinen Schrei, der umging, während er nicht seinesgleichen hatte,
dass er alles gebären möge, was ist, und es ins Leben bringe …
Großer Amunhymnus
Amun, Mut und Chons: die thebanische Trias
Gemäß der thebanischen Theologie war Amuns Frau die Göttin Mut. Vorwiegend wurde sie in Menschengestalt abgebildet, aber auch als Löwin. Mut war eine göttliche Pharaonin und fungierte als Muttergöttin; dementsprechend kann sie mit der Doppelkrone von Unter- und Oberägypten erscheinen, außerdem mit einem Geierkopfschmuck, wie er bei Göttinnen und Königinnen auftritt. Die Trias (Dreiheit) von Amut und Mut vervollständigte ihr Sohn Chons, der in Kindergestalt mit Vollmond und Mondsichel nebeneinander auf seinem Kopf dargestellt wird.
Ptah – der kreative Kopf Amuns geradliniger, als rein geistig vorgesteller Denk- und Sprechakt erforderte das Eingreifen eines weiteren Gottes. Das war Ptah, der Gott der Kunst und des Handwerks, der göttliche Bildhauer, der die Kraft des kreativen Denkens verkörperte.
Du nahmst deine [nächste] Gestalt an als [Ptah-]Tatenen …
Ihn [Amun] nennt man [Ptah-]Tatenen …
Großer Amunhymnus
Für die Priester des Ptah waren alle Dinge eine „Schöpfung seines Herzens“: Ob nun Gottheiten, der Himmel, das Land, die Kunst oder die Technik, das alles wurde von ihrem Gott erdacht und ins Dasein gesprochen. Hauptsächlich wurde Ptah in Memphis nahe dem heutigen Kairo verehrt; abgebildet wurde er als ein fest in Leinen gewickelter Mann, wie eine Mumie, auf einem Podest stehend und mit einem Zepter in der Hand. Dazu trug er ein Scheitelkäppchen und einen starren, geraden Bart (für einen Gott ungewöhnlich, da ägyptische Götter normalerweise eher mit gebogenen Bärten auftreten). Er bildete eine Familientrias mit der unberechenbaren Löwengöttin Sechmet und beider Sohn Nefertem, der als Kind mit einer Lotosblüte auf dem Kopf dargestellt wird.
Der Gott Ptah
Der Gott Tatenen
Sechmet
Die Göttin Sechmet (oder Sachmet), was „mächtig“ bedeutet, wurde als löwenhäuptige Frau abgebildet, mit einer langen Perücke und einer Sonnenscheibe auf dem Kopf. Seltener zeigte man sie ganz als Löwin. Sie war die Frau des Gottes Ptah und die Mutter von Nefertem.
Sechmet konnte, je nachdem, eine gefährliche oder eine schützende Kraft sein. Man verband sie mit Seuchen (die Sechmets Boten brachten), Krieg und Aggressivität, betete aber auch zu ihr um Schutz vor Krankheiten. Wurde jemand krank, konnte er Sechmetpriester rufen und sie bitten, ihre Zauberkenntnis zur Heilung seiner Krankheit einzusetzen. Sechmet diente auch als Beschützerin des Königs, die Feuer gegen seine Feinde spie und ihn in den Krieg begleitete. In ihrer Verkörperung als blutdürstiges Auge des Re versuchte Sechmet die Menschheit zu vernichten, ließ sich aber durch eine List in ihrem Wüten aufhalten. Ihr wichtigstes Kultzentrum war Memphis.
Seit der Ramessidenzeit, als der Große Amunhymnus gedichtet wurde, betrachtete man den Gott Tatenen („das aufgestiegene Land“) als einen Aspekt Ptahs; folgerichtig verband man die beiden zu Ptah-Tatenen, einer Verbindung des göttlichen Bildhauers mit dem ersten Land, das sich aus den Wassern des Nun erhoben hatte.
Als Macht des schöpferischen Denkens stand Ptah für die verwandelnde Kraft, die eine kreative Idee in die Tat und die materielle Wirklichkeit umsetzt – vom Geistesblitz, den ein Handwerker plötzlich erlebt, während er die Straße entlangspaziert, bis zu jenem Akt, in dem er seine Statue leibhaftig ausmeißeln und den Stein zu jenem Bild formen wird, das er mit seinem inneren Auge erfasst hat. Dies spiegelt sich in einem Text, der als Memphitische Theologie bekannt ist; normalerweise interpretiert man ihn als Aussage darüber, dass die Schöpfung sich durch Herz und Zunge des Ptah vollzog, indem dieser Gott die Einzelheiten der Schöpfung im Herzen ersann und mit seinen göttlichen Worten ins Sein verkündete, indem er ihre Namen aussprach: Was er dachte, wurde wirklich. Es war eine Schöpfung aus dem Nichts. Allerdings hat James P. Allen die Ansicht vertreten, dass das Herz und die Zunge, von denen hier die Rede ist, tatsächlich dem obersten Schöpfergott Amun gehören, während Ptah ihm bloß die verwandelnde Kraft dazu lieh. Obwohl also Amun „inmitten des Schweigens“ sprach und dieser verborgene Gott die Vision der Schöpfung beisteuerte, war es – so hätten die Amunpriester zugestehen können – Ptah als Personifikation des schöpferischen Prinzips, der es Amuns Gedanken ermöglichte, Wirklichkeit zu werden.
Die Götter Sia (links) und Heka (rechts) flankieren die widderköpfige Seele des Sonnengottes.
Hu, Sia und Heka
Der geistige Schöpfungsakt war dank dreier Facetten des Schöpfers möglich: seiner sia („göttliche Wahrnehmung“), hu („gebieterisches Wort“) und heka („Magie“). Mit der Kraft der heka ausgestattet sah er in seinem Herzen die geschaffene Welt, und durch sein gebieterisches Wort sprach er sie ins Sein.
Jede dieser drei Kräfte wurde als einzelner Gott dargestellt; es hieß, dass Hu und Sia aus Blutstropfen, die vom Phallus des Gottes tropften, entstanden seien.
Heka jedoch trat ins Sein, „ehe sich zwei Dinge in der Welt entwickelt hatten“, und wird, wenn er als personifizierte Gottheit auftritt, deshalb manchmal als Schöpfergott gezeigt. Heka tritt als Mann, mitunter aber auch als Kind auf und schmückt sich häufig mit einem gekrümmten Götterbart. Auf seinem Kopf kann das Hinterteil eines Löwen erscheinen, und gelegentlich hält er Schlangen in den Händen. Er zählt zu jenem Kreis von Gottheiten, die den Sonnengott bei seiner Reise auf der Sonnenbarke behüten, schützt aber ebenso den Gott Osiris im Totenreich der Duat.
Wenn wir uns Amun also als reichen Mäzen vorstellen, als jemanden, der nach seinen speziellen Wünschen eine Statue in Auftrag gibt, und Ptah als den göttlichen Kunsthandwerker, der mit der Umsetzung dieses Werkes beauftragt ist – wer oder was war das Ausgangsmaterial, das Amun als letztendlicher Schöpfer und Ptah als der Übersetzer’ des Schöpferwillens bearbeiten sollten? Jeder Künstler benötigt eine formbare Substanz, die es ihm erlaubt, seine Vision aus dem Innern seines Geistes zu holen und das Abstrakte für jedermann konkret zu machen. In der ägyptischen Schöpfungsmythologie war dieses Ausgangsmaterial der Gott Atum (oder Re-Atum), „gemeißelt“ zur geschaffenen Welt, in der wir alle leben.
Er [Amun] vollendete sich als Atum,
der eines Leibes mit ihm war.
Großer Amunhymnus
Atum und die Evolution der Materie Diese geistigen Akte – die Vision Amuns und die Schöpferkraft des Ptah – setzten die physische Entfaltung der Welt in Gang, denn sie wirkten ein auf ein Ei oder Samenkorn, das im grenzenlosen, dunklen Raum des Nun trieb, und weckten sein Bewusstsein. In der heliopolitanischen Tradition war dieser Samen der Gott Atum (der auch als Re-Atum bezeichnet wird). Noch war Atum eine Mixtur aller Materie und aller Götter, vermischt und undifferenziert, also wie die Singularität zu Beginn des Urknalls oder, wie Atum selbst berichtet:
Ich war allein mit dem Urmeer [Nun] in der Trägheit und konnte keinen Ort zum Stehen finden … [die Götter der] ersten Generation waren noch nicht ins Sein getreten, [sondern] sie waren bei mir …
Sargtext 80
Atum, was „der Vollender“ bedeutet, war der Herr der Ganzheit, ein Gott, der zugleich für die Evolution und deren Abschluss stand. Seine typische Gestalt war menschlich und trug die Doppelkrone von Ober- und Unterägypten, aber Atum konnte auch die Gestalt eines Mungo, eines Skarabäus, einer Echse, einer Schlange, eines Pavians mit Pfeil und Bogen oder des benu-Vogels (des „Phönix“) annehmen; manchmal stellt man ihn auch als das erste Land dar, das sich während des Schöpfungsvorgangs aus den Fluten erhebt. Als Abendgestalt des Sonnengottes erschien er mit einem Widderkopf.
Die Königin Nefertari (rechts) steht vor dem Gott Atum.
Innerhalb von Nun eröffnete Atum (bisher nichts als ein Samenkorn) ein Gespräch mit Nuns grenzenloser Ausdehnung:
Ich treibe dahin, bin völlig stumpf, ganz träge.
Es ist mein Sohn „Leben“ [hier: der Gott Schu], der mein Bewusstsein
darstellen wird, der mein Herz leben lassen wird …
Sargtext 80
Nun antwortete:
Atme deine Tochter Ma’at ein [hier: eine Form der Göttin Tefnut] und hebe sie an dein Nasenloch, damit dein Bewusstsein leben kann. Mögen sie nicht fern von dir sein, deine Tochter Ma’at und dein Sohn Schu, dessen Name „Leben“ ist … es ist dein Sohn Schu, der dich aufrichten wird.
Sargtext 80
Dieses merkwürdige erste Gespräch aller Zeiten bedarf einer Erklärung. Zu diesem Zeitpunkt des Schöpfungsvorgangs befinden sich die Gottheiten Schu und Tefnut, die für das Leben und den Begriff ma’at steht, noch in Atum und existieren als Teile von ihm. Damit sich Atum von den unendlichen Wassern trennen und eine unabhängige Existenz genießen kann, nimmt „das Leben“ nun die Funktion von Atums Bewusstsein an und bringt sein Herz zum Schlagen, als sollte es einen Toten wiederbeleben. Doch obwohl sein Herz jetzt schlägt und sein Verstand aktiv ist, bleibt Atum bewusstlos, bis er Ma’at/ Tefnut einatmet und als Lebenshauch in seinen Körper lässt, so dass er zu vollem Bewusstsein erwacht. Als ob er vom Tod erst ins Koma überginge und dann aus diesem traumartigen Zustand erwachen würde, kommt Atum ganz zu sich und wird handlungsfähig, aus seinem trägen Schlafzustand herausgerissen durch die Kraft von Atem, Herzschlag und Geist.
Da er jetzt vollkommen Herr seiner selbst ist, nutzt Atum seine Unabhängigkeit, um die Wasser Nuns von sich zu ‚subtrahieren‘ und auf diese Weise zum ‚Rest‘ der Gleichung zu werden – dieser, von den Ägyptern als der Schöpfungshügel dargestellt (der seinerseits als der Gott Tatenen personifiziert wird), war vielleicht der Anstoß zur Formgebung der Pyramiden. In einigen Varianten des Schöpfungsmythos trifft der heilige benu-Vogel, ein Aspekt des Atum, ein, lässt sich auf den Hügel nieder, und sein Schrei ist das erste Geräusch überhaupt.
Die Göttin Tefnut
Der Gott Schu
Und damit kehren wir zu unserer Erzählung zurück. Jetzt dehnt sich der Gott Schu innerhalb von Atum aus, als wäre Atum ein Ballon, der sich mit Luft füllt:
Es war im Leib des großen, sich selbst entwickelnden Gottes [Atum], dass ich mich entwickelt habe … In seinen Füßen bin ich gewachsen, in seinen Armen habe ich mich entwickelt, in seinen Gliedern habe ich einen Hohlraum gemacht. Sargtext 75
Ma’at und Isfet
Ob nun als Göttin, als Konzept oder eine Abart von Tefnut – Ma’at spielt eine Schlüsselrolle im ägyptischen Weltbild. Als Konzept steht ma’at für das richtige Gleichgewicht zwischen Ordnung und Unordnung, schließt aber auch die Gerechtigkeit und das richtige Handeln ein. Die Ägypter räumten ein, dass sich die Unordnung (isfet) nie ganz beseitigen lässt – und das sollte sie auch nicht, denn sie war Teil der Schöpfung und notwendig für deren korrektes Funktionieren. Isfet war seit dem Anfang der Zeit ein untrennbarer Bestandteil des Kosmos.
Doch nicht der Schöpfer hatte sie gemacht, und er distanzierte sich von der isfet, die die Menschen stifteten:
Ich machte jeden Menschen wie seinesgleichen,
ich gebot nicht, dass sie isfet tun sollten: Ihre Herzen sind es,
die zerstören, was ich gesagt habe. Sargtext 1160
Das Ziel jedes Wesens, von den Göttern bis zum Pharao und den Menschen, war es, dafür zu sorgen, dass die Ordnung (ma’at) nicht von der Unordnung (isfet) übermannt wurde. In den Augen der Ägypter durchzog die ma’at alle Dinge, und wer ihre Gesetze brach – ob er sie kannte oder nicht – wurde bestraft. Die Götter lebten sogar von der ma’at und bezeichneten sie als ihr Bier, als Speise und Trank.
Wenn sie personifiziert wurde, war Ma’at eine Göttin mit einer großen Feder auf dem Kopf – die Hieroglyphe für ma’at. Vielleicht wegen ihrer Verbindung mit Tefnut führt man Ma’at als eine Tochter des Re(-Atum) auf und bezeichnet sie gelegentlich als Gefährtin des Gottes Thot.
Die Göttin Ma’at
Anschließend entwickelt sich Atum zur geschaffenen Welt und nimmt nach Belieben Gestalt an. Häufig wird diese sich selbst erschaffene Kraft in ägyptischen Zaubersprüchen gepriesen:
Durch mein [= Atums] Wirken habe ich meinen Leib zustande gebracht. Ich bin der eine, der mich machte. Es war, wie ich wollte, meinem Herzen gemäß, das ich selbst baute. Sargtext 714
Sei gegrüßt, Atum, du Herr des Himmels, der das Seiende geschaffen hat, der aus der Erde hervorging und den Samen entstehen ließ; Herr dessen, was ist, der die Götter geboren hat; großer Gott, Selbstentstandener. Totenbuch, Spruch 79