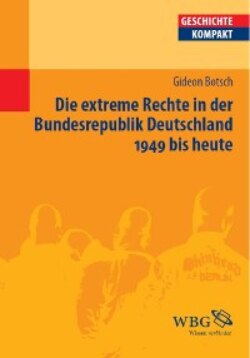Читать книгу Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute - Gideon Botsch - Страница 10
E
ОглавлениеNationale Opposition Der verbreitetste Eigenbegriff der extremen Rechten in der Bundesrepublik charakterisiert sie als weltanschaulich geprägte, fundamentaloppositionelle politische Bewegung, die als zentrales einigendes Merkmal durch radikalen Nationalismus auf Grundlage des ethnischen Abstammungsprinzips gekennzeichnet ist. Folgende Elemente bestimmen die Agenda: (a) die Überwindung der pluralen Gesellschaft zu Gunsten einer homogenen, gegliederten „Volksgemeinschaft“ unter Ausschluss von „fremden“ Elementen – Ausländern, Personen „nicht-deutscher Herkunft“ sowie Juden; (b) die Ersetzung der parlamentarischen Demokratie durch ein autoritäres Regime; (c) die Überwindung der Teilung Deutschlands in zwei Staaten (von 1949 bis 1990) und Rückgewinnung „verlorener“ deutscher Territorien inklusive Österreichs, teils in Verbindung mit weiteren territorialen Forderungen. Der Begriff knüpft bewusst an die radikalnationalistische Bewegung des wilhelminischen Kaiserreichs und der Weimarer Republik an.
Das nationale Lager lässt sich unterteilen in eine politische Bewegung, die durch Parteien, Jugendverbände, Aktionsgruppen, Zeitschriften usw. charakterisiert ist, sowie in ein lebensweltliches Milieu, in dem Traditionszirkel, Kulturgemeinschaften und eine – oft musikalisch unterfütterte – Erlebniswelt kleine Sinninseln in einer als feindselig empfundenen Umwelt stiften. Dabei zeigt sich für die Wahlparteien als charakteristisches Muster, dass sie nach anfänglichen aufsehenerregenden Mobilisierungserfolgen, regelmäßig auf Grundlage regionaler Hochburgen, nach relativ kurzer Zeit in sich zusammenfallen und das Gros ihrer Anhänger mit frustrierten Erwartungen hinterlassen, denen eine Rückwendung zu den „etablierten“ Parteien folgt. In diesen Phasen zieht sich ein harter Kern gesinnungsfester Aktivisten ins lebensweltliche Milieu zurück, arbeitet an der Tradierung der eigenen politischen Prämissen und Restrukturierung der Organisationen, die dann in einer neuerlichen, ebenso kurzlebigen Mobilisierungswelle ihre Früchte tragen. Gewissermaßen dreht sich die extreme Rechte also seit Jahrzehnten in einer Art Doppelhelix aus politischer Bewegung und lebensweltlichem Milieu. Da die vorliegende Darstellung sich auf die extreme Rechte als politischen Akteur konzentriert, wird sie den Schwerpunkt auf die Parteien, politischen Organisationen und Aktionsgruppen legen, auch wenn diese phasenweise – dies gilt etwa für die NPD in den 1970er/1980er Jahren – selbst Funktionen des lebensweltlichen Milieus übernommen hatten. Die Begrenzung auf die Bundesrepublik inklusive Berlin (West) bedeutet, dass Entwicklungen in der DDR – wo es eine formierte nationaloppositionelle Bewegung im hier verwendeten Sinne nicht gegeben hat – nur am Rande thematisiert werden.
Ein zweiter Schwerpunkt wird auf der Entwicklung der Jugendorganisationen liegen, für die der lebensweltliche Charakter phasenweise noch ausgeprägter ist, die indes für die Entwicklung und Struktur der extremen Rechten, insbesondere für ihre generationelle Reproduktion, von zentraler Bedeutung bleiben. Ein Element der rechtsextremen Jugendarbeit besteht in der Vorbereitung zum Kampf und dem Training an Waffen. Dabei haben sich, vornehmlich aus den Jugendorganisationen heraus, Ordnerdienste, Wehrsportgruppen oder terroristische Zellen gebildet.
Das dritte Element, das der rechtsextremen Bewegung in der Nachkriegszeit Struktur gegeben hat, sind die Bildungswerke und Diskutierzirkel, Verlags- und Medienunternehmen sowie Zeitschriftenprojekte – kurz, die „Kulturinitiativen“, vom elitären Thule-Seminar bis zum Rockmusik-Netzwerk Blood & Honour. Auch wo diese Netzwerke, Unternehmen und Organisationen politisch wirken, sind sie im lebensweltlichen Bezirk zu verorten. In der vorliegenden Darstellung werden diese eher am Rande behandelt und an exemplarischen Fällen vorgestellt, zumal es hier schwieriger ist, systematisch Entwicklungslinien und -tendenzen herauszuarbeiten.
Im Unterschied zum radikalen Nationalismus des Kaiserreichs und der Weimarer Zeit ist es der extremen Rechten nach 1945 nicht mehr gelungen, ihre politisch-weltanschauliche Agenda mit realen sozioökonomischen oder standesmäßigen Interessen zu koppeln. Während sich bereits im Wilhelminismus eine enge Verschränkung bestimmter sozialer Mittelgruppen mit dem radikalen Nationalismus entwickelte, konnte die bundesdeutsche extreme Rechte sich weder im agrarischen noch im gewerblichen Mittelstand, weder unter Handwerkern noch unter Klein- und Mittelbauern, weder unter Angestellten noch unter Beamten, aber auch nicht unter Studierenden, Volksschullehrern, Journalisten und kleineren Literaten zur Interessenvertreterin machen. Vom „großen Geld“ – inklusive der rheinisch-westfälischen Kohle- und Stahlindustrie, die ihren Vorläufern so viel Sympathie und Unterstützung entgegengebracht hatte – wurde sie ohnedies gemieden. Auch die Bundeswehr hatte kein Interesse daran, dass ihre Soldaten und Offiziere durch rechtsextreme Äußerungen auffielen. Es gelang der extremen Rechten nicht einmal, das große Potenzial der 1945 Depravierten, der „Heimatvertriebenen und Entrechteten“, Veteranen des Zweiten Weltkriegs, Angehörigen der Waffen-SS und ehemaligen NS-Mitglieder dauerhaft an sich zu binden. Für einige Zeit fanden diese Personengruppen ihre Interessen – Vorsorgungs- und Entschädigungsansprüche, Wiedereingliederung in die Gesellschaft, soziale Anerkennung und Wiederherstellung ihres Status – bei kleineren nationalistischen Parteien wie der Deutschen Partei (DP) oder dem Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE), und einigen nationalistisch ausgerichteten Landesverbänden der FDP aufgehoben. Im Unterschied zur nationalen Opposition verweigerten diese Parteien die Einordnung in die bundesrepublikanische Gesellschaft nicht, ließen sich politisch in die Koalition Konrad Adenauers (1876–1967) – den Bürgerblock – einbinden und hatten so reale politische Hebel, um die Interessen ihrer Klientel zu vertreten. Im Zeichen der wirtschaftlichen und politischen Erfolge in der Ära Adenauer schmolzen sie bis Ende der 1950er in die Unionsparteien und die FDP ein. Versprengte Reste, die an einer radikaleren nationalistischen Agenda festhielten, wechselten ins fundamentaloppositionelle nationale Lager über, doch nicht in einem Umfang, der dieses politische Spektrum ernsthaft aufgewertet hätte.
Wer sich in der Bundesrepublik Deutschland für die nationalistische Rechte entschied, tat dies vorrangig aus politisch-weltanschaulichen Gründen, unter Zurückstellung von sozialem Prestige, Karrierevorteilen und ökonomischen Rücksichten. Im Selbstbewusstsein der Akteure äußerte sich dies in der Eigenbezeichnung „Idealisten“ oder „Nonkonformisten“. Andererseits zeigt sich daran aber auch, dass die bundesdeutsche extreme Rechte zu keinem Zeitpunkt in der Lage war, die Interessen irgendeiner sozialen Gruppe, und sei es ihrer eigenen Basisklientel, zur Geltung zu bringen. Trotz ihres bewegungsförmigen Charakters bleibt daher Skepsis geboten, wenn sie mitunter als „soziale Bewegung“ dargestellt wird: Ihrerseits hat sie der „Interessenpolitik“ kaum Aufmerksamkeit zugewandt, Versuche zur Begründung rechtsextremer Bauern-, Beamten- oder Standesverbände bzw. Angestelltengewerkschaften sind allenfalls von taktischer Bedeutung geblieben – von Frauenorganisationen ganz zu schweigen.
Zu den inneren Problemen, mit denen die nationale Opposition stets zu kämpfen hatte, gehört das Verhältnis zum Nationalsozialismus einerseits, zum demokratischen Verfassungsstaat andererseits. Wenngleich die Wahlparteien seit dem Verbot der SRP (1952) formale Bekenntnisse zu Demokratie, Rechtsstaat und Grundgesetz nicht scheuten, blieb der fundamentaloppositionelle, systemilloyale Charakter der radikalnationalistischen Kräfte erhalten, der für ihre Einordnung als rechtsextreme Gruppen – im Gegensatz zur demokratischen Rechten und zum verfassungskonformen Patriotismus – konstitutiv ist. Die nationaloppositionellen rechtsextremen Strömungen lehnten die bundesdeutsche Verfassungsordnung ab, in der den Parteien und dem Parlament eine herausragende Rolle im politischen System zukommt, Verbände und Interessengruppen über gut geschützte eigene Rechte verfügen, individuelle Menschen, Bürger- und Freiheitsrechte gegenüber den Forderungen des nationalen Kollektivs ihren Eigenwert behalten. Sie erwiesen sich als unfähig, die Strukturprinzipien der demokratischen Zivilgesellschaft zu begreifen und einen angemessenen Umgang mit ihnen zu finden.
Innerhalb des fundamentaloppositionellen Rahmens zeigen sich in der extremen Rechten zwei gegenläufige Fliehkräfte. Einige Strömungen der nationalen Bewegung sahen die Notwendigkeit einer Abgrenzung von den Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes und wollten im Rahmen der Verfassungs- und Rechtsordnung unbedingt legal operieren können, ungeachtet der Tatsache, dass sie diese Ordnung mittelfristig überwinden wollten. Demgegenüber steht eine tendenziell neo-nationalsozialistisch orientierte Strömung, die zwar vom Standpunkt bürgerlicher Optik weniger „passabel“ war, dafür eine Ausstrahlung in jugendliche Milieus und Subkulturen entfaltete (z.B. unter militärbegeisterten Jugendlichen, in nationalen Jugendbünden, unter Skinheads und Fußballfans) und einen weitaus größeren Aktivismus aufwies. Ohne dieses Spektrum geht den rechtsextremen Wahlparteien ihre Mobilisierungskraft weitgehend verloren; mit ihm gelingt es nicht, die engen Grenzen der eigenen politischen Subkultur dauerhaft zu verlassen und das Wähler- und Anhängerpotenzial markant zu erweitern. Auch Versuche der Integration beider Spektren, wie sie in der DRP und in der NPD der 1960er zu erkennen sind, bleiben prekär, weil es sich eben um Fliehkräfte handelt, die zur Überdehnung des nationalen Lagers führen und in der Regel seine Desintegration begünstigen. Desintegration bedeutet aber für die extreme Rechte eine Aufsplitterung in zahlreiche bedeutungslose Kleinparteien und Einzelbünde. Auch dieser Wechsel von Sammlung und Spaltung ist ein Erklärungsfaktor für das oben beschriebene charakteristische Muster kurzfristiger Mobilisierungsphasen, die von solchen der Stagnation abgelöst werden.
Damit ist auch ein weiteres Spezifikum der Entwicklungsdynamik der extremen Rechten verbunden: „Ereignisketten“ (Peter Dudek/Hans-Gerd Jaschke), durch welche sie periodisch ins Licht der Öffentlichkeit rückt. Die Dynamik dieser Ereignisketten ist schwer zu fassen, da die einzelnen Ereignisse nicht unbedingt in einem direkten kausalen oder anderweitigen Zusammenhang miteinander stehen müssen. Gleichwohl kommt es wiederholt und aus unterschiedlichen Anlässen in der Geschichte der Bundesrepublik zu Erscheinungen, die plötzlich, eruptiv und oft unerwartet das Problem des Rechtsextremismus ins Bewusstsein des Publikums bringen und auf die Agenda der Politik zwingen. Solche Ereignisketten sind z.B. die Wahlerfolge der SRP in Verbindung mit der „Naumann-Verschwörung“ und der „Schlüter-Affäre“ in den 1950ern;die kurz vor Beginn des Jahres 1960 einsetzende „Hakenkreuz-Schmierwelle“ in Verbindung mit geschichtspolitischen Debatten um die juristische Aufarbeitung des Nationalsozialismus, oder die terroristische Mobilisierungswelle zu Beginn der 1980er Jahre in Verbindung mit dem Schock der SINUS-Studie, die unerwartet hohe rechtsextreme Einstellungspotenziale ermittelte. Im Zweifelsfall müssen diese Ereignisketten nicht unbedingt für eine besondere quantitative oder qualitative Zunahme des Rechtsextremismus stehen, mitunter drücken sie nur eine verstärkte, medial vermittelte gesellschaftliche Sensibilität aus.
Richard Stöss hat 1989 eine Periodisierung der extremen Rechten vorgeschlagen, die sich an den Wahlerfolgen rechtsextremer Parteien orientierte. Eine erste Phase beginnt demnach 1945 und dauert bis zum Beginn der Mobilisierungserfolge der NPD an; diese stehen am Anfang einer zweiten Phase; und mit den ersten Mobilisierungserfolgen der Partei Die Republikaner (REP) beginnt eine dritte Phase. Der Vorteil dieser Periodisierung ist zweifellos darin zu sehen, dass sie von den rechtsextremen Akteuren ausgeht. Zudem reflektiert Stöss auch die Mobilisierungswellen des europäischen Rechtsextremismus mit. Auch später hat er die dritte Phase im Jahr 1990 enden und eine vierte, gesamtdeutsche Phase beginnen lassen. Die vorliegende Darstellung wird die Periodisierung nach Stöss insofern berücksichtigen, als sie ebenfalls von bislang drei Entwicklungsphasen ausgeht. Sie wird aber die Abgrenzung dieser Phasen etwas anders vornehmen. Im Allgemeinen nehmen wir die Entwicklung der Bundesrepublik so wahr, dass wir die einzelnen Jahrzehnte als relativ scharf geschiedene Etappen dieser Geschichte ansehen. Die Fünfziger-, Sechziger-, Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahre stehen jeweils als Begriffe für sich selbst und erzeugen unmittelbar eine Reihe von Assoziationen und Bildern, die jedem Jahrzehnt seine eigene Signatur verleihen. Die Entwicklung der extremen Rechten lässt sich vor der Folie der Geschichte der Bundesrepublik recht gut mit dem Wechsel der Jahrzehnte in Deckung bringen. Wir unterscheiden daher drei Blöcke von jeweils zwanzig Jahren – 1949–1969, 1970–1989, 1990–2009 –, die wir wiederum in jeweils zwei Etappen entsprechend den Jahrzehnten unterteilen.