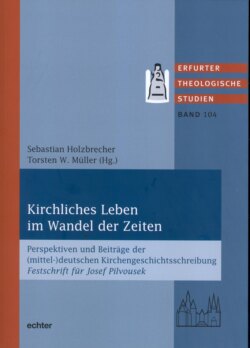Читать книгу Kirchliches Leben im Wandel der Zeiten - Группа авторов - Страница 20
Das „welfische Bischofsreich“ Hans-Georg Aschoff
ОглавлениеDie geistlichen Territorien stellten durch die Vereinigung von geistlicher und weltlicher Gewalt in der Person des Fürstbischofs eine Sonderform im Verfassungsleben des Reiches dar. Aufgrund ihres Wahlcharakters waren sie in besonderem Maße Einwirkungen auswärtiger Dynastien ausgesetzt. Die Besetzung von Bischofsstühlen ermöglichte den fürstlichen Häusern die Versorgung nachgeborener Söhne, die Ausweitung ihrer Machtstellung im Reich, die Verfügung über die ökonomischen und militärischen Ressourcen des geistlichen Territoriums, im Zusammenhang mit dem Ausbau des landesherrlichen Kirchenregimentes die Kontrolle über die bischöfliche Jurisdiktion und seit der Reformationszeit die Stärkung des eigenen konfessionellen Lagers. Das Einwirken auf geistliche Territorien musste nicht immer die Wahl eigener Familienangehöriger zum Ziel haben; zuweilen wurden verwandte Häuser, politisch abhängige Familien oder Konfessionsangehörige unterstützt. Zu Beginn der Frühen Neuzeit wandten auch die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg den westfälischen und niedersächsischen Hochstiften in verstärktem Maße ihre Aufmerksamkeit zu. Dabei richteten sich ihre Bestrebungen auf die Bistümer Osnabrück, Minden, Bremen, Verden und Halberstadt. Insbesondere das Haus Wolfenbüttel betrieb seit Herzog Heinrich d. Ä. (1463-1514) eine systematische Bistumspolitik, die die Errichtung eines „welfischen Bischofsreiches“1 zum Ziel hatte.
Erich von Braunschweig-Grubenhagen
Die Reihe der welfischen Bischöfe in der Frühen Neuzeit begann mit Erich von Grubenhagen.2 Er war 1478 als Sohn Herzog Albrechts II. und dessen Ehefrau Elisabeth, geb. Gräfin von Waldeck geboren worden. Nach einem Studienaufenthalt in Rom, wo er die Gunst Papst Julius‘ II. gewann, wurde er Domherr in Münster und Paderborn. Am 6. März 1508 wählte ihn das Osnabrücker Domkapitel zum Bischof; am 17. November 1508 erfolgte seine Postulation in Paderborn. Trotz seiner Zusage in der Wahlkapitulation empfing er nie die bischöfliche Konsekration.
Während Erich anscheinend problemlos die päpstliche Genehmigung seiner Wahl bzw. Postulation (6. September 1508 für Osnabrück; 20. April 1509 für Paderborn) erhielt, verzögerte sich die Regalienverleihung durch den Kaiser. Der Grund lag in Erichs Weigerung, die vom Reichstag beschlossene Kontribution für den Reichskrieg gegen den Papst und Venedig zu zahlen. Er verfiel 1510 der Reichsacht; auch als er zwei Jahre später die Steuer abführte, blieb sein Verhältnis zu Kaiser Maximilian I. getrübt. Erst dessen Nachfolger Karl V. stellte ihm 1521 die Regalienurkunden aus.
Erich verstand sich in seinem Amt vor allem als Landesherr. Er verfolgte eine Politik der territorialen Arrondierung und Konsolidierung, was zu militärischen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn seiner Hochstifte, insbesondere mit Ravensberg, Rheda, Münster, Tecklenburg und Lingen führte. Im Innern versuchte er, durch Verwaltungszentralisation seine Position gegen die Archidiakonalgewalt der Domherren zu stärken, geriet aber wegen seiner aufwändigen Lebensweise und deren Finanzierung in Konflikte mit den Domkapiteln.
Erich blieb bis zum Ende seines Lebens formal dem alten Glauben treu. Für seine Bistümer veranlasste er den Neudruck eines Breviers (1513 für Paderborn, 1516 für Osnabrück) und verpflichtete alle Geistlichen auf die gewissenhafte Verrichtung des Offiziums. Als eifriger Verehrer der hl. Anna nahm er deren Fest in den liturgischen Kalender seiner Bistümer auf und erklärte es zum gebotenen Feiertag. Dennoch unterblieben durchgreifende kirchliche Reformen. Gegenüber der reformatorischen Bewegung ließ Erich es an Eindeutigkeit und Konsequenz fehlen, wenn er auch das Wormser Edikt von 1521 in seinen Territorien energisch durchführte. Dabei schienen dogmatische Fragen eine untergeordnete Rolle zu spielen; Erich sah in den reformatorischen Bestrebungen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Während seine Hochstifte vorerst katholisch blieben, setzte sich die Reformation in den benachbarten Gebieten, die seiner bischöflichen Jurisdiktion unterstanden, infolge systematischer Förderung seitens der jeweiligen Landesherren durch. Auf der Reichsebene zeigte sich Erich in der Konfessionsfrage kompromissbereit; er lehnte ein entschiedenes Vorgehen gegen die evangelischen Reichsstände ab und unterhielt selbst engen Kontakt zu einer Reihe neugläubiger Landesherren, insbesondere zu Landgraf Philipp von Hessen. Dieser unterstützte Erichs Bemühungen um das Hochstift Münster, als sich die Resignation des dortigen Bischofs Friedrich zu Wied3, der mit dem Luthertum sympathisierte, andeutete. Aufgrund des Iburger Vertrages trat Wied Erich das Bistum ab; das münsterische Domkapitel postulierte ihn daraufhin am 27. März 1532 einstimmig zum Bischof. Vor seinem offiziellen Amtsantritt griff Erich wohl mehr aus politischen als religiösen Gründen entschlossen in die religiösen Auseinandersetzungen in der Stadt Münster ein, indem er die sofortige Entlassung des Anführers der Lutheraner, Bernhard Rothmann, und die Wiedereinführung der altkirchlichen Bräuche forderte. Erich trat die Regierung in Münster allerdings nicht mehr an; er starb am 14. Mai 1532 in Fürstenau an übermäßigem Alkoholgenuss beim Festschmaus anlässlich der für ihn erfolgreichen münsterischen Wahl.
Franz von Braunschweig-Wolfenbüttel
Seit Heinrich d. Ä. sah das Haus Braunschweig-Wolfenbüttel das Hochstift Minden4 als welfisches „Hausbistum“ an und konnte im 16. Jahrhundert hier vier Bischöfe stellen. Durch die Wahl der drei Nichtwelfen (Franz von Waldeck 1531-1553, Hermann von Schaumburg 1567-1582, Anton von Schaumburg 1587-1599) versuchte das Domkapitel, „das Hochstift dem Machtbereich der Wolfenbüttler zu entziehen“.5 Die Welfen zeigten deshalb ein besonderes Interesse an Minden, weil sein kirchlicher Sprengel weite Teile der benachbarten Territorien Braunschweig-Lüneburg und Braunschweig-Calenberg sowie die Grafschaften Hoya und Ravensberg umfasste. Die Sicherung der territorialen Integrität des schwachen Hochstiftes, das mit 22 Quadratmeilen das kleinste der westfälischen Fürstbistümer war, war ein wesentliches Motiv des Domkapitels bei der Bischofswahl. 1508 gelang es Heinrich d. Ä., das Hochstift für seinen dritten Sohn Franz (geb. 1492)6 zu erwerben. Am 14. Juli 1508 bestätigte Papst Julius II. dessen Wahl zum Bischof. Wegen mangelnder Volljährigkeit übernahm Franz erst 1512 die Regierung. Er hatte sich bis dahin meist am Wolfenbütteler Hof aufgehalten, besaß nur geringe theologische Kenntnisse und war in keiner Weise auf sein geistliches Amt vorbereitet. Er empfing weder die Priesternoch die Bischofsweihe. Seine Regierungszeit war durch eine beinahe ununterbrochene Folge von kriegerischen Auseinandersetzungen gekennzeichnet; diese erreichten ihren Höhepunkt in der Hildesheimer Stiftsfehde (1519-1523), in der sich Franz mit seinem Bruder Heinrich d. J. und Erich I. von Calenberg gegen Bischof Johann von Hildesheim und Herzog Heinrich von Lüneburg verbündete.
Bereits zu Beginn der Fehde ließ Franz, der sich nur sporadisch in seinem Bistum aufhielt, aus strategischen Gründen den Ort Petershagen mit Ausnahme der bischöflichen Residenz und die Vorstädte Mindens niederbrennen; ein Aufruhr der Mindener Bürger veranlasste ihn zur Flucht aus der Stadt. Trotz der militärischen Niederlage bei Soltau (28. Juni 1519) konnten er und seine Verbündeten mit Unterstützung Kaiser Karls V. ihre Stellung behaupten. Da man Franz für den desolaten Zustand des Stiftes verantwortlich machte, versuchte das Domkapitel, ihn bereits während der Hildesheimer Stiftsfehde, allerdings ohne Erfolg, durch eine Neuwahl aus seinem Amt zu entfernen. Die wachsende Opposition der Landstände gegen Franz wurde durch den Rezess von Wietersheim (11. August 1525) eingedämmt, den Erichs Bruder, Herzog Heinrich d. J., vermittelt hatte. Danach musste Franz bei Entscheidungen in Stiftsangelegenheiten eine landständische Kommission konsultieren; er sollte außerdem seine Hofhaltung einschränken und die Stiftsschulden abtragen.
Wie seine Familienangehörigen blieb Franz der alten Kirche verhaftet. Er unternahm aber nichts zur Behebung der kirchlichen Missstände und zur Intensivierung der Seelsorge. Auf dem Wormser Reichstag 1521 sprach er sich gegen Luther aus. Seine völlig verweltlichte Lebensführung und seine Misswirtschaft schwächten jedoch das Ansehen der Kirche und begünstigten neben den allgemeinen Beschwerden über den Klerus die Ausbreitung der Reformation. Diese nahm in der Stadt Minden ihren Ausgang und setzte sich nach Franz‘ Tod auch im Stift durch. Franz starb am 25. November 1529 in Wolfenbüttel und wurde in der Klosterkirche zu Riddagshausen bei Braunschweig beigesetzt.
Christoph von Braunschweig-Wolfenbüttel
Zur welfischen Interessenssphäre gehörten in der Frühen Neuzeit auch das Erzstift Bremen7 und das Hochstift Verden8. Die Erkenntnis, dass er wegen mangelnden dynastischen Rückhaltes zu schwach war, um die landesherrlichen Rechte gegenüber den lokalen Gewalten wirksam zur Geltung zu bringen und dem Einwirken der benachbarten Fürsten von Oldenburg, Sachsen-Lauenburg und Holstein entgegentreten zu können, veranlasste den Bremer Erzbischof Johann Rode (um 1445-1511)9, Christoph von Braunschweig-Wolfenbüttel10, den ältesten Sohn Heinrichs d. Ä., 1500 zum Koadjutor zu nehmen. 1502 wurde Christoph auch zum Bischof von Verden postuliert. Das Verdener Domkapitel hatte nach dem Tod des Bischofs Berthold von Landsberg erhebliche Vorbehalte gegen eine Wahl des Wolfenbüttelers gehabt und hätte sich lieber für seinen Senior, einen Vetter des verstorbenen Bischofs, entschieden. Dessen Ablehnung und das machtvolle Auftreten Heinrichs d. Ä., der in die Wahlhandlung eingriff und möglicherweise auch erhebliche Zugeständnisse machte, sicherten Christophs Wahl.11
1505 trat Christoph die Regierung in Verden an; in Bremen übte er nach dem Tod Rodes ab 1511 zunächst als Administrator und ab 1517 nach Vollendung des 30. Lebensjahres als Erzbischof die Regierung aus. Er empfing die bischöfliche Konsekration und war zeit seines Lebens eindeutig katholisch und loyal gegenüber dem Apostolischen Stuhl, wenn auch sein durch Prunk- und Verschwendungssucht sowie durch Konkubinate geprägter persönlicher Lebenswandel nicht tadelfrei war. Trotz Reformversuchen, wie die Stärkung der gottesdienstlichen Disziplin und die Disziplinierung seines Klerus, sowie seines Interesses an der Bursfelder Kongregation gelang es ihm nicht, der Reformation im Erzstift entschiedenen Widerstand entgegenzusetzen. Christophs schwache Stellung resultierte aus einer chronischen Finanznot, deren Ursachen wiederum in einer üppigen Hofhaltung, vor allem in einer Reihe militärischer Unternehmungen gegen nahezu alle auswärtigen Nachbarn lagen. Durch Verpfändung und Veräußerung von Stiftsgut wollte er den Mangel an Finanzmitteln beheben, geriet dadurch aber in scharfe Auseinandersetzungen mit den Landständen, die durch die religiöse Frage besondere Brisanz erhielten. Unter der Führung der Stadt Bremen, die einen quasi autonomen Status besaß, wandten sich die Stände der neuen Lehre zu. Um seine Schulden tilgen zu können, musste der Erzbischof u. a. im Rezess von Buxtehude 1525 und auf dem Landtag von 1534 den Ständen erhebliche Rechte einräumen. Während des Schmalkaldischen Krieges, als die Verteidigung des Stiftes durch den Erzbischof praktisch ausfiel, konnten diese ein förmliches Ständeregiment errichten und Christoph für abgesetzt erklären. Die Furcht vor einer Säkularisation des Stiftes durch Karl V. nach dem Vorbild Utrechts bewog sie, Christoph 1549 erneut als Landesherrn anzuerkennen. Allerdings übte der Erzbischof, der meist auf dem verdenschen Stiftsschloss Rotenburg residierte, bis zu seinem Tod keine effektive Herrschaft mehr aus.
Im Unterschied zum Erzstift Bremen gelang es Christoph in Verden, der reformatorischen Bewegung Widerstand entgegenzusetzen und das Stift wegen der Schwäche der Stände während seiner Regierung der alten Kirche zu erhalten.12 Der Bischof versuchte, mit Unterstützung des Dominikaners Augustin von Getelen durch Reformen und Disziplinierung seines Klerus den Beschwerden über kirchliche Missstände zu begegnen, ohne jedoch nachhaltige Unterstützung beim Domkapitel zu finden. Während sich im Hochstift Verden der Katholizismus einstweilen hielt, setzte sich die Reformation noch während Christophs Amtszeit in den lüneburgischen Teilen der Diözese unter Herzog Ernst dem Bekenner nach 1527 und in der Altmark unter Kurfürst Joachim II. nach 1535 durch. Christoph bemühte sich, vor allem die Klöster in diesen Gebieten in ihrem Kampf gegen die Reformation und die Gefahr der Säkularisation zu unterstützen.
Christoph starb am 22. Januar 1558. Um seine Nachfolge bewarben sich Vertreter fast aller benachbarter Fürstenhäuser – ein Zeichen dafür, dass vor allem Bremen „im Vergleich zu anderen norddeutschen Stiften immer noch trotz der Aushöhlung der zum Lande gehörenden Rechte [...] einen respektablen Faktor in den Auseinandersetzungen der Zeit“13 darstellte. Vor der Wahlentscheidung trafen sich die Domkapitel von Bremen und Verden in Zeven und einigten sich auf Christophs Bruder, Georg von Braunschweig-Wolfenbüttel, der seit 1553 Bischof von Minden war.
Georg von Braunschweig-Wolfenbüttel
Georg14 war am 22. November 1494 geboren worden. Eine Vielzahl geistlicher Pfründe sicherte ihm eine seiner fürstlichen Stellung angemessene Versorgung. Er war Domherr in Köln, Hildesheim und Straßburg und besaß u. a. ein Kanonikat an St. Gereon in Köln; außerdem war er Propst von St. Blasius in Braunschweig (1523) sowie von St. Mauritius und Heilig Kreuz in Hildesheim (1534-1558). 1530 erwarb er die Dompropstei in Köln und 1532 in Bremen. 1527 postulierte ihn das Domkapitel von Riga auf Empfehlung Karls V., der hier die Ausbreitung der Reformation aufhalten wollte, zum Erzbischof. Jedoch erreichte der Livländische Landmeister unter Hinweis auf das fehlende Indigenat des Wolfenbüttelers, dass das Domkapitel eine zweite Wahl „ex gremio“ durchführte, was Georgs Resignation zur Folge hatte. Seine vornehmlichen Aufenthaltsorte waren in der Folgezeit Köln und Straßburg, wo er in einem Konkubinat mit Ottilie Loxima lebte, dem seine beiden Söhne Wilhelm und Heinrich entstammten.15 Georg kam seinen Residenzpflichten an den verschiedenen Orten korrekt nach; dies trug dazu bei, dass er den Ruf der Weltläufigkeit, Gelehrsamkeit und Duldsamkeit erwarb und auf verschiedene Weise mit der reformatorischen Bewegung in Kontakt trat. Als Dompropst von Köln war er in die Konflikte um Hermann Graf zu Wied verwickelt, die 1546 zur Exkommunikation und Resignation des evangelisch gesinnten Kurfürsten führten. Trotz Sympathien für Wied und dessen Anhänger bezog Georg gegen die Reformationsbestrebungen in Köln Stellung.
Seine erste Bischofswürde erlangte Georg in Minden nach der Resignation seines Neffen Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel; dieser hatte 1553 die Nachfolge Franz von Waldecks angetreten, der auf Druck Herzog Heinrichs d. J. zurückgetreten war. Das Mindener Domkapitel postulierte Georg im Oktober 1554. Die päpstliche Bestätigung erfolgte am 16. Dezember 1555, die kaiserliche Regalienverleihung am 23. Februar 1557.16 Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Reformation in weiten Teilen des Hochstiftes durchgesetzt. Eine durchgreifende Protestantisierung verhinderte einstweilen das Domkapitel, das den katholischen Besitzstand sichern wollte und sich dabei von Georg Unterstützung versprach. In einem stärkeren Maße als später in Bremen und Verden scheint sich dieser um die Sicherung des Katholizismus in Minden bemüht zu haben. Unmittelbar nach seiner Wahl ernannte er den dezidiert katholischen Theologen Theobald Thamer zum Domprediger und versuchte, wenn auch erfolglos, Jesuiten zu berufen. Die Kumulation von Bistümern, seine schwache Stellung als Landesherr, seine irenische Grundhaltung sowie die wachsende Sympathie für die neue Lehre führten dazu, dass Georg keinen ernsthaften Versuch zur Rekatholisierung seiner Stifte unternahm und sich vornehmlich auf die Erledigung anfallender Regierungsgeschäfte beschränkte.
Von der Postulation Georgs 1558 erwarteten die Domkapitel in Bremen und Verden eine Sanierung der durch die kostspielige Hofhaltung und die kriegerischen Unternehmungen seines Bruders Christoph finanziell ruinierten Hochstifte.17 Der mit der päpstlichen Konfirmation von 1561 verbundenen Auflage, die Weihen zu empfangen, kam Georg nicht nach. Im Unterschied zu seinem Vorgänger versuchte er, Konfrontationen mit den Landständen zu vermeiden. Vielmehr bemühte er sich um ihre Unterstützung bei der Wiedereinlösung verpfändeten Stiftsgutes und der Rückgewinnung verlorener weltlicher und geistlicher Gerechtsame. Trotz wachsender lutherischer Neigungen, die gegen Ende seines Lebens immer offener zutage traten, blieb Georg offiziell katholisch. In Bremen ließ er der konfessionellen Entwicklung ihren Lauf. Auch in Verden trug er durch Duldung des evangelischen Gottesdienstes, der Priesterehe und des Abendmahles unter beiderlei Gestalt zur Konsolidierung des Protestantismus bei. 1564 bestellte er hier den lutherischen Abt von St. Michaelis in Lüneburg und erwählten Bischof von Lübeck, Eberhard Holle, zu seinem Koadjutor. Dieser übernahm nach Georgs Tod die Regierung des Hochstiftes und leitete die Reihe der eindeutig protestantischen Administratoren ein. Georg starb am 4. Dezember 1566 und wurde im Verdener Dom an der Seite seines Bruders Christoph beigesetzt.
Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel
Georgs Bistumskumulation war unter erheblichen Einfluss Herzog Heinrichs d. J. zustande gekommen. Wegen der Konzentration der Regierungsnachfolge auf Herzog Julius als einzigen überlebenden Sohn Heinrichs konnte sich das Haus Wolfenbüttel erst wieder in Heinrichs Enkelgeneration erfolgreich um Hochstifte bemühen. Es gelang, Julius‘ Söhne Heinrich Julius und Philipp Sigismund mit Bischofssitzen auszustatten. Da beide eindeutig evangelischer Konfession waren, konnten sie wegen der Verweigerung der päpstlichen Bestätigung lediglich als Administratoren fungieren. Ein neues Ziel wolfenbüttelscher Bistumspolitik wurde das benachbarte Hochstift Halberstadt.18 Dieses gehörte zusammen mit dem Erzstift Magdeburg seit Beginn des 16. Jahrhunderts zur Herrschaftssphäre der Hohenzollern, die beginnend mit Kardinal Albrecht von Brandenburg (1513-1545)19 nacheinander nicht weniger als vier Administratoren stellten. Bereits unter Albrecht, der mit Halberstadt und Magdeburg auch das Erzstift Mainz in seiner Hand vereinigte, drang die Reformation in das Fürstbistum ein und fand einen festen Rückhalt an den Landständen, während sich der Katholizismus vornehmlich im Domkapitel, in den mit diesem verbundenen Stiftskapiteln und einer Reihe von Klöstern hielt. Nach dem Tod des evangelischen Administrators Sigismund von Brandenburg 1566 gab das Domkapitel, das zu diesem Zeitpunkt noch zur Hälfte katholisch war, dem langjährigen Drängen Heinrichs d. J. nach und postulierte im Oktober dessen zweijährigen Enkel Heinrich Julius (geb. 1564)20 zum Bischof. Dabei setzten die katholischen Domherren auf die eindeutig katholische Haltung Heinrichs d. J., während die evangelischen Kapitulare von einem Dynastiewechsel die Sicherung der Selbständigkeit des Hochstiftes erwarteten. Hinzu kam, dass man sich finanzielle und politische Vorteile aus der Wahl eines Kindes erhoffte. An die Postulation knüpfte man die Bedingungen, dass Heinrich Julius katholisch erzogen und dem Domkapitel für zwölf Jahre die Landesregierung überlassen werde. Da die erste Bedingung nicht erfüllt wurde, erhielt Heinrich Julius nie die päpstliche Konfirmation. Seine rechtlich unsichere Stellung war ein Grund für die betont kaiserfreundliche Politik der Wolfenbütteler. Dadurch gelang es Herzog Julius, die von Papst Gregor XIII. 1575 vom Kapitel geforderte Neuwahl abzuwenden. Während der Minderjährigkeit Heinrich Julius‘ übernahm sein Vater die Vormundschaft im Hinblick auf dessen Rechte als „Electus“. Julius respektierte zwar bezüglich der Regierung des Hochstiftes die Abmachungen mit dem Domkapitel, baute aber die Kontrolle über die bischöflichen Tafelgüter aus und schuf wichtige Voraussetzungen für eine enge Bindung des Hochstiftes an das Fürstentum Wolfenbüttel. Diese Politik setzte Heinrich Julius nach seinem Regierungsantritt 1578 fort.21
Der kaiserliche Auftrag zur Administration des Hochstiftes forderte von Heinrich Julius, sich um die päpstliche Admission zu bemühen. Um diese zu erreichen, empfing er zusammen mit seinen Brüdern Philipp Sigismund und Joachim Karl (geb. 1573; 1591-1593 Dompropst in Straßburg) am 27. November 1578 im Benediktinerkloster Huysburg bei Halberstadt von Abt Johann von Iburg die niederen Weihen, was einen Sturm der Entrüstung unter den evangelischen Reichsständen auslöste.22 Um diesen Protest abzuschwächen, ließ Herzog Julius seinen Sohn einige Tage darauf in der Wolfenbütteler Hofkirche das Abendmahl unter beiderlei Gestalt nehmen. Auch weigerte sich Heinrich Julius nach seiner feierlichen Einführung als gewählter Bischof in Halberstadt an der Dankmesse im Dom teilzunehmen.
Hinsichtlich der Religionsfrage förderte Heinrich Julius das Fortschreiten der Reformation, sah aber von einem radikalen Vorgehen ab, so dass sich während seiner Regierungszeit der konfessionelle Schwebezustand fortsetzte und katholische Restbestände erhalten blieben. Diese musste er in einer Kapitulation vom 30. Mai 1584, die wegen seiner beabsichtigten Eheschließung notwendig wurde, erneut garantieren. Auch die entsprechend dem Beschluss des Landtages von Wegeleben (1587) durchgeführte Kirchenvisitation und die offizielle Einführung der lutherischen Lehre durch das Mandat vom 23. Februar 1591 bewirkten wegen des energischen Widerstandes der katholischen Minderheit im Domkapitel nicht die vollständige Auslöschung des alten Glaubens im Stift. Heinrich Julius‘ Aufenthalt am Kaiserhof in Prag und seine wachsende Toleranz trugen in der Folgezeit zur Sicherung und zum Erstarken der katholischen Restbestände bei.
Auch nach Heinrich Julius‘ Tod blieb das Hochstift Halberstadt dem wolfenbüttelschen Einfluss ausgesetzt. Das Domkapitel postulierte nacheinander drei seiner Söhne zu Administratoren23: 1613 den jüngsten, erst vierjährigen Heinrich Karl, der bereits 1615 starb. Ihm folgte Rudolf, der im Alter von 13 Jahren 1616 verschied. Am 6./16. August 1616 wurde Christian, der „tolle Herzog“, gewählt, der im Hochstift vor allem eine Versorgungsbasis für seine militärischen Aktionen sah. Seine rücksichtslose Heerführerschaft diskreditierte die wolfenbüttelsche Herrschaft, öffnete nach seiner Resignation am 18. Juli 1624 das Hochstift dem kaiserlichen Einfluss und führte 1628 zur Postulation Erzherzog Leopold Wilhelms.
Philipp Sigismund von Braunschweig-Wolfenbüttel
Philipp Sigismund24 stand zeit seines Lebens im Schatten seines künstlerisch begabten und auch politisch erfolgreicheren älteren Bruders, Heinrich Julius. Er wurde am 1. Juli 1568 auf Schloss Hessen geboren und verbrachte seine Kindheit in Wolfenbüttel, Liebenburg und Schöningen, bevor er 1582 mit dem Studium in Helmstedt begann und sich dann von November 1583 bis Januar 1586 am Hof seiner mit Herzog Ernst Ludwig von Pommern-Wolgast verheirateten Schwester Sophie Hedwig aufhielt. Philipp Sigismund wurde früh mit Pfründen versorgt; dazu gehörten Domkanonikate in Köln (1579), Bremen (1582) und Magdeburg (1588) und die Dompropstei in Halberstadt, die er 1588 mit Hilfe seines Bruders, des Administrators Heinrich Julius, erhielt. Bewerbungen um die Bischofsstühle von Bremen und Minden scheiterten; dagegen hatte er in Verden und Osnabrück Erfolg, erlangte aber wegen seines evangelischen Bekenntnisses nie die päpstliche Konfirmation und die kaiserliche Regalienverleihung.
Unter Administrator Eberhard von Holle hatte sich im Hochstift Verden die Reformation vollständig durchgesetzt.25 Das rein protestantische Kapitel postulierte Philipp Sigismund nach erheblichen finanziellen Zuwendungen des Wolfenbütteler Hauses am 16. September 1586 zum Administrator.26 In der Wahlkapitulation verpflichtete er sich, das Kapitel und die Stiftsuntertanen beim lutherischen Bekenntnis zu belassen, im Ernstfall dieses sogar zu verteidigen. Herzog Julius versprach militärische Hilfe, falls dem Stift durch die Übernahme des Administratorenamtes durch seinen Sohn Nachteile erwachsen sollten. Philipp Sigismunds Regierungstätigkeit in Verden gestaltete sich weitgehend konfliktfrei. Er machte sich um das Schulwesen verdient, wozu die Gründung einer Lateinschule 1609 in Rotenburg gehörte; in ähnlicher Weise förderte er später in Osnabrück das protestantische Ratsgymnasium. Im Gegensatz zu Heinrich Julius verbot er die Hexenprozesse und reformierte vor dem Hintergrund der Kipper- und Wipperzeit das Münzwesen. Mit der Kirchenordnung von 1606, die er gegen den Widerstand des Domkapitels, der Rittershaft und der Stadt Verden durchsetzte, brachte er die Reformation im Fürstbistum zum Abschluss.
In seinem Testament vom 29. Juni 1582 hatte Herzog Julius Heinrich Julius zu seinem Nachfolger in Braunschweig-Wolfenbüttel bestimmt, darüber hinaus aber festgelegt, dass dieser zugunsten Philipp Sigismunds auf die Stifte Halberstadt und Minden, wo Heinrich Julius 1582 vom Domkapitel postuliert worden war, resignieren sollte. Als dieser Plan 1585 bei Heinrich Julius‘ Resignation in Minden fehlschlug, wollte dieser hinsichtlich Halberstadts nicht das gleiche Risiko eingehen und behielt aus Gründen der Arrondierung des Gesamtkomplexes Wolfenbüttel-Halberstadt die Regierung über das Hochstift. Umso mehr fühlte er sich verpflichtet, Philipp Sigismund ein anderes Bistum zu verschaffen. Diese Möglichkeit ergab sich 1591 nach dem Tod des Osnabrücker Administrators Bernhard von Waldeck.27 Zu diesem Zeitpunkt war die konfessionelle Situation im Hochstift uneinheitlich. Der Protestantismus hatte einen festen Rückhalt an der Stadt Osnabrück und an großen Teilen des Stiftsadels. Die Mehrheit der Stifte und Klöster war noch dem alten Glauben verbunden. In den Landgemeinden hatten sich Mischformen des kirchlichen Lebens herausgebildet; während die Mehrheit der Geistlichen katholisch ordiniert war und sich mittelalterlich-kirchliches Brauchtum, wie liturgische Gewänder und Reste der lateinischen Kirchensprache, hielt, breiteten sich daneben protestantische Formen aus, wie Laienkelch, Priesterehe und lutherisches Kirchenlied. Versuche zur Vereinheitlichung und zur Durchführung einer Reform im altkirchlichen Sinn, die Bischof Johann von Hoya (1553-1574) gegen Ende seiner Amtszeit unternahm, erzielten keine tiefgreifende Wirkung. Das Domkapitel, das zwar erhebliche Vorbehalte gegen die Reformation hatte, weil es in ihr eine Gefahr für seinen eigenen Bestand sah, bezog keinen eindeutigen Standpunkt. Bei der Bischofswahl ließ es sich weniger von religiös-kirchlichen als von politischen Gesichtspunkten leiten. Priorität besaß die Sicherung der territorialen Integrität des Hochstiftes. Aus diesem Grund kam die Wahl der protestantischen oder lutherisch gesinnten Administratoren bzw. Bischöfe Heinrich von Sachsen-Lauenburg (1574-1585), Bernhard von Waldeck (1585-1591) und Philipp Sigismund von Braunschweig-Wolfenbüttel zustande.
Im Unterschied zu 1585, als Philipp Sigismunds Bewerbung in Osnabrück scheiterte, bereitete der Wolfenbütteler Hof die anstehende Wahl umsichtig vor; man gab ein Schutzversprechen für das Hochstift ab und ließ wie in Verden dem Domkapitel reiche finanzielle Mittel zukommen. Der Mangel an geeigneten katholischen Kandidaten, der Wunsch der Stadt Osnabrück und des protestantischen Stiftsadels, vor allem die Überzeugung, dass die Anlehnung an Braunschweig-Lüneburg den bestmöglichen Schutz gegen ein Übergreifen des Niederländischen Krieges auf das Hochstift bieten werde, veranlassten die Mehrheit der Osnabrücker Domherren, Philipp Sigismund am 25. Mai/5. Juni 1591 zu postulieren. Mit seiner Entscheidung geriet das Domkapitel in einen Gegensatz zur Kurie, die über den Kölner Nuntius Ottavio Mirto Frangipani ebenso wie der Kaiser auf einen eindeutig katholischen Kandidaten gedrungen hatte. Die von Philipp Sigismund unterzeichnete Wahlkapitulation enthielt zwar nicht die Verpflichtung auf das Tridentinum, verlangte von ihm aber den Schutz der katholischen Religion, den Empfang der Weihen, die Einholung der päpstlichen Bestätigung und den Gehorsam gegen den Papst; die Postulation sollte hinfällig sein, wenn sich Philipp Sigismund nicht den Vorschriften der katholischen Kirche gemäß verhielt, heiratete oder päpstlicherseits nicht bestätigt wurde.
In langwierigen Verhandlungen bemühte sich Philipp Sigismund um die päpstliche Konfirmation; dabei gab er wiederholt das Versprechen ab, die katholische Religion im Hochstift zu schützen. Die Kurie bestand jedoch auf der Ablegung des Tridentinischen Glaubensbekenntnisses, zu der sich Philipp Sigismund nicht bereitfinden konnte; u. a. rechtfertigte er seine Ablehnung mit dem Hinweis, dass die „professio fidei Tridentina“ ihm und dem Hochstift die Feindschaft der Niederlande bescheren werde. Längere Zeit glaubte die Kurie, Philipp Sigismund zur Konversion zum Katholizismus bewegen zu können, weshalb sie die Verhandlungen mit Konzilianz führte und von Strafandrohungen gegen den Administrator und das Domkapitel absah. Da es zu keiner Einigung zwischen der Kurie und Philipp Sigismund kam, wurde ihm auch die kaiserliche Regalienurkunde verweigert. Aufgrund anhaltender Intervention des Wolfenbütteler Hofes erhielt er 1598 ein zeitlich begrenztes Regalienindult für seine beiden Hochstifte, das dann immer wieder verlängert wurde. Somit beruhte seine Herrschaft auf einem rechtlich unsicheren Fundament, wobei seine Stellung in Verden, da konfessionelle Konflikte ausblieben, unproblematisch war. Dass sich Philipp Sigismund in beiden Stiften halten konnte, resultierte nicht zuletzt aus der starken politischen Rückendeckung durch das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel und den guten Beziehungen, die Herzog Heinrich Julius zu Kaiser Rudolf II. unterhielt.
In Osnabrück entwickelte sich das Domkapitel, zu dem Philipp Sigismund in „kühler Distanz“28 stand, zum eigentlichen Gegenpol des Landesherrn. Es nutzte dessen rechtlich unsichere Position zur Durchsetzung eigener ständischer und konfessioneller Forderungen aus. Mit Unterstützung der Kurie wurde seit der Jahrhundertwende u.a. durch die Aufnahme von Absolventen des römischen Collegium Germanicum die eindeutig katholische Partei im Kapitel verstärkt. Seine fortschreitende Katholisierung führte dazu, dass seit 1615 die Ablegung des Tridentinischen Glaubensbekenntnisses für die Aufnahme ins Domkapitel obligatorisch wurde. Das Kapitel wurde damit zum wichtigsten Beschützer der alten Kirche und des Reformkatholizismus im Hochstift. Diese Entwicklung hielt den in konfessioneller Hinsicht irenischen Administrator davon ab, den katholischen Besitzstand in Osnabrück zu schmälern. Er unterließ direkte Eingriffe in das altgläubige Kirchenwesen und zeigte sogar ein gewisses Wohlwollen gegenüber Stiften und Klöstern, wo er entsprechend der Wahlkapitulation Missstände zu beseitigen und die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Ordensregel zu erreichen versuchte. Ansonsten begünstigte aber die im großen Ganzen passive kirchliche Haltung Philipp Sigismunds, der sich mehr als Landesherr denn als Bischof verstand, die Ausbreitung und Festigung des lutherischen Bekenntnisses.
Philipp Sigismund, der abwechselnd in seinen Residenzen in Iburg und Rotenburg lebte und diese entsprechend seiner fürstlichen Stellung ausbaute, bewies eine „für seine Zeit erstaunliche konfessionelle Toleranz“29, der durchaus eine persönliche Überzeugung zugrunde gelegen haben mag; sie war aber auch taktischen Erwägungen geschuldet. Angesichts des Erstarkens der katholischen Kräfte im Reich und insbesondere in Westfalen intensivierte er seine Bemühungen, seine Stifte für das Welfenhaus bzw. für evangelische Kandidaten zu sichern. Unter Einsatz erheblicher finanzieller Mittel unternahmen Philipp Sigismund und die Welfen verschiedene Versuche, über die Bestellung eines Koadjutors beide Stifte für die Dynastie zu sichern. Dabei konzentrierte man sich anfangs auf Christian von Braunschweig-Lüneburg, seit 1599 Administrator in Minden und seit 1611 regierender Herzog in Celle. Konflikte über das Besetzungsrecht der Lüneburger Abtei St. Michael beendeten Philipp Sigismunds Bemühungen, Christian die Koadjuterie zu verschaffen. Außerdem verschloss sich das Verdener Kapitel diesen Überlegungen, weil es die Inkorporation des Hochstiftes in das Fürstentum Lüneburg befürchtete. Demgegenüber akzeptierte es die Koadjuterie des Prinzen Friedrich von Schleswig-Holstein, eines Sohnes des dänischen Königs Christian IV., der die Autonomie des Hochstiftes zu garantieren versprach. 1619 nahm Philipp Sigismund Prinz Friedrich zum Koadjutor von Verden an. Gleichartige Bestrebungen in Osnabrück scheiterten am Widerstand des Domkapitels. Nachdem Philipp Sigismund am 19. März 1623 in Verden gestorben war, wo er im Dom seine letzte Ruhestätte fand, wählte man in Osnabrück bereits am 18./28. April entsprechend einer früheren päpstlichen Empfehlung Kardinal Eitel Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen zum Bischof.
Christian von Braunschweig-Lüneburg
Die Welfen betrachteten auch während der Regierungszeit Bischof Antons von Schaumburg Minden als ihr „Hausbistum“. Zwar scheiterten die Versuche Herzog Heinrich Julius‘, Bischof Anton gegen Zusicherung einer Rente zur Abdankung zu bewegen; aber im Domkapitel verbreitete sich die Ansicht, dass Braunschweig-Lüneburg nach dem Ausscheiden des Schaumburgers nur einen welfischen Kandidaten akzeptieren werde. Nachdem Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg (1564-1611) dem Kapitel territoriale Gewinne aus der an Celle gefallenen hoyaschen Erbschaft in Aussicht gestellt hatte, postulierte es Anfang September 1597 Ernsts jünegren Bruder Christian zum Koadjutor.30 Es kam damit einer Empfehlung des Kölner Kurfürsten Ernst von Bayern nach, der Christians Konversion zum Katholizismus für möglich hielt und davon nach dessen möglichen Regierungsantritt in Celle Vorteile für den Katholizismus in diesem Fürstentum erwartete. Als das Domkapitel nach dem Tod Antons von Schaumburg am 21. Januar 1599 Christian die Verwaltung des Stiftes übertrug, wiederholte dieser die Zusicherung seiner Wahlkapitulation von 1597, dass er die Rechte der katholischen Religion im Stift Minden schützen werde. Um die päpstliche Bestätigung zu erreichen, führte Christian auf Empfehlung Ernsts von Bayern Glaubensgespräche mit katholischen Theologen und schloss in seinem Konfirmationsgesuch an Papst Clemens VIII. einen Konfessionswechsel nicht aus. Die Erregung im protestantischen Lager, vor allem aber der Druck seitens des Hauses Braunschweig-Lüneburg, der in besonderer Weise von Christians Mutter, Herzogin Dorothea, ausgeübt wurde, veranlasste diesen, von einem Übertritt zur Katholischen Kirche abzusehen. Da Christian als lutherischer Fürst nie die päpstliche Wahlbestätigung erhielt, herrschte kirchenrechtlich in Minden weiterhin Sedisvakanz. Dieser Zustand wurde von der Kurie einstweilen ignoriert und vom Domkapitel geduldet. Damit schuf man eine Voraussetzung für die Säkularisation des Hochstiftes durch den Westfälischen Frieden, weil Minden während des Normaljahres 1624 nicht von einem katholischen Bischof regiert wurde.
Nach der Übernahme der Regierung im Fürstentum Lüneburg hielt sich Christian meist in Celle auf und schenkte den Vorgängen in Minden nur geringe Aufmerksamkeit. Während des Dreißigjährigen Kriegs wurde das Hochstift zu einem „Tummelplatz für die Soldateska aus allen Herren Ländern“.31 Nach dem Erstarken der katholischen Seite in Norddeutschland und der Verkündigung des Restitutionsediktes (1629) führte der kaiserliche Restitutionskommissar für den ober- und niedersächsischen Reichskreis, der Osnabrücker Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg, gegen Christians förmlichen Protest Rekatholisierungsmaßnahmen in Minden durch. 1630 providierte die Kurie, die an der Auffassung von der Sedisvakanz in Minden festgehalten hatte, Wartenberg mit dem Bistum, der daraufhin gegen Ende des Jahres auch ein vorläufiges kaiserliches Regalienindult erhielt. Wenn auch Verhandlungen mit Christian wegen eines Verzichts auf Minden ohne Erfolg blieben, überließ er Wartenberg bis zu seinem Tod am 8. November 1633 fast widerspruchslos die Regierung des Hochstiftes.
Die welfischen Bischöfe des 16. Jahrhunderts haben sich in erster Linie als Landesherren verstanden und tendierten dazu, in ihren Bistümern „Versorgungsposten ohne geistlich-kanonische Verpflichtung“32 zu sehen; von den Katholiken unter ihnen gingen keine ernsthaften kirchlichen Reformbemühungen aus. Durch ihren verweltlichten Lebenswandel diskreditierten sie die alte Kirche und leisteten der Ausbreitung der Reformation Vorschub, die von ihren protestantischen Nachfolgern direkt oder indirekt gefördert wurde. Die Tatsache, dass die Erz- bzw. Hochstifte Bremen, Verden, Osnabrück, Minden und Halberstadt im 16. Jahrhundert zeitweise in welfischer Hand waren, verwerteten die Vertreter des Hauses Braunschweig-Lüneburg auf dem Westfälischen Friedenskongress in Münster und Osnabrück, um ihre Forderung nach geistlichen Territorien zu untermauern. Allerdings konnte man sich gegen die Großmächte nicht durchsetzen. Bremen und Verden fielen an Schweden; Minden und Halberstadt wurden mit Rücksicht auf die nicht realisierte Anwartschaft auf Vorpommern Brandenburg zugewiesen. Lediglich für Osnabrück wurde mit der „successio alternativa“, nach der einem vom Domkapitel frei zu wählenden katholischen Kandidaten ein lutherischer Prinz aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg im Bischofsamt folgen sollte, eine Regelung gefunden, die welfischen Ansprüchen entgegenkam und letztlich mit dazu beitrug, dass das Hochstift im Zuge der Säkularisation von 1802/03 an das Kurfürstentum Hannover fiel.
1 M. v. Boetticher, Niedersachsen im 16. Jahrhundert (1500-1618), in: Heuvel, C. v. d. / Boetticher, M. v. (Hg.), Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von der Reformation bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (Geschichte Niedersachsens III,1), Hannover 1998, 99-116; allgemein: H.-G. Aschoff, Die Welfen. Von der Reformation bis 1918, Stuttgart 2010.
2 Vgl. K. Hengst, in: Gatz, E. (Hg.), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448-1648, Berlin 1996, 157f.; A. Schröer, Die Reformation in Westfalen II, Münster 1983, 41-51, 199-203; H.-J. Brandt / K. Hengst, Die Bischöfe und Erzbischöfe von Paderborn, Paderborn 1984, 192-195.
3 Vgl. A. Schröder, in: Gatz, E. (Hg.), Bischöfe, 754f.
4 Vgl. W. Kohl, in: Gatz, E. (Hg.), Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur Säkularisation, Freiburg 2003, 469-478.
5 A. Schröer, Reformation II, 25.
6 Vgl. H.-G. Aschoff, in: Gatz, E. (Hg.), Bischöfe, 192f.; A. Schröer, Reformation II, 23-28 u.ö.
7 Vgl. K. H. Schleif, Regierung und Verwaltung des Erzstifts Bremen am Beginn der Neuzeit (1500-1648), Hamburg 1972; H.-G. Aschoff, Bremen, Erzstift und Stadt, in: Schindling, A. / Ziegler, W. (Hg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung, Bd.3: Der Nordwesten, Münster 1995, 44-57; T. Vogtherr, Bremen (-Hamburg), in: Gatz, E. (Hg.), Bistümer, 113-127.
8 Vgl. T. Vogtherr, Verden, in: Gatz, E. (Hg.), Bistümer, 786-794; C. Burchhardt u. a., Bistum Verden 770 bis 1648, Straßburg 2001; M. Nistal, Die Zeit der Reformation und der Gegenreformation und die Anfänge des Dreißigjährigen Krieges (1511-1632), in: Dannenberg, H.-E. / Schulze, H.-J. (Hg.), Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser, Bd. 3: Neuzeit, Stade 2008, 1-171.
9 Vgl. H.-J. Schulze, in: Gatz, E. (Hg.), Bischöfe, 586-588.
10 Vgl. M. Reimann, in: Gatz, E. (Hg.), Bischöfe, 100-103.
11 Vgl. M. Nistal, Zeit, 2.
12 Vgl. M. Nistal, Zeit, 61-63.
13 K.H. Schleif, Regierung, 20.
14 Vgl. M. Reimann, in: Gatz, E. (Hg.), Bischöfe, 223f.; W. Schäfer, Wappen und Kreuz. Studie zum Leben des Verdener Bischofs, Herzog Georg von Braunschweig und Lüneburg (1494-1566), in: Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 76 (1978) 169-203; A. Schröer, Die Kirche in Westfalen im Zeichen der Erneuerung, Bd. 1: 1555-1648, Münster 1986, 38-50.
15 Vgl. P.-J. Heinig, Fürstenkonkubinat um 1500 zwischen Usus und Devianz, in: Tacke, A. (Hg.), „ ...wir wollen der Liebe Raum geben“. Konkubinate geistlicher und weltlicher Fürsten um 1500, Göttingen 2006, 11-37, hier 23-25.
16 Vgl. A. Schröer, Reformation II, 38-41.
17 Vgl. M. Nistal, Zeit, 56-58, 63f.
18 Vgl. W. Zöllner, Bistum Halberstadt, in: Gatz, E. (Hg.), Bistümer, 238-248; R. Joppen, Das Erzbischöfliche Kommissariat Magdeburg. Geschichte und Rechtsstellung bis zur Eingliederung in den Diözesanverband Paderborn, T. 1 u. 2, Leipzig [1964], 27-99.
19 Vgl. F. Jürgensmeier (Hg.), Erzbischof Albrecht von Brandenburg (1490-1545). Ein Kirchen- und Reichsfürst der Frühen Neuzeit, Frankfurt/M. 1991; A. Tacke (Hg.), Der Kardinal. Albrecht von Brandenburg. Renaissancefürst und Mäzen, Regensburg 2006.
20 Vgl. H.-G. Aschoff, in: Gatz, E. (Hg.), Bischöfe, 266-268.
21 Vgl. C. Römer, Wolfenbüttel und Halberstadt unter Herzog Heinrich Julius im Rahmen der mitteleuropäischen Konstellationen 1566-1613, in: Brosius, D. / Last, M. (Hg.), Beiträge zur niedersächsischen Landesgeschichte. Zum 65. Geburtstag von Hans Patze, Hildesheim 1984, 165-180.
22 Vgl. A. Schröer, Erneuerung I, 65-68; E. Bodemann, Die Weihe und Einführung des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig als Bischof von Halberstadt und die damit verbundenen Streitigkeiten 1578-1580, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen 43 (1878) 239-297.
23 Vgl. R. Joppen, Kommissariat, 31f.
24 Vgl. M. F. Feldkamp, in: Gatz, E. (Hg.), Bischöfe, 531f.; A. Schröer, Erneuerung I, 115-131.
25 Vgl. I. Mager, Die drei evangelischen Bischöfe von Verden, in: Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 86 (1988) 79-91; M. Nistal, Zeit, 64-73.
26 Vgl. M. Nistal, Zeit, 95-100.
27 Vgl. B. Roberg, Verhandlungen Herzog Philipp Sigismunds mit der Kurie und dem Kaiser über seine Anerkennung als Bischof von Osnabrück (1591-1598), in: Osnabrücker Mitteilungen 77 (1970) 31-93.
28 A. Schröer, Erneuerung I, 127.
29 Ch. v. d. Heuvel, in: Hehemann, R. (Bearb.), Biographisches Handbuch zur Geschichte der Region Osnabrück, Bramsche 1990, 225.
30 Vgl. H.-G. Aschoff, in: Gatz, E. (Hg.), Bischöfe, 99f.; A. Schröer, Die Kirche in Westfalen im Zeichen der Erneuerung, Bd. 2: 1585-1648, Münster 1987, 32-51.
31 R. Schwarz, Personal- und Amtsdaten der Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz von 1500 bis 1800, Köln 1914, 56.
32 P.-J. Heinig, Fürstenkonkubinat, 24.