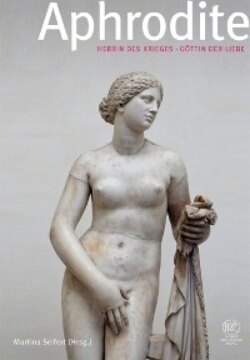Читать книгу Aphrodite - Группа авторов - Страница 7
VORWORT
ОглавлениеAphrodite – wer kennt sie nicht, die griechische Göttin der Liebe? Ihre bekannteste Rolle ist sicherlich jene im Vorspiel des trojanischen Krieges: als Liebesgöttin und listige Siegerin im olympischen Schönheitswettbewerb, ausgetragen zwischen den Göttinnen Hera, Athena und Aphrodite.
Diese waren, angestiftet durch Eris, die Göttin der Zwietracht, darüber in Streit geraten, wer die Schönste unter ihnen sei. Eris handelte ihrerseits auf Anweisung des Göttervaters Zeus, denn dieser plante die Überbevölkerung der Erde durch einen Krieg einzudämmen und zu diesem Zweck Unfrieden zwischen Göttern wie Menschen zu säen. Als Schiedsrichter für den Streit wurde schließlich der junge Paris erkoren, Sohn des trojanischen Herrscherpaares Priamos und Hekabe … und sehr empfänglich für den weiblichen Liebreiz. Aphrodite versprach ihm als Belohnung für sein Urteil die Ehe mit der schönen Helena und empfing auf diese Weise den goldenen Apfel der Hesperiden zum Zeichen ihrer herausragenden Schönheit. An der Tatsache, dass Helena bereits rechtmäßig mit dem Griechen Menelaos verheiratet war, störten sich weder sie noch Paris: Aphrodite ließ Helena in Liebe zu Paris entflammen und dieser entführte die Begehrte nach Troja, wohl wissend, dass er durch sein Verhalten die Gastfreundschaft des Menelaos auf das Schändlichste missbrauchte. Der weitere Verlauf der Ereignisse geriet ganz zur Zufriedenheit von Göttervater Zeus. Der Raub der Helena bot den willkommenen Anlass für den Ausbruch des trojanischen Krieges, von dem der Dichter Homer in seinem Epos Ilias (8. Jh. v. Chr.) ausführlich berichtet.
Doch nicht nur in Hinblick auf ihre Funktion im trojanischen Krieg ist die Göttin Aphrodite eine der interessantesten mythischen Frauengestalten der Antike, auch ihre Herkunft, oder in historischen Dimensionen gesprochen: Ihre kultische Genese bot immer wieder Anlass zu wissenschaftlichen Diskussionen. In der Literatur und bildenden Kunst haftet der Göttin meist etwas Fremdes und Zwiespältiges an, so verortet z. B. Herodot (5. Jh. v. Chr.) den Ursprung des Aphrodite-Kultes in den Nahen Osten (Herodot 1, 105) und in der modernen Forschung gelten kriegerische Gottheiten wie Astarte oder Inanna-Ištar als orientalische „Vorgängerinnen“ der Aphrodite, d. h. die Entstehung der griechischen Aphrodite-Figur wird zumindest zum Teil als das Ergebnis von Kulturkontakten zwischen den Griechen und den Völkern des Nahen Ostens begriffen. Eine andere These besagt, dass der Aphrodite-Kult von Zypern auf das griechische Festland und auf die Inseln des Mittelmeeres gelangte, sich also von dort aus verbreitete.
In jedem Fall kommt der im ostmediterranen Becken gelegenen Insel Zypern eine bedeutende kulturgeschichtliche Stellung zu. Diese bildet seit dem ausgehenden Neolithikum allein durch ihre Lage und ihre reichen Rohstoffvorkommen einen verkehrs- und handelsgeografischen Brennpunkt zwischen Griechenland einerseits und dem kleinasiatischen Festland, Ägypten sowie der Levanteküste andererseits. Dem Mythos zufolge soll Aphrodite an der Küste dieser Insel dem Meer entstiegen sein, entstanden aus dem Schaum des abgeschlagenen Gliedes des Uranos – auf jeden Fall belegen die Schriftquellen, dass die Göttin auf der Insel bereits früh in ihrer griechischen Gestalt als die Schaumgeborene verehrt wurde, während sie von den Griechen den Beinamen Kypris, die Zypriotin erhielt (Herodot 1, 105; Pausanias 1, 14,7). Auch die archäologischen Befunde liefern zahlreiche Hinweise auf einen Aphrodite-Kult auf Zypern, so sind aus Paphos und Amathus, zwei antiken Orten an der südlichen Küste der Insel, der Göttin geweihte Kultstätten bekannt; an beiden Orten wurde der Göttin sogar je ein Tempel zugeschrieben. Ob der Aphrodite-Kult bereits mit den Mykenern nach Zypern gelangte und ob – vor allem aber auf welche Weise – er sich mit indigenen Fruchtbarkeits- und Weiblichkeits-Kulten mischte, bleibt allerdings diskussionswürdig. Sicher ist jedoch, dass die Verehrung von Aphrodite auf Zypern bis in die römische Zeit hinein Bestand hatte, seit dem Hellenismus lässt sich zudem eine Verbindung zur ägyptischen Isis beobachten: Mit dieser verschmolz die Göttin – wie Inschriften, Bildzeugnisse aber auch die sakrale Architektur belegen – mancherorts in einem gemeinsamen Kult. An anderen Orten wurde Aphrodite im Sinne einer Aphrodite/Astarte in enger Nachbarschaft zu Isis verehrt.
Der lokalen, über die Jahrhunderte hinweg andauernden Entwicklung und Veränderung des Aphrodites-Kultes auf Zypern steht eine etwas anders geartete Tradition in Griechenland gegenüber. Trotz der nach Pausanias bezeugten weiten Verbreitung des Aphrodite-Kultes in Griechenland (z. B. Pausanias 2, 2,4), kennen wir aus diesem Gebiet nur vergleichsweise wenige Tempel und Stätten, die als konkrete und baulich fassbare Orte der Aphrodite-Verehrung dienten. Die meisten und detailliertesten Informationen stammen aus den schriftlichen Zeugnissen, allerdings sind diese Quellen hinsichtlich Zeit und Ort wenig kohärent: Am Abhang der Athener Akropolis soll Aphrodite zusammen mit Eros verehrt worden sein (SEG 10,27) und am Rande des athenischen Flusses Ilissos befand sich der Bezirk der Aphrodite Urania, den die Athener Bürgerinnen aufsuchten (Pausanias 1, 19,2) und schließlich erfahren wir von der Existenz eines Tempels für Aphrodite Praxis in der peloponnesischen Stadt Megara (Pausanias 1, 43,6). Auch wenn die Beschreibungen des Pausanias aus dem zweiten Drittel des 2. Jhs. n. Chr. unser Bild von Athen und Griechenland maßgeblich geprägt haben, muss doch bei allem Informationsgewinn im Gedächtnis behalten werden, dass diese Sichtweise eine römische ist und nicht die Zustände zur Zeit der griechischen Klassik oder gar der Frühzeit widerspiegelt.
Die Charakterisierung von Aphrodites Wesenheiten in griechischer Tradition entstammt ebenfalls zumeist hellenistischen und römischen Quellen – Tempelprostitution, Kriegswesen, aber auch die Fürsorge um junge Frauen und deren Fruchtbarkeit sollen unter dem Schutz der griechischen Göttin gestanden haben. Die vielfach angesprochene Ambiguität Aphrodites kommt in ihren unterschiedlichen Beinamen zum Ausdruck. So berichtet erneut Pausanias (1, 27,3) von Aphrodite, die als Göttin der Zeugung und Sexualität „en kyprois“ – „in den Gärten“ – den athenischen Oberschichtfrauen beistand. Diese Aphrodite unterstützte die Göttin Athena am Abhang der Akropolis bei der Betreuung frisch vermählter junger Frauen und deren Wunsch um Nachwuchs. Mit dem Beinamen Pandemos („dem Volk gehörig“) fungierte Aphrodite als Schützerin der gesamten Athener Bürgerschaft (Pausanias 1, 22,3; IG II2 659), während sie in ihrer Rolle als Aphrodite Euploia („glückliche Fahrt“) überwiegend von Männern als Schützerin der Schifffahrt verehrt wurde (IG II2 2872; Pausanias 2, 34,11). Eine umstrittene Stelle bei Strabon (8, 6,21), einem Historiker und Geografen des 1. Jhs. v. Chr., bringt Aphrodite mit der Tempelprostitution in Verbindung und auch Beinamen wie Porne („Hure“) deuten auf eine Funktion als Fürsprecherin der Hetären und Prostituierten.
Diese knappe Skizze der Wesenheiten der Aphrodite macht noch einmal deutlich: Eine Analyse der Funktionen der Göttin, und damit verbunden ihres Kultes, bedarf dringend einer topografischen wie zeitlichen Differenzierung. Dieser Eindruck verstärkt sich, blickt man auf die bildlichen Darstellungen der griechischen Aphrodite. Frühe Wiedergaben der Göttin finden sich auf Gefäßdarstellungen aus der zweiten Hälfte des 6. Jhs. v. Chr., z. B. auf der sogenannten Chigikanne aus den Jahren um 640/630 v. Chr., und zeigen Motive aus dem trojanischen Sagenkreis. Attische Vasenbilder seit dem 5. Jh. v. Chr. bilden Aphrodite beispielsweise in Begleitung von Eros, der Personifikation des sexuellen Begehrens, in sogenannten Frauengemachszenen ab. Andere Szenen stellen die Göttin einer Bürgerin gleich als frisch vermählte junge Ehefrau dar. Großplastische Werke, also Skulpturen, entstanden wohl erst ab der klassischen Periode, genauer: ab dem letzten Drittel des 5. Jhs. v. Chr. Die Bildhauer schufen in dieser Zeit plastische Gewandstatuen der Göttin, die uns nur selten als griechische Originale, wohl aber als römische Kopien oder Umbildungen erhalten sind. Unbekleidete Aphroditefiguren entstanden erst später und wurden besonders im Hellenismus beliebt. Eines der berühmtesten Bildhauerwerke ist die sogenannte knidische Aphrodite: Um 340 v. Chr. vom griechischen Bildhauer Praxiteles für den Tempel der
Abb. 1 Sandro Botticelli: Geburt der Venus (1482). Neben der „Venus von Milo“ (S. 2) ist dies die wohl berühmteste Darstellung der Aphrodite: Die Göttin wird auf einer Muschel an den Strand von Zypern gespült, angetrieben von Zephyros und Aura (links). Florenz, Uffizien.
Aphrodite Euploia im kleinasiatischen Knidos geschaffen, stand die Figur im Ruf, das erste und zugleich vollkommen unbekleidete Standbild einer Göttin zu sein. Mit Ausnahme einiger weniger Figuren, die eine nackte Aphrodite mit Schwert wiedergeben, bringen die Vasenbilder und die freiplastischen Figuren ganz klar Aphrodites Charakter als Göttin der Weiblichkeit und Schönheit zum Ausdruck.
Der Bogen ließe sich an dieser Stelle nun weiter nach Unteritalien und Sizilien spannen oder noch weiter nach Westen hin, wo sich wiederum eigene Traditionen der Rezeption und des Kultes herausbildeten. In diesem Buch muss jedoch trotz zahlreicher möglicher spannender Fragen und Problemfelder eine Auswahl getroffen werden.
Woher kommt nun Aphrodite? Und warum wird sie gelegentlich in Waffen abgebildet? In welcher Beziehung stehen ihre Genese und ihr Kult zu altorientalischen Gottheiten wie Inanna/Ištar, Astarte oder der Großen Göttin? Wie ist der Bildtypus der „Nackten Göttin“ entstanden, der Jahrhunderte nach seiner Ausbildung im Orient seine Nachläufer in den auf Zypern gefundenen Figuren einer weiblichen Fruchtbarkeitsgöttin – Aphrodite oder Astarte – fand? Darf man die phönizische Astarte, wie sie seit dem 9. Jh. v. Chr. in den durch die Phönizier okkupierten Städten in Zypern auftritt, so in Kition, als Schwester der kyprischen Göttin bezeichnen? Entwickelte sich Aphrodite aus den sogenannten Brettidolen? Welche Funktionen besaßen ihre frühen Gefährten Hephaistos und Adonis? Und wie kam es zur Verschmelzung von Aphrodite und der ägyptischen Isis in hellenistisch-römischer Zeit? Und schließlich: Woraus leitet sich die Rolle der Aphrodite klassischer Zeit auf Vasendarstellungen als Beobachterin mythischer Ereignisse und als Teilnehmerin in Genredarstellungen wie Liebesbegegnungen, Hochzeitsszenen und Bildern des Totenkultes ab?
Die Beiträge in diesem Buch behandeln den Wandel der als Aphrodite bezeichneten Göttergestalt von ihren möglichen Ursprüngen im Orient bis hin zu ihrer mythischen Gestalt im klassischen Griechenland. Im Grunde geht es bei den Ausführungen um die vielfältigen Aspekte einer beunruhigenden, in einer Götterfigur kanalisierten Weiblichkeit. Neben den verschiedenen Ausprägungen der lokalen Wesensmerkmale der Göttin sind über Zeit und Raum hinweg signifikante Veränderungen ihrer Geschlechterrolle zu beobachten. Auf Grundlage der materiellen Hinterlassenschaften und unter Hinzuziehung insbesondere von Schrift- und Bildquellen sollen diese vielfältigen, vor allem auch künstlerischen Umsetzungen des Wandels des antiken Bildes von Weiblichkeit in eingängiger Weise sichtbar gemacht werden. Nicht zuletzt gibt die Befassung mit Aphrodite die Gelegenheit, existente Kulturkontakte im Mittelmeergebiet aufzuzeigen – durch die Erläuterung von religiösen Praktiken, die durch die gegenseitige Beeinflussung verschiedener weiblicher Göttergestalten und ihrer Kulte in einer polytheistischen Welt entstanden sind.
Zur Entstehung des Bandes
Dieser Band verdankt seine Entstehung zum einen dem Wohlwollen von Frau A. Nünnerich-Asmus, Frau G. Klose und Herrn C. Hartz vom Verlag Philipp von Zabern, die es ermöglicht haben, diese Beiträge in dieser Form zu publizieren. Für ihre Unterstützung sei an dieser Stelle ein herzlicher Dank ausgesprochen.
Zum anderen beruht er auf dem beharrlichen Engagement seiner Autorinnen und seines Autors, die seit 2003 in einem Projekt zur zyprischen Aphrodite an der Universität Hamburg gemeinsam über diesen Themenkomplex geforscht haben. Das Vorhaben war von mir zunächst als berufsqualifizierendes Projekt für Hamburger Absolventinnen der Klassischen Archäologie initiiert worden. Ein Geländeaufenthalt 2003 auf Südzypern wurde durch den Frauenförderfonds der Universität Hamburg finanziell unterstützt. Vor Ort gewährten uns dankenswerterweise D. Michaelides, Direktor der Archaeology Research Unit, und E. Egoumenidou, Department of History and Archaeology, beide von der University of Cyprus, Nikosia, ihre Hilfe.
Im Sommersemester 2004 erfolgte die Präsentation der Studienergebnisse im Rahmen öffentlicher Vorträge in einer Ringvorlesung an der Universität Hamburg zum Thema „Aphrodite – Kult- und Kunstzeugnisse auf Zypern“. Im Herbst 2004 folgte ein zweiter Geländeaufenthalt der Projektgruppe auf Zypern (Nordteil).
Angeregt und motiviert durch die gemeinsame Forschungstätigkeit, organisierten die Absolventinnen eigenständig im Frühjahr 2005 die an NachwuchsforscherInnen gerichtete Tagung „Begegnungen – Materielle Kulturen auf Zypern“ in Hamburg. Eine finanzielle Unterstützung gewährte der Deutsche Archäologenverband e.V. Die Veranstaltung stieß auf reges nationales Interesse; der Tagungsband in Zusammenarbeit mit Sabine Rogge innerhalb der Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Zypernstudien ist 2007 erschienen.
Alle genannten Personen haben maßgeblich zum Gelingen dieses Vorhabens beigetragen. Mein Dank gilt zuletzt noch meinen Hamburger Kolleginnen und Kollegen für ihre vielfältigen Hinweise und Ratschläge.
Martina Seifert
Bern, im Januar 2009