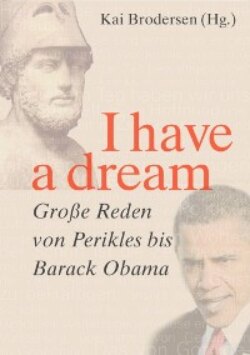Читать книгу I have a dream. - Группа авторов - Страница 11
Papst Urban II.: Aufruf zum Kreuzzug (1095)
ОглавлениеAm 27. November des Jahres 1095 drängte sich eine unübersehbare Menschenmenge vor den Mauern der Stadt Clermont in der Auvergne zusammen. Was war geschehen? Papst Urban II., der seit zehn Tagen in der Stadt weilte und das hierhin einberufene Konzil leitete, hatte für diesen Tag eine wichtige Rede angekündigt. Da offensichtlich mit einer großen Zuhörerschaft gerechnet wurde, war der Ort des Geschehens von der Kathedrale auf das weiträumige Gelände vor dem Osttor der Stadt verlegt worden, wo inmitten der herbeigeströmten Menge der Thronsessel des Papstes errichtet worden war.
Die Zuhörer hatten sicher das Gefühl, daß ihnen etwas Besonderes geboten wurde; schließlich hatte man auch im Mittelalter nicht jeden Tag die Möglichkeit, einen Papst leibhaftig von Angesicht zu Angesicht zu erleben. Aber wir dürfen auch annehmen, daß kaum einer der Anwesenden ahnen konnte, daß er geradezu Zeuge einer ‚historischen Sternstunde‘ werden würde. Erst dem Historiker bleibt es vorbehalten, aus der Rückschau heraus zu konstatieren, daß diese Papstrede gewissermaßen zur Initialzündung für eine große Massenbewegung wurde, die über zwei Jahrhunderte andauern sollte und unter dem Sammelbegriff ‚Kreuzzüge‘ in die Geschichte eingegangen ist.
Die Wirkung dieser Ansprache muß gewaltig gewesen sein. Schon während seiner Rede wurde der Papst immer wieder von Begeisterungsrufen der erregten Menge unterbrochen, und am Ende brach unter den Anwesenden fromme Ekstase oder eine Art Massenhysterie – wie man es auch nennen mag – aus. Unter den Rufen „Gott will es“ stürzte man sich auf rote, dann auch auf bunte Tücher, riß sie in Streifen, um hieraus Kreuzeszeichen zu bilden und sich diese an die Gewänder zu heften. Von Clermont aus sprang die Kreuzzugsbewegung – übermittelt von zahlreichen Wanderpredigern und unterstützt durch weitere päpstliche Aufrufe – in Windeseile auf das übrige Frankreich über, und wie ein großer Flächenbrand erfaßte sie bald das gesamte christliche Abendland – über alle Grenzen hinweg und quer durch alle Gesellschaftsschichten.
Natürlich war erste Voraussetzung für diesen Erfolg, daß der selbst aus Frankreich stammende Papst seine meist aus Landsleuten bestehende Zuhörerschaft nicht in der Kirchensprache Latein, sondern auf französisch ansprach, was auch die Laien verstehen konnten. Für die Wirkung war – dies wird man wohl kaum bezweifeln können – vor allem aber auch der Inhalt der Rede von entscheidender Bedeutung.
Doch was hat der Papst seinen Zuhörern eigentlich konkret gesagt? Obwohl vier Zeitgenossen, von denen einer mit Sicherheit und die anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit als Augen- und Ohrenzeugen bei dem großen Ereignis anwesend waren, alle eine „wörtliche“ Version der Rede zumindest in ihren wesentlichen Passagen überliefern, ist diese Frage nicht einfach zu beantworten. Denn alle vier Fassungen weichen nicht nur im Wortlaut, sondern auch in der Sache voneinander ab, was nicht verwundert, wenn man bedenkt, daß alle Autoren erst einige Jahre später unter dem Eindruck des ersten Kreuzzuges, der zur Eroberung Jerusalems und zur Gründung der Kreuzfahrerstaaten geführt hatte, ihren Bericht über die Rede niedergeschrieben haben. Im Grunde müssen wir daher davon ausgehen, daß keiner der Autoren eine historisch authentische Fassung der Rede bietet, sondern daß alle mehr oder weniger die eigene Bewertung in ihre Darstellung haben einfließen lassen und durch Auslassung ihrer Ansicht nach weniger wichtiger oder sogar durch Hinzufügung ursprünglich nicht enthaltener Passagen neue Akzente gesetzt haben. Vor diesem Hintergrund hat bereits die ältere Forschung (so D.C. Munro) versucht, durch einen sorgfältigen Vergleich der überlieferten zeitgenössischen Fassungen wenigstens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Kern der historischen Rede zu rekonstruieren. Dabei ist deutlich geworden, daß vor allem zwei Fassungen, obwohl sie sich selbst erheblich voneinander unterscheiden, doch zusammengenommen mit hoher Wahrscheinlichkeit alle wesentlichen Passagen der Originalrede enthalten. Da diese beiden Versionen auch vom angenommenen Abfassungszeitpunkt her dem Ereignis von Clermont zeitlich am nächsten kommen, sollen sie im folgenden in deutscher Übersetzung im Wortlaut wiedergegeben werden.
Besteht somit für den Leser wenigstens eine Chance, sich auf diese Weise einen unmittelbaren Eindruck von der Argumentation des Papstes zu verschaffen, verspricht der Vergleich dieser beiden Fassungen außerdem Antworten auf weitere in diesem Zusammenhang interessierende Fragen zu geben: Welche Gründe waren es eigentlich, die die Massen damals dazu bewogen haben, den Aufrufen zu folgen und sich den Kreuzzügen anzuschließen? Und: Entsprach die entstehende Massenbewegung eigentlich den ursprünglichen Intentionen des Papstes oder entfaltete sie bald eine Eigendynamik, auf die die Kurie nur noch reagieren konnte?
Bei den beiden Versionen der Papstrede, die nun näher betrachtet werden sollen, stammt die erste aus der Feder des Chronisten Fulcher von Chartres (1059-1127), der nach allgemeiner Auffassung als Ohrenzeuge das Ereignis von Clermont miterlebte, anschließend im Gefolge zunächst des Grafen Stefan von Blois, dann als Kaplan Balduins von Boulogne, des späteren Grafen von Edessa und Königs von Jerusalem, am ersten Kreuzzug teilnahm. Wahrscheinlich als Kanoniker der Grabeskirche in Jerusalem schrieb er bereits kurz nach 1100 seine Erlebnisse im Rahmen der ersten Redaktion seiner Geschichte des Königreichs Jerusalem (Historia Hierosolymitana) nieder, wobei ihm die Forschung für sein gesamtes Werk, was Zuverlässigkeit und Detailtreue angeht, ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt hat.
Die zweite Version verdankt ihre Entstehung einer Initiative des Abts Bernhard von Marmoutier, der in der Zeit zwischen 1101 und 1107 auf eine anonyme Geschichte des ersten Kreuzzuges (Gesta Francorum) gestoßen war, die, da sie über die Anfänge wenig berichtete, sein Mißfallen erregt hatte. Er veranlaßte daher den Benediktinermönch Robert vom Remigiuskloster in Reims, der als Augenzeuge am Konzil in Clermont teilgenommen hatte, die Chronik entsprechend zu überarbeiten und zu ergänzen. Robert der Mönch dürfte sich dieser Aufgabe kaum vor 1102, wahrscheinlich erst einige Jahre später, angenommen haben. Auch der hieraus entstandenen, im Mittelalter sehr verbreiteten Chronik hat die Forschung einen hohen Quellenwert bescheinigt.
Vergleichen wir nun die beiden Fassungen miteinander, so werden zunächst – bei allen Unterschieden im einzelnen – doch die Grundlinien der Ansprache deutlich: Schon seit längerem sind beunruhigende Nachrichten aus dem Orient an das Ohr des Papstes gedrungen. Vor allem das ruchlose Volk der Türken hat die christlichen Glaubensbrüder in mehreren Schlachten besiegt und ist weit auf das Gebiet des byzantinischen Reiches vorgedrungen. Unzählige Christen wurden dabei getötet und gefangengenommen. Die Angreifer haben die Kirchen zerstört und das Land verwüstet; es ist daher dringend erforderlich, die schon oft erbetene und versprochene Hilfe jetzt schnell und entschlossen zu leisten und die gepeinigten Glaubensbrüder vom Joch der Ungläubigen zu befreien. Deshalb bittet und ermahnt der Papst – und nicht nur er, sondern Gott selbst – alle An- und Abwesenden, statt in privaten Fehden in verwerflicher Weise gegen Glaubensbrüder zu kämpfen, Krieg gegen die Ungläubigen zu führen. Denen, die diesem Aufruf folgen, verspricht er kraft der ihm von Gott erteilten Vollmacht (in einer nicht ganz klaren Form) Vergebung ihrer Sünden.
Haben wir jetzt auch eine – nur grobe – Vorstellung vom Inhalt der päpstlichen Rede gewonnen, so wird diese doch erst verständlich, wenn wir den allgemeinen historischen Hintergrund zur Zeit des Clermonter Konzils mit in die Betrachtung einbeziehen.
Aus der Rückschau gesehen waren die Aussichten für die Kreuzzugsbewegung im Jahre 1095, als der Papst seine berühmte Rede hielt, auf den ersten Blick denkbar ungünstig. Seit dem Jahr 1054 war die Einheit zwischen der päpstlichen Kirche des Abendlandes und der byzantinischen Ostkirche zerbrochen. Nachdem schon früher mannigfache Spannungen die Beziehungen belastet hatten, kam es in diesem Jahr in Fragen des Dogmas und der Liturgie zum endgültigen Bruch, der mit der gegenseitigen Exkommunikation der beiden Kirchenoberhäupter für immer besiegelt schien. Aber auch die abendländisch-christliche Kirche selbst wurde in dieser Zeit von erbitterten Auseinandersetzungen erschüttert. Denn noch immer tobte der Investiturstreit zwischen Kaiser und Papst, wenn auch der Höhepunkt nach dem berühmten Canossagang Heinrichs IV. und nach dem Tode des streitbaren Papstes Gregor VII. bereits überschritten war. Kaiser Heinrich IV. befand sich – wieder, muß man sagen – im Kirchenbann. Noch zu Lebzeiten Gregors hatte er auf seine Weise die Auseinandersetzung geführt, indem er einen Gegenpapst hatte aufstellen lassen, der nach wie vor – nun gegen Urban – seine Ansprüche auf den Stuhl Petri verfocht. Am Vorabend der Kreuzzüge war also nicht nur die Kirche insgesamt gespalten, sondern es gab auch zwei Päpste, wenn auch der vom Kaiser protegierte Gegenpapst nurmehr ein Schattendasein führte.
Fiel somit schon der Kaiser als weltliches Oberhaupt der Christenheit für den Kreuzzug aus, so waren auch die westeuropäischen Könige hierfür nicht einzusetzen. Der französische König Philipp I. (1060-1108) hatte seine ihn langweilende Ehefrau verstoßen und eine – ebenfalls verheiratete – französische Adlige entführt. Das sittenstrenge Reformpapsttum reagierte mit aller Härte, und die Synode von Clermont hatte unter anderem die delikate Aufgabe, gegen den Frevler in dessen eigenem Lande die höchste Kirchenstrafe, die Exkommunikation, zu verhängen.
Auch der englische König Wilhelm Rufus war für den Kreuzzug nicht ansprechbar, da er ganz damit beschäftigt war, mit der ihm eigenen, wenig kirchenfreundlichen Einstellung die normannische Herrschaft in England, die sein Vater Wilhelm der Eroberer begründet hatte, gegenüber Adel und Kirche weiter auszubauen.
Wie kam der Papst dazu, angesichts dieser – wie es scheint – wenig günstigen Umstände die Christenheit zu einem gemeinsamen militärischen Unternehmen gegen die Muslime im Orient aufzurufen? Um dies zu verstehen, muß man sich zunächst vergegenwärtigen, daß sich im Verlauf des 11. Jahrhunderts auch innerhalb des islamischen Machtbereiches in Kleinasien bedeutsame Wandlungen vollzogen hatten.
Hier war mit dem aus Innerasien stammenden Volk der Türken eine neue Macht ins Licht der Geschichte getreten, die von nun an die Entwicklung im Osten entscheidend bestimmen sollte. Im Vergleich zu den hochzivilisierten Arabern handelte es sich zunächst um wenig kultivierte Scharen, die von den Arabern als Söldner angeheuert wurden. Vor allem dem türkischen Stamm der Seldschuken gelang es dabei jedoch bald, die arabische Welt völlig zu unterwandern und ein neues Großreich zu errichten, so daß auch in Kleinasien fast der gesamte islamische Machtbereich im Laufe des 11. Jahrhunderts zu einer türkischen Domäne wurde.
Die neuen Herren, die den islamischen Glauben angenommen hatten, erfüllten bald auch die Idee des Dschihad, des heiligen Krieges nach islamischer Lehre, wieder mit neuem Leben, indem sie die alten Angriffsziele gegen die Ungläubigen wieder aufnahmen. Dies mußte vor allem das byzantinische Kaiserreich erfahren, wo man nach der militärischen Katastrophe von Manzikert (1071) nicht verhindern konnte, daß sich in Anatolien das sogenannte ‚Rum-Seldschuken-Sultanat‘ (von Rum = [Ost-]Rom abgeleitet) mit dem Zentrum in Ikonium (heute Konya) herausbildete. Vor dem Hintergrund dieser prekären Situation entschloß sich der byzantinische Kaiser Alexios Komnenos (1081-1118) dazu, das westliche Abendland um Hilfe zu bitten. Auf der Synode von Piacenza erschien im Frühjahr des Jahres 1095 eine byzantinische Gesandtschaft, die vor dem Papst und dem versammelten Klerus in düstersten Farben die Unterdrückung der Christen durch die Türken im Orient schilderte und um die Entsendung von Söldnertruppen bat. Wenn die Berichte über die Situation der Christen in Kleinasien nach dem heutigen Forschungsstand auch stark übertrieben erscheinen, so zeigte sich doch Papst Urban II. hiervon tief beeindruckt.
Dazu kam, daß das Kirchenoberhaupt hier wohl eine Möglichkeit sah, über eine Verständigung mit dem byzantinischen Kaiser auch das Schisma im Sinne der römischen Kurie zu überwinden, zumal Alexios Komnenos in dieser Frage auch Entgegenkommen signalisiert hatte.
Endlich entsprach es auch dem neuen Selbstverständnis des Reformpapsttums, seinen Führungsanspruch gegenüber den weltlichen Gewalten, vor allem gegenüber dem Kaiser, durch ein von ihm initiiertes spektakuläres militärisches Unternehmen auf eindrucksvolle Weise zu demonstrieren. Aus der Rückschau gesehen stand somit die geschilderte trostlose politische Lage der Kreuzzugsbewegung nur scheinbar im Wege; in Wirklichkeit bot gerade der Umstand, daß der Kaiser und die westeuropäischen Könige ausfielen, dem Papst die Möglichkeit, seine hohe moralische Autorität auszuspielen und sich unmittelbar an die abendländische Ritterschaft zu wenden.
Kehren wir zu den ausgewählten Fassungen zurück, fallen – wie bereits angedeutet – neben den gemeinsamen Grundaussagen doch auch bemerkenswerte Unterschiede ins Auge. Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt zunächst die von Fulcher von Chartres stammende Version der Papstrede, so ist zunächst festzuhalten, daß es sich um die kürzeste aller überlieferten Fassungen handelt, die die Rede nur in einem gedrängten, notwendigerweise stark verkürzten Abriß wiedergibt. Dabei liegt der Schluß nahe, daß die selbst auferlegte Beschränkung den Autor auch dazu nötigte, sich auf die in seinen Augen wichtigsten Passagen zu Lasten des weniger Wichtigen zu beschränken. Dabei ist nun interessant, daß Fulcher einen Komplex, den nicht nur die von Robert dem Mönch stammende, sondern auch alle anderen überlieferten Fassungen ausführlich thematisieren, mit keinem Wort erwähnt: das zentrale Kriegsziel des ersten Kreuzzuges, die Befreiung des Heiligen Grabes und damit die Stadt Jerusalem aus der Hand der Ungläubigen. Dies erscheint um so verwunderlicher, als Jerusalem – und darüber besteht in der Forschung Einigkeit – nicht nur als Kriegsziel des ersten Kreuzzuges, sondern auch für die Motivation im Rahmen der Kreuzzugsbewegung an sich eine zentrale Rolle gespielt hat. In diesem Zusammenhang müssen wir uns vor Augen halten, daß allein der bloße Namen ‚Jerusalem‘ bei den Menschen des 11. Jahrhunderts ganz außergewöhnliche Assoziationen und Vorstellungen erweckte, die von uns heute nurmehr schwer nachempfunden werden können. Jerusalem, das war nicht nur die heilige Stadt, in der Christus am Kreuz gelitten hatte und auferstanden war; Jerusalem war in den Augen der Zeitgenossen auch eine unvorstellbar reiche Stadt, in der ‚Milch und Honig flossen‘ und deren Mauern und Türme mit Gold und Edelsteinen besetzt waren. Da man diese Vorstellungen nicht nur auf das Jenseits, sondern ganz konkret auch auf das irdische Leben bezog, erschien Jerusalem in der Vorstellungswelt breiter Bevölkerungskreise als Ziel aller Sehnsüchte und Glückseligkeit – kurz: als eine Art Inkarnation des paradiesischen Endzustands auf Erden.
Wie ist es also angesichts dieser Vorstellungen zu erklären, daß nach Fulcher von Chartres der Papst nur allgemein von der Hilfe für die Ostkirchen gesprochen und den Namen Jerusalems dabei aber gar nicht erwähnt haben soll, während alle anderen Chronisten die Befreiung der Stadt und des heiligen Grabes geradezu in das Zentrum der päpstlichen Rede rückten? Verschob Fulcher hier aus der Erinnerung heraus bewußt oder unbewußt die Akzente der Papstrede, oder hat Urban II. in Clermont wirklich nur die Ostkirchen insgesamt im Blick gehabt und Jerusalem selbst gar nicht oder nur am Rande erwähnt?
Ist man auf den ersten Blick auch geneigt, sich unter dem Eindruck der in diesem Punkt übereinstimmenden Berichte der übrigen drei Zeitzeugen gegen Fulchers Version zu entscheiden, so geht doch ein Teil der Forschung (so H.E. Mayer) mit guten Gründen davon aus, daß die Befreiung Jerusalems zunächst wirklich nicht im Zentrum der Überlegungen des Papstes stand und daher in seiner Rede in Clermont auch nicht oder allenfalls nur am Rande angesprochen wurde. Hiernach scheint es vielmehr so gewesen zu sein, daß der Papst und seine Berater – trotz der getroffenen Vorbereitungen – selbst von der ungeheuren, an Massenhysterie grenzenden Wirkung der Rede überrascht wurden, wobei die nun entstehende Kreuzzugsbewegung schnell eine Eigendynamik entwickelte und damit der Kontrolle ihrer Initiatoren mehr und mehr entglitt. Hatte der Papst in Clermont noch lediglich zur militärischen Hilfe für die bedrängten Ostkirchen aufgerufen, wurde diese eher vage Aufforderung von den zahllosen Wanderpredigern und ihren Zuhörern schnell in ein den Sehnsüchten der Massen entgegenkommendes konkretes Kriegsziel umgedeutet: die Befreiung des Heiligen Grabes in Jerusalem. Unter dem Eindruck dieser Entwicklung blieb der Kurie kaum eine andere Wahl, als das Beste aus der Situation zu machen und das neue Kriegsziel zu akzeptieren.
Für die These, daß Urban II. von der Wirkung seiner Rede selbst überrascht wurde und dann vor der mit der Kreuzzugsbewegung entstehenden ‚öffentlichen Meinung‘ kapitulierte, sprechen auch zwei weitere Punkte der Papstrede in der Fassung Fulchers, die sich in dieser Form bei den anderen Zeitzeugen nicht finden.
Dies gilt zunächst für Fulchers Bericht, wonach Papst Urban ausdrücklich alle, ob reich oder arm, ob Ritter oder Fußkämpfer, zum Krieg gegen die Ungläubigen aufgerufen, während nach Robert dem Mönch der Papst sich vor allem an die französische Ritterschaft gewandt habe. Für Fulchers Version spricht dabei, daß zunächst gerade die Armen – und dabei sogar Kranke, Alte, Frauen und Kinder – sich dazu berufen fühlten, am Kampf gegen die Ungläubigen teilzunehmen. Diese Entwicklung gipfelte dann in einer Massenbewegung der Unterschichten, im sogenannten ‚Kreuzzug der Armen‘, dessen Teilnehmer unter der Führung Peters des Einsiedlers und anderer bereits Monate vor dem Ritterheer des ‚offiziellen‘ Kreuzzugs Anatolien erreichten, aber bereits bei der ersten Feindberührung von den Seldschuken fast vollständig niedergemetzelt wurden. Wie auch mahnende Aufrufe des Papstes unmittelbar nach seiner Rede erkennen lassen, entsprach diese Entwicklung kaum den päpstlichen Zielvorstellungen, war aber von der Kurie auch nicht mehr zu bremsen.
Daß sich die Kreuzzugsbewegung sehr schnell von den ursprünglichen Intentionen der Kirche entfernte, wird auch am Beispiel der berühmt gewordenen Passage der Rede deutlich, in der Urban II. kraft seiner von Gott erhaltenen Vollmacht geistlichen Lohn für die Teilnahme an dem Unternehmen in Aussicht stellte. Wenn auch die Tatsache, daß der Papst ein solches Versprechen abgab, kaum bezweifelt werden kann, lassen bereits die beiden ausgewählten Fassungen erhebliche Unterschiede über den Umfang dieses Versprechens erkennen. Während nach Fulcher von Chartres nur denen, die während des Unternehmens den Tod fanden, die „Vergebung ihrer Sünden“ versprochen wurde, sollte dies nach Robert dem Mönch für alle gelten, auch für die überlebenden Teilnehmer. Dazu kam, daß Papst Urban offensichtlich unter „Vergebung der Sünden“ etwas anderes meinte, als die Masse der Zuhörer und vor allem die „öffentliche Meinung“ der sich formierenden Kreuzzugsbewegung später hierunter begriffen haben.
Um dies zu verstehen, muß man sich die katholische Kirchenlehre zum Sündenerlaß vor Augen führen – und zwar in der Form, in der sie gegen Ende des 11. Jahrhunderts ausgebildet war. Hiernach erlangte der reuige Sünder durch die Beichte und die anschließende Absolution die Vergebung seiner Sündenschuld durch Gott, verbunden mit der Umwandlung der ewigen Höllenstrafe in zeitlich begrenzte Sündenstrafen, die ihn bereits auf dieser Erde oder auch im Jenseits, in der Form des Fegefeuers, treffen konnten. Im Rahmen des Bußsakraments wurde also nach katholischer Lehre nur die Sündenschuld getilgt; die Folgen der Sünden blieben als von Gott verhängte zeitliche Sündenstrafen bestehen. Um diese zu tilgen, erlegte die Kirche dem Sünder im Anschluß an die Absolution gewisse Bußleistungen – als Anrechnung auf die zu erwartenden Sündenstrafen – auf. Damit beim jüngsten Gericht Gott das „Bußangebot“ als Äquivalent der verwirkten Sündenstrafen anerkannte, neigte man in der frühmittelalterlichen Praxis regelmäßig dazu, harte Bußstrafen auszusprechen. Trotzdem konnte niemand – auch nicht der Papst – garantieren, daß Gott dieses Angebot akzeptieren und dem Sünder alle Sündenstrafen erlassen werde. Wie vor diesem Hintergrund das Versprechen Urbans II. auf „Sündenerlaß“ zu verstehen war, geht deutlich aus dem hierzu einschlägigen, offiziellen Konzilsbeschluß von Clermont hervor, wonach allen, die allein aus Frömmigkeit am Kreuzzug teilnahmen, diese Teilnahme „an Stelle aller kirchlich auferlegter Bußstrafen“ (pro omni poenitentia) angerechnet werden sollte. Der Papst versprach daher in seiner Rede sicher nur das, was er – theologisch vertretbar – auch versprechen konnte, wobei dies angesichts der verbreiteten drakonischen Bußpraxis auch nicht wenig war.
Genauso sicher scheint aber zu sein, daß bereits die meisten Zuhörer in Clermont wie auch die zahllosen Wanderprediger, die den Aufruf an der Basis weiter vermittelten, das Versprechen des Papstes gründlich mißverstanden haben, nämlich im Sinne einer Garantie der Kirche, daß Gott die Teilnahme am Kreuzzug mit dem Erlaß der Sündenstrafen belohnen werde. Daß es zu diesem Mißverständnis kommen konnte, lag dabei nicht nur an der komplizierten Lehrmeinung, die einfache Gemüter wohl überforderte, sondern auch an dem vereinfachenden Sprachgebrauch des „Sündenerlasses“ (remissio peccatorum), dessen sich nicht nur der Klerus an der Basis, sondern auch der Papst selbst – abgesehen von seiner Rede – in offiziellen Schreiben bediente. Bezeichnend ist auch hier, daß Papst und Kurie angesichts der ihrer Kontrolle entglittenen Kreuzzugsbewegung weder in der Lage noch ernstlich daran interessiert waren, die „öffentliche Meinung“ wieder in Einklang mit der offiziellen Lehre der Kirche zu bringen. Man zog es vielmehr vor, den Widerspruch zwischen Praxis und Theorie dadurch aufzuheben, daß man gewissermaßen eine theoretische Begründung für die eingerissene Praxis nachlieferte. Als solche wurde wohl nicht vor dem Ende des 12. Jahrhunderts dann die Lehre vom ‚Kirchenschatz‘ entwickelt, die davon ausging, daß die Kirche über einen umfangreichen ‚Gnadenschatz‘ verfüge, der – gespeist durch das Leiden Christi und die Verdienste aller Heiligen und Märtyrer – sie in die Lage versetze, Gott in jedem Fall ein den verwirkten Sündenstrafen angemessenes Bußersatzangebot zu unterbreiten. Jetzt erst – mit der Besinnung auf den ‚Kirchenschatz‘– wurde die theoretische Grundlage für die sich von nun an weiter entwickelnde katholische Ablaßlehre geschaffen.
Beide Zeitzeugen, Fulcher von Chartres wie auch Robert der Mönch, dürften das Versprechen Papst Urbans II. in Clermont als Erlaß der Sündenstrafen mißverstanden haben. Dabei scheint wieder Fulcher von Chartres dem Konzil und den ursprünglichen Intentionen des Papstes und der Kurie näher zu kommen als Robert der Mönch. Als einziger der Zeitzeugen, die über die Rede berichteten, scheint er die Worte des Papstes, wie er sie verstand, als eine theologische Neuerung von außergewöhnlicher Tragweite erkannt zu haben, die seiner Ansicht nach nicht wahllos auf alle, sondern nur auf einen engeren Kreis von Teilnehmern anwendbar war. In diesem Sinne war es folgerichtig, daß nach seiner Version das päpstliche Ablaßangebot in Clermont auf die Teilnehmer beschränkt war, die „auf der Fahrt, zu Lande oder zu Wasser oder in der Schlacht gegen die Heiden ihr Leben verlieren“. Da weder der offizielle Konzilsbeschluß noch die übrigen überlieferten Versionen der Papstrede von dieser Beschränkung ausgehen, spricht wenig dafür, daß der Papst wirklich die Worte gebraucht hat, die ihm Fulcher von Chartres in den Mund legt. Eher zeigt sich hier wohl der Versuch des gebildeten Theologen, das päpstliche Versprechen mit der überlieferten Kirchenlehre in Einklang zu bringen, da diejenigen, die im Auftrag der Kirche für den christlichen Glauben ihr Leben gewissermaßen als Märtyrer verloren, nach Fulchers Ansicht mit einer – im Vergleich zu den übrigen Teilnehmern – höheren, schon an Gewißheit grenzenden Sicherheit darauf hoffen konnten, daß ihr Opfer mit der Fürbitte des Papstes auch im Angesicht Gottes ausreichen werde, alle fälligen Sündenstrafen zu tilgen.
Im Gegensatz zu den anderen Zeitzeugen scheint Fulcher in seiner Version außerdem den Lohngedanken auf das Versprechen geistlichen Lohnes beschränkt zu haben. So fehlen nicht nur Hinweise darauf, daß die eroberten Länder an die Kreuzfahrer fallen sollen, sondern nach Fulcher gab der Papst seinen Zuhörern auch die Aufforderung mit auf den Weg, daß die, die bisher für billigen Lohn als Soldritter gekämpft hatten, nun die Chance nützen sollten, ewigen Lohn zu erringen. Diese Konzentration auf den geistlichen Lohn entsprach auch dem offiziellen Konzilsbeschluß der für den Sündenerlaß voraussetzte, daß der Begünstigte „allein aus Frömmigkeit, nicht, um Ehre oder Geld zu erwerben“ (Mansi 1767, S. 816), handelte. Ganz anders hört sich dies bei Robert dem Mönch an, wenn dieser den Papst sprechen läßt: „Tretet den Weg zum Heiligen Grab an, nehmt das Land dort dem gottlosen Volk, macht es euch untertan! Gott gab dieses Land in den Besitz der Söhne Israels; die Bibel sagt, daß dort Milch und Honig fließen …“. Nach Roberts Version führte der Papst im Zusammenhang mit dem Lohngedanken in seiner Rede auch noch ein besonderes Argument für eine Teilnahme am Kreuzzug an, das in dieser Form in den anderen Fassungen nicht überliefert ist: „Denn“, so läßt Robert den Papst sprechen, „dieses Land, in dem ihr wohnt, ist allenthalben von Meeren und Gebirgszügen umschlossen und beängstigend dicht besiedelt. Es fließt nicht vor Fülle und Wohlstand über und liefert seinen Bauern kaum die bloße Nahrung …“ Diese Feststellung wurde auch von der historischen Forschung bestätigt, die nach wie vor in der Überbevölkerung und ihren gravierenden Folgen für die Sozial- und Wirtschaftsstruktur einen bedeutenden Motivkomplex und damit auch eine wichtige Erklärungsmöglichkeit (von vielen) für die Entstehung der Kreuzzugsbewegung sieht.
Papst Urban II.: Aufruf zum Kreuzzug am 27. November 1095
Version bei Fulcher von Chartres
Nachdem dieses und noch anderes mehr in angemessener Form erläutert worden war, dankten alle Anwesenden, Kleriker und Laien, Gott, stimmten spontan den Worten des Herrn Papstes Urban zu und bekräftigten durch ein Treueversprechen, dessen Anordnungen genau einzuhalten. Doch alsbald fügte er [der Papst] noch hinzu, daß Weiteres, noch Schlimmeres an Heimsuchung als das bereits Angesprochene aus einer anderen Weltgegend der Christenheit drohe, und fuhr fort:
„Nachdem ihr, Söhne Gottes, also Gott bereits versprochen habt, noch mannhafter als gewohnt dafür einzustehen, Frieden unter euch zu halten und die Rechte der Kirche zu wahren, bleibt als lohnende Aufgabe, daß ihr, durch die göttlich erhabene Zurechtweisung soeben ermuntert, eure ganze Kraft auf eine andere, Gott und euch gleichermaßen berührende Angelegenheit richtet. Es ist nämlich erforderlich, euren Brüdern im Orient die schon oft versprochene Hilfe auf schnellstem Wege zu bringen. Wie den meisten von euch bekannt ist, haben die Türken, ein persisches Volk, sie angegriffen und sind bis zum Mittelmeer und dabei bis zu jenem Abschnitt, den man den Arm Sankt Georgs [Bosporus] nennt, vorgegestoßen. Als sie im Lande von Romanien [Byzanz] immer tiefer in christliche Länder vordrangen, haben sie die Christen öfter in Schlachten besiegt, wobei sie viele töteten oder in Gefangenschaft verschleppten, Kirchen zerstörten und das Reich Gottes verwüsteten. Würde man sie unbehelligt lassen, so würden die Getreuen Gottes in einem noch weiteren Umkreis unterjocht werden. Deshalb bitte ich euch demütig und ermahne euch, aber nicht nur ich, sondern der Herr ermahnt euch, daß ihr als Herolde Christi allen, welchen Standes sie auch sind, Rittern und Fußkämpfern, Reichen und Armen durch häufige Bekanntmachung zuredet, alles daran zu setzen, unverzüglich den dort wohnenden Christen zu Hilfe zu kommen, um dieses nichtswürdige Volk aus unseren Gebieten zu vertreiben. Ich spreche zu den Anwesenden, den Abwesenden trage ich es auf, es ist aber Christus, der befiehlt. Allen aber, die dort hinziehen und während der Fahrt, zu Lande oder zu Wasser oder im Kampf mit den Heiden, ihr Leben verlieren, wird die Vergebung ihrer Sünden (remissio peccatorum) zuteil werden. Was ich ihnen zusage, gewähre ich kraft des mir von Gott verliehenen Amtes. Welche Schande wäre es, wenn ein so verachtenswertes, verkommenes und vom Teufel besessenes Gezücht gegenüber dem Volk des allmächtigen Gottes, auf welches, gestärkt durch den Glauben, der Name Christi seinen Glanz wirft, dermaßen die Oberhand behielte! Wie groß wird die Schmach sein, die Gott selbst euch zurechnen wird, wenn ihr nicht denen zu Hilfe kommt, die, wie ihr, zu den Bekennern des christlichen Glaubens gezählt werden! Mögen diejenigen, die sich bisher daran gewöhnt haben, auf verwerfliche Weise ihre Privatfehden gegen Glaubensgenossen zu führen, gegen die Ungläubigen kämpfen und diesen Krieg, der schon längst hätte begonnen werden sollen, zum siegreichen Ende bringen. Mögen die, die Räuber waren, zu Kämpfern Christi werden und die, die einst gegen ihre Brüder und Verwandten fochten, jetzt mit Recht gegen die Barbaren vorgehen. Mögen die, die noch vor kurzem Söldner für geringen Lohn waren, jetzt die ewige Belohnung gewinnen. Mögen die, die bisher ihre Kräfte erschöpft haben zu Lasten von Leib und Seele, sich jetzt anstrengen für eine doppelte Ehre. Was soll man noch mehr dazu sagen? Auf der einen Seite werden die Unseligen und Armen sein, auf der anderen aber die Glücklichen und wirklich Reichen; hier die Feinde des Herrn, dort aber seine Freunde. Der Aufbruch soll ohne Verzögerung erfolgen. Nachdem sie ihre Besitzungen verpachtet und sich das für die Reise erforderliche Geld beschafft haben, sollen die Kämpfer sich, wenn der Winter zu Ende geht und der Frühling kommt, unter Führung des Herrn entschlossen auf den Weg machen.“
Papst Urban II.: Aufruf zum Kreuzzug am 27. November 1095
Version bei Robert dem Mönch
Im Jahr der Fleischwerdung des Herrn 1095 wurde auf französischem Boden ein großes Konzil gefeiert, und zwar in der Auvergne, in einer Stadt namens Clermont. Den Vorsitz führte Papst Urban II., begleitet von römischen Bischöfen und Kardinälen. Dieses Konzil war von Bischöfen und auch Fürsten aus Frankreich und Deutschland ganz ungewöhnlich stark besucht. Nachdem die kirchlichen Angelegenheiten erledigt waren, ging der Herr Papst auf einen weiträumigen Platz hinaus, denn kein geschlossener Bau konnte die ganze Menge fassen. Hier setzte der Papst zu folgender Ansprache an, die sich voll Überzeugungskraft und Redekunst an alle und jeden wandte:
„Ihr Volk der Franken, ihr Volk nördlich der Alpen, ihr seid, wie eure vielen Taten erhellen, Gottes geliebtes und auserwähltes Volk, herausgehoben aus allen Völkern durch die Lage des Landes, die Katholizität des Glaubens und die Hochschätzung für die heilige Kirche. An euch richtet sich unsere Rede, an euch ergeht unsere Mahnung; wir wollen euch wissen lassen, welcher traurige Anlaß uns in euer Gebiet geführt, welche Not uns hierher gezogen hat; sie betrifft euch und alle Gläubigen. Aus dem Land Jerusalem und der Stadt Konstantinopel kam schlimme Nachricht und drang schon oft an unser Ohr: Das Volk im Perserreich, ein fremdes Volk, ein ganz gottfernes Volk, eine Brut von ziellosem Gemüt und ohne Vertrauen auf Gott [Psalm 77, 8], hat die Länder der dortigen Christen besetzt, durch Mord, Raub und Brand entvölkert und die Gefangenen teils in sein Land abgeführt, teils elend umgebracht; es hat die Kirchen Gottes gründlich zerstört oder für seinen Kult beschlagnahmt. Sie beflecken die Altäre mit ihren Abscheulichkeiten und stürzen sie um; sie beschneiden die Christen und gießen das Blut der Beschneidung auf die Altäre oder in die Taufbecken. Denen, die sie schändlich mißhandeln und töten wollen, schlitzen sie den Bauch auf, ziehen den Anfang der Gedärme heraus, binden ihn an einen Pfahl und treiben sie mit Geißelhieben solange rundherum, bis die Eingeweide ganz herausgezogen sind und sie am Boden zusammenbrechen. Sie binden manche an Pfähle und erschießen sie mit Pfeilen. Sie ziehen manchen den Hals lang, gehen mit bloßem Schwert auf sie los und versuchen, ob sie sie mit einem Streich köpfen können. Was soll ich von der ruchlosen Schändung der Frauen sagen? Davon reden ist schlechter als schweigen. Schon haben sie das Griechenreich verstümmelt und sich ein Gebiet einverleibt, das zu durchwandern zwei Monate Reise nicht hinreichen.
Wem anders obliegt nun die Aufgabe, diese Schmach zu rächen, dieses Land zu befreien, als euch? Euch verlieh Gott mehr als den übrigen Völkern ausgezeichneten Waffenruhm, hohen Mut, körperliche Gewandtheit und die Kraft, den Scheitel eurer Widersacher zu beugen. Bewegen und zu mannhaftem Entschluß aufstacheln mögen euch die Taten eurer Vorgänger, die Heldengröße König Karls des Großen, seines Sohnes Ludwig und eurer anderen Könige. Sie haben die Heidenreiche zerstört und dort das Gebiet der heiligen Kirche weit ausgedehnt. Besonders bewegen mögen euch das Heilige Grab unseres Herrn und Erlösers, das von unreinen Völkern besetzt ist, und die heiligen Stätten, die jetzt ohne Ehrfurcht behandelt und mit dem Unrat dieser Leute frech beschmutzt werden. Ihr überaus tapferen Ritter, ihr Sprößlinge unbesiegter Ahnen, entartet nicht, sondern denkt an die Tatkraft eurer Vorfahren! Wenn euch zärtliche Liebe zu Kindern, Verwandten und Gattinnen festhält, dann bedenkt, was der Herr im Evangelium sagt: Wer Vater oder Mutter mehr als mich liebt, ist meiner nicht wert ˆ [Matthäus 10, 37]; jeder, der sein Haus, Vater, Mutter, Gemahlin, Kinder oder Äcker um meines Namens willen verläßt, wird Hundertfältiges erhalten und ewiges Leben haben [Matthäus 19, 29].
Kein Besitz, keine Haussorge soll euch fesseln. Denn dieses Land, in dem ihr wohnt, ist allenthalben von Meeren und Gebirgszügen umschlossen und von euch beängstigend dicht bevölkert. Es fließt nicht vor Fülle und Wohlstand über und liefert seinen Bauern kaum die bloße Nahrung. Daher kommt es, daß ihr euch gegenseitig beißt und bekämpft, gegeneinander Krieg führt und euch meist gegenseitig verletzt und tötet. Aufhören soll unter euch der Hass, schweigen soll der Zank, ruhen soll der Krieg, einschlafen soll aller Meinungs- und Rechtsstreit! Tretet den Weg zum heiligen Grab an, nehmet das Land dort dem gottlosen Volk, macht es euch untertan! Gott gab dieses Land in den Besitz der Söhne Israels; die Bibel sagt, daß dort Milch und Honig fließen [2. Buch Moses 3, 8]. Jerusalem ist der Mittelpunkt der Erde, das fruchtbarste aller Länder, als wäre es ein zweites Paradies der Wonne. Der Erlöser der Menschheit hat es durch seine Ankunft verherrlicht, durch seinen Lebenswandel geschmückt, durch sein Leiden geweiht, durch sein Sterben erlöst, durch sein Grab ausgezeichnet. Diese Königsstadt also, in der Erdmitte gelegen, wird jetzt von ihren Feinden gefangengehalten und von denen, die Gott nicht kennen, dem Heidentum versklavt. Sie erbittet und ersehnt Befreiung, sie erfleht unablässig eure Hilfe. Vornehmlich von euch fordert sie Unterstützung, denn euch verlieh Gott, wie wir schon sagten, vor allen Völkern ausgezeichneten Waffenruhm. Schlagt also diesen Weg ein zur Vergebung eurer Sünden; nie verwelkender Ruhm ist euch im Himmelreich gewiß.“
Als Papst Urban dies und derartiges mehr in geistreicher Rede vorgetragen hatte, führte er die Leidenschaft aller Anwesenden so sehr zu einem Willen zusammen, daß sie riefen: „Gott will es, Gott will es!“ Wie der ehrwürdige Papst von Rom dies hörte, hob er die Augen zum Himmel, dankte Gott, gebot mit der Hand Schweigen und sprach: „Meine geliebten Brüder, heute hat sich an uns erwiesen, was der Herr im Evangelium sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen [Matthäus 18, 20]. Wenn nicht der Herrgott in euren Herzen gewesen wäre, wäre euch aller Ruf nicht eins gewesen. Denn auch wenn euer Ruf vielstimmig ertönte, sein Ursprung war eins. Deshalb sage ich euch, daß Gott, der ihn euch in die Brust senkte, ihn aus euch herauszog. Dieser Ruf soll euch nun im Kampf das Losungswort sein, denn dieses Wort hat Gott gesprochen. Wenn ihr den Feind angreift und bekämpft, werden alle vom Heere Gottes dies eine rufen: ‚Gott will es, Gott will es!‘ “