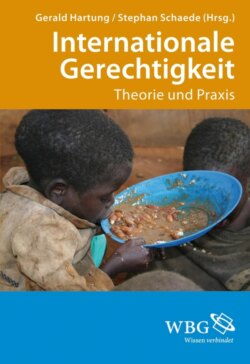Читать книгу Internationale Gerechtigkeit - Группа авторов - Страница 7
Internationale Gerechtigkeit
ОглавлениеWorum es gehen soll
GERALD HARTUNG UND STEPHAN SCHAEDE
Es gibt die United Nations, die World Health Organisation, den Internationalen Gerichtshof, den Internationalen Strafgerichtshof, die UNESCO, den Ökumenischen Rat der Kirchen, Greenpeace, Amnesty International, SOS-Kinderdorf, Brot für die Welt, die Kommission Justitita et Pax, den Evangelischen Entwicklungsdienst … – die Liste dieser weltweit agierenden Organisationen ließe sich erheblich verlängern. Sie zeigt etwas an: Die Einsicht in die Unteilbarkeit einer gemeinsamen Welt ist geradezu institutionell verkörpert. Aus dieser globalen Unteilbarkeit ergibt sich ein Gestaltungsauftrag, nämlich der, für Internationale Gerechtigkeit im höchstmöglichen Maße Sorge zu tragen. Dieser Auftrag steht und fällt mit der Überzeugung, dass die Menschheit unter den Endlichkeitsbedingungen dieser Welt zumindest jeweils gerechtere Verhältnisse entwickeln kann. In dieser Überzeugung sind die folgenden Ausführungen geschrieben. Und sie gehen darüber hinaus davon aus, dass das Konzept Internationale Gerechtigkeit im Prozess globalisierter Handlungszusammenhänge ökonomischer, politischer und juristischer Natur nur in interdisziplinärer Arbeit präzisiert werden kann. Entsprechend stehen am Anfang grundsätzliche philosophische, theologische und juristische Erörterungen, denen mit gleichem Gewicht Einzelstudien zu klassischen internationalen Handlungsfeldern aus rechtlicher, ökonomischer, ökologischer und politologischer Perspektive folgen. Sie informieren über Konstellationen in den einzelnen internationalen Handlungsfeldern. Und sie unterbreiten mit der nötigen Vorsicht Vorschläge, wie Lebensverhältnisse und Strukturen in Zukunft für mehr Gerechtigkeit sorgen könnten. Dabei versuchen alle Beiträge methodisch zu beherzigen, dass sich auf dem Gebiet Internationaler Gerechtigkeit Begriffsbildung und Analyse von Handlungsfeldern wechselseitig kontinuierlich zu korrigieren und zu präzisieren haben. Das Vorgehen ist also nichts anderes als ein Plädoyer für eine begrifflich reflektierte Beurteilung von internationalen Gestaltungsoptionen.1 Um nicht mehr, aber auch nicht um weniger muss es gehen.
Im Verlauf der Erarbeitung der vorliegenden Texte zeigte sich etwas, das für unsere Standortbestimmung entscheidend ist: Das Konzept Internationale Gerechtigkeit vermag am Beginn des 21. Jahrhundert im Denken und Handeln zu orientieren. Es ist viel mehr als eine rhetorische Verzierung multilateraler Verlautbarungen im hohen Ton. Als politisch naive Chimäre lässt es sich nicht mehr abtun.
Das hat vor allem historische Gründe. Mit dem Ende des Kalten Krieges eröffneten sich internationale Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten neuer Qualität. Auf internationalen Konferenzen wurde der Weltarmut und den mit ihr zusammenhängenden Ungerechtigkeiten im Blick auf Ernährung, Bildung und Klima der Kampf angesagt. Völkerrechtliche Vereinbarungen haben einen spürbar höheren Verbindlichkeitsgrad erreicht. Die Gerechtigkeitspostulate, wie sie Aufklärung2 und soziale Revolutionen pointierter denn je formuliert hatten, wurden in überraschender Beschleunigung Gegenstand internationaler politischer Praxis. Diese Entwicklungen hatten ihre Voraussetzung zumindest auch in einer bemerkenswerten Vorgeschichte. Seit Ende des 2. Weltkrieges kam es mit der UN zu Neugründungen internationaler Institutionen. Dass diese Institutionen allein durch ihre bloße Existenz niemals schon Gerechtigkeitsgaranten sind, ist unbestritten. Sie selbst müssen konstruktiv kritisiert werden und sind immer wieder reformbedürftig. Es gibt aber zu diesem internationalen institutionellen Reform- und Gestaltungswillen keine überzeugende Alternative. Denn die weltweiten Abhängigkeiten sind unumkehrbar. Der Weg zurück von der Globalisierung in strikt lokale Lebensgestaltung menschlicher Kleinverbände ist ausgeschlossen. Damit wird nicht bestritten, dass eine stärkere Konzentration auf die Konsolidierung lokaler ökonomischer und klimapolitischer Konzepte global von erheblichem Nutzen sein dürfte. Dass die Globalisierung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, ist nicht unbedingt zu bedauern, wenn sie denn entsprechend humane Formen annimmt. Aus evangelisch-theologischer Perspektive kann zugespitzt auf die Bestimmung der Gerechtigkeit formuliert werden: „Wer über Gerechtigkeit nachdenkt, hat sie als internationale Gerechtigkeit zu reflektieren, oder er hat noch nicht vollständig über sie nachgedacht.“ Diese Behauptung erhebt Geltungsanspruch auch jenseits von Glaubenseinsichten.3 Jedenfalls sei hier schon gesagt: Einer solchen Behauptung kann etwa mit Berufung auf die Menschenrechte ganz jenseits theologischer Erwägungen zugestimmt werden.
Allerdings muss eingeräumt werden: Die mit dem Konzept der Internationalen Gerechtigkeit geweckten Erwartungen sind voluminös. Sie haben sich mindestens drei grundsätzlichen Herausforderungen zu stellen. Die erste Herausforderung besteht darin, die Orientierungsleistung des Konzeptes Internationaler Gerechtigkeit auszuweisen. Armut und Hunger, die im Herbst 2008 ausgebrochene Finanzkrise zudem bilden einen harten Belastungstest für die behauptete Orientierungsleistung des Konzeptes. Es zählt zu den Aufgaben von Philosophie und Theologie, in Zeiten solcher ökonomischer Krisen darauf aufmerksam machen, dass Verzicht heilsam sein kann. Es wäre eine schlechte „Utopie, den westlichen Lebensstandard ins Globale verlängern zu wollen“.4 Es muss dabei jedoch um klugen Verzicht gehen. Kluger Verzicht ist etwas anderes als Verlust. Das ist ein entscheidender Unterschied. Es geht präziser formuliert um einen gerechten Verzicht, der das Leben vieler rettet, nicht jedoch um das Leben gefährdende Verluste. Mit Verlusten ist niemandem gedient.
Deshalb ist bei aller berechtigten Warnung vor internationaler Kapitalgier mit gleichem Gewicht daran zu erinnern, dass bereits Calvin in Zeiten ökonomischer Not vorgeschlagen hat, zwischen klugem Zins für produktiv angelegtes Kapital und einem, fremde Not ausbeutenden, parasitären Wucher zu unterscheiden.5 Geldwirtschaft muss sein. Sie hat aber allen im Wirtschaftskreislauf Beteiligten zu nutzen und alle vor Übervorteilung zu schützen. Das ist die Pointe. Ohne wirtschaftliche Ressourcen lässt sich ungerechtes Elend nicht in menschenwürdige Lebensbedingungen umgestalten. International gerechte Verhältnisse kosten Geld, und das Konzept Internationaler Gerechtigkeit vermag da über ethische und rechtliche Bedingungen einer intelligenten Geldwirtschaft zu orientieren.
Die zweite Herausforderung, der sich das Konzept Internationale Gerechtigkeit stellen muss, liegt in der begrifflichen Herkunft des Ausdrucks Gerechtigkeit selbst begründet.
Die klassischen aristotelischen Gerechtigkeitsmodelle einer ausgleichenden und austeilenden Gerechtigkeit waren nicht für globale Kontexte ausgelegt. Sie gingen von überschaubaren Verhältnissen aus. Und sie rechneten mit einem eindeutig identifizierbaren Subjekt der Gerechtigkeitsausübung. Innerhalb der Polis ließen sich einigermaßen klar Verantwortungsträger identifizieren. Sie sorgten mehr oder weniger überzeugend für Gerechtigkeit in ihrem Gemeinwesen. Oder sie versagten im Blick auf diese Aufgabe, konnten dafür aber eindeutig verantwortlich gemacht werden. Das christliche Gerechtigkeitskonzept ist demgegenüber zwar von seinem Ursprung her universal angelegt, hat jedoch seine universale Option nur unter Voraussetzung eines universal handelnden Gottes plausibel gemacht (vgl. Mt 6,33). Rein theologisch jedoch kann ein auf universale Geltung Anspruch erhebendes Gerechtigkeitskonzept spätestens seit der Moderne nicht ohne weiteres argumentieren. Die theologischen Grundüberzeugungen und Argumentationen müssen in die gesellschaftlichen Diskussionen in kluger Weise so eingeführt werden, dass deren Rationalität und positive Gestaltungswirkung für das Zusammenleben von Menschen überzeugen.
Das bedeutet also, dass es mit einer Applikation klassischer Gerechtigkeitsvorstellungen auf neue globale Herausforderungen nicht getan ist. Klassische Modelle der Gerechtigkeit müssen in einem ersten Schritt auf ihre prinzipielle Aufklärungskraft im Blick auf internationale Belange befragt und in einem zweiten Schritt für diese Belange entsprechend modifiziert werden.
Die dritte Herausforderung liegt in dem Adjektiv „international“. Hier muss gefragt werden: Sind weltweite Gerechtigkeitskonzepte überhaupt an Beziehungen zwischen Nationen gebunden? Ökonomische Institutionen in Gestalt von Banken, Versicherungen und transnationalen Unternehmen scheinen im Wesentlichen das Geschehen zu bestimmen. Deren Interessenten trugen es so vor. Politiker nahmen es so hin. Die Nationalstaaten als geborene Völkerrechtssubjekte und entscheidende internationale Handlungsinstanzen schienen global ins zweite Glied gedrängt. Eigentümlicherweise korrigierte ausgerechnet die Finanzkrise vom Herbst 2008 dieses falsche Bild. Es waren demokratisch legitimierte nationale Gemeinwesen, die Bürgschaften in dreistelliger Milliardenhöhe gaben – in Konsultation mit anderen Staaten und internationalen Organisationen. Sie wurden so zu Gestaltungssouveränen dieser Situation. Dieser Vorgang bestätigt die Beobachtung der Einzelstudien und damit den guten Sinn, über Gerechtigkeit weltweit als Internationale Gerechtigkeit nachzudenken. Darin liegt zugleich aber auch die Notwendigkeit, dass staatliche Institutionen angesichts fundamental neuer Problemlagen ihre Aufgaben neu definieren und sich auf Lösungsversuche innovativer Art einlassen. Eine internationale Politik aus nationaler Perspektive, die allein auf „Wirtschaft, Wachstum, Arbeitsplätze“ setzt, dafür aber „ihre Spitzenposition im Klimaschutz bedenkenlos“ abgibt, hat das noch nicht realisiert.6 Die Deutung der Reaktion nationaler Institutionen auf die Finanzkrise kann also zu einem ambivalenten Ergebnis kommen. Einerseits wird die Bedeutung staatlicher Institutionen für die Ermöglichung international gerechter Verhältnisse deutlich. Andererseits zeigt sich, dass sich diese Institutionen mit realpolitisch dringend geforderten Innovationen schwer tun. Ob deshalb gleich einer neuartigen außerparlamentarischen Opposition der Eliten das Wort geredet werden muss, die für die nötigen Veränderungen sorgt7 , darf in Zweifel gezogen werden. Denn für global agierende zivilgesellschaftliche Akteure, und seien es Eliten, stellt sich nicht weniger als für manche internationale Institution die Frage nach deren demokratischer Legitimität. Eher sollte von einer Beratungspflicht gegenüber politischen und ökonomischen nationalen und internationalen Institutionen die Rede sein, die so intensiv wahrgenommen wird, dass Beratungsresistenzen spürbar abnehmen. Es geht um eine möglichst intelligente Gestaltung der Verhandlungen.
Was ist nun aber präzise der Beratungsgegenstand und also zu gestalten, wenn von Gerechtigkeit die Rede ist?
Die Antwort auf diese Frage darf nicht leichtfertig gegeben werden, denn das Konzept der Internationalen Gerechtigkeit ist von erheblicher Komplexität. Es integriert mehrere voneinander zu unterscheidenden Momente globaler Lebenszusammenhänge und umfasst dabei notwendig zugleich aufeinander nicht zu reduzierende Modelle der Gerechtigkeit.
Was ist damit gemeint? Einige zentrale Momente seien hier genannt, nämlich erstens das gerechte Verhalten von Individuen oder Gruppen, zweitens die gerechte Behandlung von Individuen und Gruppen, drittens das gerechte Agieren von Institutionen, viertens gerechte Verhältnisse, fünftens die, unsere bisher genannten Momente regulierenden, gerechten Prinzipien und sechstens gerechte Verfahren. Die Vielzahl der genannten Momente macht deutlich, weshalb eine schlichte Definitionsformel für Internationale Gerechtigkeit in der Sache kaum weiterführen dürfte. Ein Konzept Internationaler Gerechtigkeit muss alle diese Momente im Blick haben. Wieso auf keines der Momente verzichtet werden darf, lässt sich schnell vor Augen führen.
Internationale Gerechtigkeit setzt voraus, dass sich Individuen gerecht verhalten. Das ist insbesondere im Blick auf Ämter von hohem Einfluss nahezu trivial. Bestechlichkeit und Korrumpierbarkeit etwa unterlaufen Bemühungen um Internationale Gerechtigkeit. Menschenrechte wiederum artikulieren den Anspruch von Individuen weltweit auf gerechte Behandlung. Individuen haben einen Anspruch darauf, sich in dem, was sie vermögen und sie ausmacht, gerecht werden zu können. Diese Ansprüche haben, wie der uralte Gerechtigkeitsgrundsatz der goldenen Regel anzeigt, ihre Grenze an den Ansprüchen der jeweils anderen.8 Analoges ist von Gruppen zu behaupten. Zum Beispiel können ethnische oder religiöse Gruppen sich gegenüber anderen Ethnien und Religionsgemeinschaften gerecht verhalten bzw. von ihnen gerecht behandelt werden oder aber unterdrückt werden. Gerechtigkeit ist hier wie schon auf der individuellen Ebene mit der Wahrung von Interessen in einem elementaren Sinne befasst. Gerechte Lebensverhältnisse wahren in aller Regel die gewachsene Identität von Gruppen mit deren entsprechenden Prägungen. Bedingung ist allerdings, dass das damit einhergehende Identitätsbewusstsein nicht die Identität anderer Gruppen lädiert oder gefährdet.9 Gerechte Institutionen müssen zum einen jenseits rechtlicher und ethischer Gerechtigkeitsvorstellung ihren Funktionen gerecht werden. Eine Bank, die keine Gewinne durch Geldgeschäfte erwirtschaftet, wird nicht lange überleben. Zum anderen stehen sie wie andere Wirtschaftsinstitutionen aber auch im Kontext einer sozialen und ökonomischen Gerechtigkeit in der Pflicht, wenn es um die Verteilung materieller Güter, Arbeitsstellen und Ressourcen geht. Handelt es sich um international engagierte Unternehmen, liegen Gerechtigkeitsforderungen internationaler Dimension auf der Hand.
An dieser Stelle ist mit allem Nachdruck zu sagen, dass die Alternative zwischen institutioneller und individueller Verantwortung im Blick auf Internationale Gerechtigkeit eine schräge Alternative ist. Verantwortlichkeiten können international weder Individuen auf Institutionen noch Institutionen auf Individuen abwälzen. Die Verantwortungsverhältnisse sind vielmehr genau zu analysieren. Dass gerade das zu den besonders anspruchsvollen Aufgaben der Sachanalysen in den verschiedenen Handlungsfeldern gehört, liegt daran, dass auf internationalem Parkett eindeutige Subjekte gerechten Handelns bisweilen nicht einfach benannt werden können.10
Im Blick auf die soziale und ökonomische Gerechtigkeit kommen sofort auch hoheitliche Staatsaufgaben ins Spiel. Ein Staat hat Rechte, Freiheiten, Ämter und Chancen seiner Staatsbürger angemessen zu regulieren und muss für die gerechte Ordnung on Infrastrukturen wie Bildung, Verkehr, die medizinische Versorgung und für Gerechtigkeit gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten und Rechtsordnungen sorgen. Er pflegt Außenbeziehungen zu anderen Staaten und übernimmt so international für ganz ähnliche Sachkontexte Verantwortung. Hier hat darüber hinaus an die Stelle des alten Diskurses über den gerechten Krieg der Diskurs über die internationale Verantwortung für einen gerechten Frieden zu treten.11 Und hier ist einer der klassischen Orte, wo religiöse Institutionen und Akteure für Internationale Gerechtigkeit einzutreten haben und eintreten können. Die Bedeutung von Kirchen ist in diesem Kontext zu entfalten. Mit welchen gut begründeten Überzeugungen können sie fruchtbare Zumutungen für ökonomische, rechtliche und politische Gestaltungsaufgaben anderer Institutionen formulieren? Wie handeln sie selber international sinnvoll, zum Beispiel mit ihren eigenen diakonischen Institutionen? Gerechtere Verhältnisse, so zeichnet sich ab, lassen sich eher durchsetzen, wenn zivilgesellschaftliche Kräfte und mit ihnen die Kirchen mit wirtschaftlichen und politischen Kräften – durchaus sachkritisch – kooperieren. Das ist etwas mehr und in der Sache anspruchsvoller als die Ambition, allein in Form eines institutionalisierten schlechten Gewissens der Welt gegen „die“ Wirtschaft und „die“ Politik globalen Lärm zu erzeugen.
Die hier ausdrücklich erwähnten ganz unterschiedlichen Sachkontexte Internationaler Gerechtigkeit lassen einmal mehr erahnen, dass es keinen Sinn hat, alle Handlungsfelder Internationaler Gerechtigkeit mit Gewalt über den Leisten eines einzigen Gerechtigkeitsbegriffs mit nur wenigen Definitionsmerkmalen zu schlagen. Das Konzept Internationaler Gerechtigkeit umfasst vielmehr, wie oben notiert, ein ganzes Set von Gerechtigkeitsmodellen. Um nur an einigen Beispielen zu illustrieren, dass von mehreren Modellen auszugehen ist: Soll es international in der Perspektive von Gerechtigkeit um die Einhaltung von Menschenrechten gehen, so ist das Moment der Gleichheit aller Menschen im Sinne der Menschenwürde zentral. Für Bildungsfragen bietet sich hingegen eher das Konzept der Chancengerechtigkeit an. Soll von der weltweiten Zugänglichkeit von Ressourcen die Rede sein, kommt zwingend das Moment der Verteilungsgerechtigkeit ins Spiel. Eine ausgleichende Gerechtigkeit wird etwa maßgeblich, wenn verletzte Interessen kompensiert werden müssen. Im Blick auf internationale Handelsbeziehungen trägt ein an materialen Prinzipien orientierter Gerechtigkeitsbegriff allein schon in pragmatischer Hinsicht nicht weit genug. Hier gewinnt das Konzept der Verfahrensgerechtigkeit Bedeutung, übrigens so, dass die Orientierung an gerechten Verfahren niemals die Orientierung an gerechten Strukturen ersetzen kann (und umgekehrt). Wenn gefragt wird, wie die so genannten zivilgesellschaftlichen Akteure auf internationalem Parkett agieren sollten, ist, wie bei ökonomischen Kräften auch, nach den demokratischen Legitimationsstrukturen dieser Institutionen zu fragen. Es geht also um den Nachweis, in wessen, ihre Handlungsbefugnisse rechtfertigenden, Namen sie eigentlich für welche gerechte Sache handeln.
Diese Modelle lassen sich allerdings in Form von Leitlinien bündeln. Die Leitlinien präzisieren Gerechtigkeit ebenso als Entwicklungsbestimmung wie sie vor einer ideologischen Realisierungswut gerechter, durchaus guter Utopien warnen. Letzteres wäre unrealistisch. Denn lebensweltlich betrachtet nehmen Gerechtigkeitsdiskurse und so auch der über Internationale Gerechtigkeit ihren Ausgang regelmäßig von der Wahrnehmung und dem Empfinden grober Ungerechtigkeiten. In diesem Zusammenhang wird deutlich: für die Durchsetzung international gerechterer Lebensbedingungen ist ein entsprechendes (Un)Gerechtigkeitsempfinden von zentraler Bedeutung. Entsprechende Informationen gepaart mit rationaler Analyse, was geändert werden muss und kann, dürften sensibilisieren. Dabei gehen rationale Analyse und Sensibilität für Gerechtigkeit Hand in Hand. Vor diesem Hintergrund ist eine Praxis zu fordern, die mit ökonomischem Sachverstand, juristischem Mut zu neuen völkerrechtlichen und transnationalen verwaltungsrechtlichen Modellen und mit politischer Phantasie der Komplexität globaler Handlungszusammenhänge Rechnung trägt. Dieser Überzeugung geben die Fallstudien Ausdruck, die sicher nicht auf Vollständigkeit angelegt sein können, jedoch anhand von Einzelanalysen exemplarisch Entscheidendes herausarbeiten: von der Darstellung des Zieles der Friedenswahrung in der Entwicklung des modernen Völkerrechts, Fragen der internationalen Verschuldung, des Welthandels, der Entwicklungspolitik und Ressourcenverteilung sowie der Folgen patent- und steuerrechtlicher Bestimmungen über die Stellung transnationaler Unternehmen zwischen Völkerrecht und soft law, die völkerrechtliche Artikulation ethnischer Gruppeninteressen in Minderheitensituationen und die internationale Gerechtigkeitsherausforderung des Klimawandels hin zur Bedeutung religionsbasierter Akteure für die Internationale Gerechtigkeit. Am Anfang aber stehen als Grundorientierung philosophisch- theologische Leitlinien. Die Brücke zwischen theoretischer Reflexion und Praxis schlägt ein juristischer Beitrag, der fragt, was das Recht zur praktischen Förderung Internationaler Gerechtigkeit leisten kann.
Wenn die Leitlinien dezidiert nicht nur philosophisch, sondern auch theologisch argumentieren, dann hat das folgende Gründe: Erstens haben diejenigen, die christliche Glaubensüberzeugungen teilen oder ihnen nahe stehen, einen Anspruch auf eine explizite theologische Information zur Frage. Zweitens ist es Aufgabe evangelischer Theologie und Ethik, dem evangelischen Ethos in der gesellschaftlichen Diskussion zentraler Sachprobleme öffentlich Ausdruck zu geben. Dieses Ethos will in der Welt wirken.12 Und drittens mögen zwar die im christlichen Glauben artikulierten Behauptungen und Verheißungen einem säkularisierten Menschen des 21. Jahrhunderts nicht einleuchten, wenn er sie auch mit Interesse zur Kenntnis nehmen mag. Jedoch können die in diesen Glaubensüberzeugungen artikulierten ethischen Forderungen vor dem Forum einer nichtchristlichen Rationalität plausibel gemacht werden. Hier hat sich zu bewähren, dass sich die Sätze evangelischer Ethik in Sätze allgemeiner Ethik überführen lassen. Dabei werden sie dann nicht mehr unter den Bedingungen des Evangeliums, sondern allein des Gesetzes formuliert. In dieser Weise ausgewiesen dürften Reflexionen über Internationale Gerechtigkeit den internationalen Diskurs über die Gerechtigkeitsfrage zwischen unterschiedlichen kulturellen Prägungen effizient anregen. An diesem Anspruch will sich die Lektüre dieses Bandes messen lassen.
Bibliographie
J. CALVIN, Ioannis Calvini Opera exegetica et homiletica, Sermons sur le Deuteronome, XXIII. V. Corpus Reformatorum LVI, Brunsvigae 1885.
EVANGELISCHE KIRCHE IN DEUTSCHLAND, Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen, Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2007.
J. FISCHER, Theologische Ethik. Grundwissen und Orientierung, Stuttgart 2002.
T. KELLY, M.-B. DEMBOUR, Paths to International Justice, Cambridge 2007.
I. KANT, Metaphysik der Sitten, hg. von G. Wobbermin, P. Natorp, Berlin 1907.
DERS., Kritik der reinen Vernunft, hg. Von B. Erdmann, P. Menzer, A. Höfler, Berlin 1903.
U. KÖRTNER, M. Popp, Schöpfung und Evolution – Zwischen Sein und Design. Neuer Streit um die Evolutionstheorie, Wien 2007.
G. W. LEIBNIZ, Opera omnia nunc primum collecta, hg. von L. Dutens, Genf 1768.
W. LIENEMANN, Grundinformation Theologische Ethik, Göttingen 2008.
R. MEERAN, Liability of Multinational Corporations. A Critical Stage in the UK, in: M. KAMMINGA / S. ZIA-ZARIFI (Hgg.), Liability of Multinational Corporations under International Law, Boston 2000, S. 251 – 264.
H. WELZER, Apo statt Kalypse. Handeln in der Krise, faz.net vom 4. Januar 2009, (http://www.faz.net).