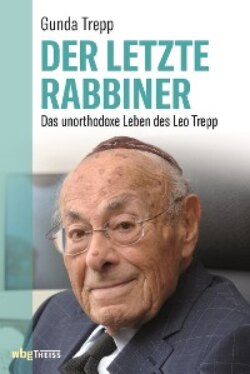Читать книгу Der letzte Rabbiner - Gunda Trepp - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеDie Geschichte unseres Lebens beginnt lange vor unserer Geburt. Unsere Wurzeln reichen tief in unsere Vergangenheit. Von unseren Ahnen erhalten wir unsere geistigen und körperlichen Wesensformen, unsere Intelligenz und Körperkraft. Eltern und Verwandte geben uns unser Wesen durch Vorbild und Erziehung. Die Ströme der Vergangenheit verbinden sich in uns, aus ihnen schöpfend sind wir frei in der Wahl unseres Denkens und unserer Lebensgestaltung. Bestimmung und Freiheit gestalten unser Leben in einer Umwelt, die – sich ständig ändernd – uns zu immer neuen Antworten herausfordert. Auf drei Schauplätzen gestaltete sich die Vorgeschichte meines Lebens und die prägende Geschichte meiner Kindheits- und Jugendjahre. Fulda, Oberlauringen und Mainz.
Das sind die Worte, mit denen Rabbiner Leo Trepp z’l seine Lebenserinnerungen begonnen hat. Allerdings wendete er sich dann zügig dem Erzählen zu und bemerkte: „Gute Einleitungen schreibt man am Schluss.“ Doch er selbst hat seine Autobiographie nicht mehr beendet. Am zweiten September 2010, dem 24. Tag im Monat Elul 5770 im jüdischen Kalender, ist mein Mann für immer eingeschlafen. Er hinterließ die fertig geschriebenen Seiten seiner Autobiographie, besprochene Tonträger und Hunderte von Aufzeichnungen, die er für Vorlesungen, Vorträge oder Bücher angefertigt hatte. Hinzu kommen mindestens ebenso viele Gespräche, viele von ihnen aufgenommen, in denen er aus seinem Leben erzählt, seine Philosophie erklärt und dem Hörer vor allem das Judentum in allen seinen Facetten und aller seiner Schönheit nahebringt. Wenn wir uns in den letzten Jahren unterhielten, habe ich Aussagen, die mir interessant erschienen, unmittelbar danach aufgeschrieben, und zwischendurch hat er mir immer wieder Epsioden erzählt, entweder auf Band oder mit der Bitte, sie für ihn aufzuschreiben.
Material gab es also ausreichend. Wie hätte es auch anders sein können in einem 97-jährigen Leben, das geprägt war vom Ersten Weltkrieg, den Hoffnungen der Weimarer Republik, von der Wirtschaftskrise und schließlich der Entrechtung, Vertreibung und Ermordung der europäischen Juden? Er berichtet von seiner Zeit als junger Landesrabbiner in Oldenburg, einem Landkreis, in dem die Bürger schon vor der Machtergreifung der Nazis eine nationalsozialistische Regierung wählten, und von seinen Versuchen, eine Gemeinschaft zu erhalten, die spätestens in der Nacht des 9. November 1938 die letzte Hoffnung verlor. Und er spricht von seiner Zeit im Konzentrationslager, von der er später sagen wird, „danach war alles Streben, alle Hoffnung dahin.“ Und doch wollte er nicht die Erinnerungen eines Überlebenden schreiben, oder besser: Er wollte nicht nur die Erinnerungen eines Überlebenden schreiben. Er erinnert sich an seine Familie, Freunde, Nachbarn, die, einer anderen Religion als die Mehrheit angehörend, vor allem Deutsche waren. Er erzählt von unterfränkischen Viehhändlern, die am Schabbat von der Synagoge aus ins Wirtshaus gingen, ihr Bier tranken, sich auf dem Marktplatz rangelten, um sich dann die Kleider abzustauben und zum Nachmittagsgebet zurück in die Synagoge zu gehen. Von tief frommen Männern in Mainz, die nach dem Gottesdienst in die Oper eilten oder ins Konzert. Er erzählt vom Gemeindemitglied Isidor Reiling, der in Mainz begraben ist, und dessen Tochter, Anna Seghers, eine bedeutende Rolle in der Exilliteratur spielen sollte, von dem Onkel von Henry Kissinger, mit dem er begann, die Tora zu lernen, als er sechs war. Und immer wieder erzählt er von seinem Vater, der die Wurzeln für viele seiner Überzeugungen legte und wohl den bedeutendsten Einfluss darauf hatte, dass mein Mann zu dem tief religiösen, liberalen und menschenliebenden Denker und Lehrer wurde, der er war.
Als Philosoph, als Lehrer und als Autor hat sich Leo Trepp mit unterschiedlichsten Fragen auseinandergesetzt, die für das deutsche Judentum und die jüdische Religion von Bedeutung waren. Auf Papier und in Gesprächen reflektiert er, wie sich seine orthodoxe Haltung über die Jahre veränderte und was Orthodoxie im Vorkriegsdeutschland bedeutete. Er spricht von Rabbinern und Freunden, die ihn inspiriert haben und die er inspiriert hat, obgleich und weil sie aus verschiedenen Richtungen kamen. Von dem orthodoxen und dem liberalen Rabbiner in Mainz, die sich respektierten und sich in ihrer Arbeit gegenseitig befruchteten. Von Abraham Heschel, der später viele Gedanken eines offenen, pluralistischen Judentums in die Vereinigten Staaten trug und dort ein enger Freund Martin Luther Kings wurde. Oder von Mordecai Kaplan, dem Begründer des Rekonstruktionismus, einer Strömung, die wie Leo Trepp das Judentum in einer ständigen Weiterentwicklung sieht. Er beschreibt eine Welt, deren intellektuelle Fülle und Freiheit heute kaum noch vorstellbar sind.
Oft jedoch sind seine Aufzeichnungen geprägt von einer Grundtrauer, von einer Stimmung der Vergeblichkeit, in der Erinnerung an schöne Momente schon um das Ende wissend. Um den Tod der Menschen wissend, die er geliebt hat, und um den Untergang des reichen deutschen Judentums. Der Gedanke an die Auslöschung seiner Familie und so vieler anderer Juden hat ihn nie verlassen. Die hebräische Inschrift für seinen Grabstein hat er selbst geschrieben. Sie beginnt mit dem Satz: „Hier ruht unser Lehrer und Rabbiner Jehuda, Sohn von Maier und Zipora Trepp, ein gerettetes Holzscheit vom Feuer.“
Er kam mit „Klimpergeld in der Tasche“, wie er es nannte, in den Vereinigten Staaten an, begann, in Harvard noch einmal zu studieren und als Rabbiner und bald als Professor und Autor zu arbeiten und ein neues Leben aufzubauen in dem Land, dem er bis zuletzt tief dankbar war. Sein Glaube an Gott blieb unerschüttert. Wie er selbst erzählen wird, waren sein Vertrauen in Gott und die Unverbrüchlichkeit dieses Vertrauens eine Notwendigkeit für ihn. Daraus hat er die Kraft für sein Leben geschöpft. Und nach der Flucht bald die Kraft, nach Deutschland zurückzukehren, in „seine gestohlene Heimat“, wie er es nannte. Nicht, um anzuklagen, sondern um die junge Generation zu lehren, was sie dem Geschehenen und der Zukunft schulde.
Die Schoah war für ihn die Kulmination eines stets vorhandenen Antisemitismus, der sich in Nuancen änderte, doch dessen Antrieb und Grundlage über die Jahrhunderte gleich blieben: ein irrationaler Judenhass, den zu beeinflussen die Juden selbst außerstande waren. Doch wenn er auch überzeugt war, dass die Schoah und deren Opfer nicht vergessen werden dürften, richtete sich diese Mahnung immer an die nichtjüdische Seite. Nie anklagend, sondern im Gegenteil darauf hinweisend, dass die nichtjüdischen Deutschen der neuen Generation den Worten der Tora nach keine Schuld trügen, doch sie verpflichtet seien, die Verantwortung für die Vergangenheit zu übernehmen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Dazu gehörte für ihn auch, etwas über das Judentum zu lernen. Deutsche sollen wissen, wer die Juden sind und was ihre Religion und Kultur repräsentieren. Darum vor allem lehrte er in Deutschland, hielt dort Vorträge und schrieb Bücher zum Judentum auf deutsch. Wenn überhaupt, so konnte aus seiner Sicht nur Wissen vor neuen Vorurteilen schützen.
Jüdische Hörer und Leser, so war er überzeugt, würden nie aufgefordert werden müssen, das Geschehene zu erinnern. „Kein Jude wird die Schoah je vergessen“, sagte er einmal in einem Vortrag. Im Gegenteil war er besorgt, dass manche das Judentum so stark mit der Ermordung der Juden verbanden, dass die Schoah zu einem tragenden Element für ihr Jüdischsein werden könnte. Für ihn dagegen war die einzig mögliche Reaktion der Juden auf die Verbrechen, die jüdische Gemeinschaft zu festigen und zu stärken. Die Verfolgung der Juden und die Erinnerung daran wurden so für ihn in erster Linie zur Mahnung, den lebenden Juden ihr Jüdischsein bewusster zu machen, sie zu unterrichten, sie zu lehren, durch das Judentum ein volleres und erfüllteres Leben zu gestalten, für sich und für andere.
Wenngleich diese Gedanken seine tiefen religiösen Überzeugungen ausdrücken, haben sie ihm auch geholfen, das Geschehene zu verarbeiten, oder genauer: auszuhalten, es nicht verarbeiten zu können. Einmal habe ich ihn gefragt, ob er je um seine Mutter geweint habe, die, zusammen mit ihrer Schwester, im Ghetto Lublin ermordet wurde. „Ich kann es nicht“, antwortete er, „wenn ich einmal beginnen würde, könnte ich nicht mehr aufhören.“ Doch in den letzten Jahren bedrängten ihn die Erinnerungen an diese Zeit immer stärker.
Was sollte ich tun mit diesem Material? Mit der Geschichte eines deutschen Juden? Eines Rabbiners, der unter den Nationalsozialisten amtiert? Eines Amerikaners, den der Verlust der Heimat bis zuletzt schmerzt? Eines Philosophen, der in seinen Schriften und Vorlesungen ausführt, dass Judentum jeden einzelnen Juden verpflichtet? Mir war schnell klar, dass ich nicht nur die Verantwortung, sondern die Verpflichtung trug, dieses Werk zu beenden. Kann ich wirklich sagen ‚beenden’? Natürlich nicht, denn ich weiß nicht, welche Papiere mein Mann gewählt hätte, wie er seine Erzählungen angeordnet hätte. Es konnte keine Autobiographie mehr werden. Doch es konnte immer noch eine Biographie werden.
Wie aber schreibt man über jemanden, der einem nahe ist – und ich sage ‚ist’, weil der Tod Liebe nicht auslöscht und die Nähe nicht – und der doch so viele Jahre seines Lebens ohne einen verbracht hat? Lebensjahre, die Reminiszenzen geworden waren, als wir uns trafen, Erinnerungen an Menschen, die für immer mit seinem Denken verbunden blieben, an Städte und Dörfer, die ihre alte Gestalt verloren hatten, an verbrannte Synagogen, an Schulen und Universitäten, aus deren Räumen das Bewusstsein für vergangenes Unrecht längst geschwunden war, wenn sich auch die Gesichter der Ermordeten oder Vertriebenen auf Fotos hier und da direkt an die Betrachter wandten.
Und wie schreibt man über einen Menschen, mit dem man so viel Zeit verbracht hat, alle Wochen, alle Tage und fast alle Stunden, dass nicht nur die neuen Erlebnisse und Erfahrungen zu gemeinsamen Erinnerungen werden, sondern dass auch die Erinnerungen des anderen sich irgendwann transformieren zu etwas neu Gestaltetem in uns selbst? Wann fangen wir an, die Erinnerungen unserer Partner zu unseren zu machen? Bilder, Musik und Gerüche zu assoziieren mit Menschen, die wir nur von Fotos und aus Erzählungen kennen, und mit Orten, deren Straßen wir noch nie betreten haben? Ich weiß es nicht. Doch ich weiß, dass ich am Grab seines Vaters nicht nur meinen Mann vor mir sehe, wie er still sitzt, im Gebetbuch liest, das Kaddisch und das El Male Rachamim sagt. Ich sehe auch seinen Vater vor mir, dessen leicht geschwollene Hände, seinen Schnäuzer, sein verschmitztes Lächeln. Ich höre seine Baritonstimme.
Wir sind geschaffen aus Erinnerungen, wir leben sie, wir definieren uns über sie. Sie schaffen Liebe oder Geringschätzung für uns selbst und für andere. Sie formen unsere Persönlichkeit. Sie bestimmen unseren Platz im Leben. Sie fließen ein in unser Hoffen auf Neues. Bis auch das Neue – eingeordnet und lebenserträglich interpretiert – sich in diesem Raum einfindet. Sind wir die Hüter nicht nur unserer eigenen Erinnerungen, sondern hüten wir auch die Erinnerungen der Menschen, die wir lieben und die uns verließen?
Ich glaube das. Und aus dieser Haltung heraus habe ich geschrieben. Mir war klar, dass ich nicht schreiben konnte, wie er geschrieben hat, sondern dass ich schreiben musste, wie ich es seit jeher tue. Es würde ein anderes Buch werden als dasjenige, das er geschrieben hätte, und ich musste das akzeptieren. Genauso, wie ich verstehen musste, dass ich mich selbst nicht auslassen konnte. Denn wie anders sollte ich über ihn schreiben als aus meiner Perspektive? Aus der Sicht einer deutschen Nichtjüdin, die zur Jüdin wurde, weil sie diesem Mann begegnete? Einem Rabbiner, der ihr liebevoll klarmachte, dass auch eine Deutsche Jüdin werden kann, wenn sie es denn wirklich will, wenn sie es der jüdischen Religion und Kultur wegen will und wegen nichts sonst?
Da unser Altersunterschied nicht zu übersehen war, würde dieser Elefant ohnehin im Raum stehen, also musste ich auch ihn thematisieren. Ich selbst hätte ja jede Freundin, die sich in einen doppelt so alten Mann verliebt, für verrückt erklärt. Obgleich Menschen, die uns kannten, das nie getan haben. Sie spürten wie wir selbst ein Band, das nicht zu erklären war. Andere, die uns nicht kannten, nie zusammen gesehen haben, mag die Differenz befremden. Unsere ungewöhnliche Liebesgeschichte spiegelt auch die offene und zugewandte Haltung meines Mannes wider. Wie sonst hätte er eine Beziehung mit einer Deutschen eingehen können, über deren Familie er nichts wusste? „Interessiert es dich denn nicht?“ fragte ich ihn. „Natürlich“, sagte er. „Aber du musst es mir schon von dir aus erzählen.“ Ich tat es irgendwann, und er sagte: „Selbst wenn sie sich alle schuldig gemacht hätten, wäre es nicht auf dich gefallen. Du stehst für dich selbst.“ So sah er nicht nur mich, sondern alle jüngeren Deutschen.
Wenn ich an meinen Mann denke, fallen mir zunächst zwei Worte ein: Liebe und Disziplin. Beide Haltungen sind elementar in der jüdischen Lehre und waren es für ihn. Liebe hat seinen Umgang mit Menschen geprägt. Mit Wissen. Und mit Texten. Mit allem, was Leben ist. Und vor allem mit Gott. Und Disziplin hat ihn in allen Beziehungen getragen und ihn schwierige Situationen bestehen lassen. Sie hat ihm innere Freiheit verliehen und eine gelassene Haltung. Ein Thema, das ihn selbst nie losgelassen hat, ist die Notwendigkeit für Juden, sich in zwei Kulturen zu Hause zu fühlen, um ein gutes, erfülltes Leben zu führen. In seinem Fall hieß das: Im Sinne der Orthodoxie von Samson Raphael Hirsch vollkommen Jude zu sein – und vollkommen Deutscher. Nach dem Krieg bestärkte er muslimische Gelehrte in Deutschland, dem Modell zu folgen und nach Wegen für einen Islam in Deutschland zu suchen, und damit die Striktheit ihrer Lehren in den jeweiligen Heimatländern kritischer zu sehen und zu verändern.
Bis zuletzt hat Leo Trepp seine Vorlesungen und Vorträge gehalten, hat Prüfungen abgenommen und Gespräche geführt. Ein großer Teil der Biographie widmet sich diesem Leben im Nachkriegsdeutschland, seinen Begegnungen mit Christen, Juden und Muslimen, mit geschichtsbewussten Aufklärern und mit Antisemiten. Die Deutschen, so machte er immer wieder klar, gedachten der Schoah nicht für die Juden. Sich zu erinnern war für sie selbst als Gemeinschaft unerlässlich, sofern sie in einer vitalen, einem ethischen Ziel zugewandten Gesellschaft leben wollten. Dass Nationalismus und Antisemitismus in seinen letzten Lebensjahren wieder zunahmen, ließ ihn, den immer Optimistischen, beinahe resignieren. Was bedeuteten Ehrungen und Auszeichnungen, wenn er befürchten musste, dass trotz seiner und der Bemühungen anderer Gutwilliger „vielleicht nichts erreicht“ worden sei, wie er einem Redakteur sagte?
Ich wollte vor allem sein Werden verstehen und sein Denken. Wie lernt jemand die Liebe zum Lernen? Wie entscheidet sich jemand bewusst für die Liebe und gegen den Hass? Wie kann jemand das, was Judentum lehrt, nämlich, dass alle gerechten Menschen ein Anrecht auf den Himmel haben, egal, welcher Religion sie angehören, wie kann jemand diese Akzeptanz so in sein Leben integrieren, dass andere sie in jeder Begegnung spüren? Und wie bleibt jemand stets offen für Veränderungen? Fokussiert habe ich mich dabei auf sein Leben in Deutschland. Vor der Schoah, und danach. Unser gemeinsames Leben in den Staaten war, wie das vieler Menschen, vor allem der Arbeit und der Familie gewidmet. Mein Mann hat zwei seiner heute fünf Urenkel noch kennengelernt. Diese Kontinuität zu sehen, hat er als tiefes Glück empfunden. Wie er auch gute Freundschaften als Segen empfand. Einige enge Freunde, sowohl in Amerika wie in Deutschland, nannte er unsere „gewählte Familie“.
Er hatte nur einen Teil seiner Autobiographie druckfertig beendet, das heißt, er hatte ihn geschrieben, ich hatte wie immer redigiert, und er meine Einwände und Korrekturen abgesegnet. Seinem geliebten unterfränkischen Dorf Oberlauringen, in dem er als Kind die Sommerferien verbrachte, hat er viele Seiten gewidmet, die ich nicht noch einmal wesentlich kürzen wollte. Ich hätte riskiert, dass seine Botschaft verloren geht. Es ist eine einfache und zugleich, wie alles, was mit der Auslöschung des jüdischen Lebens in Europa zu tun hat, komplexe Botschaft: Diese Landjuden waren da. Sie lebten überall in Deutschland.
Andere Perioden oder Themen hatte er angefangen und liegen gelassen, um Unterlagen einzusehen, die er gerade nicht zur Hand hatte. Einige Passagen, die Leo Trepp schon geschrieben oder in denen er sich in anderen Werken zu einem in dieser Biographie relevanten Thema geäußert hat, habe ich gekürzt, aber vollständig, andere teilweise übernommen, wenn es sinnvoll schien. Die Seiten seines Manuskripts, die unredigiert waren und die ich benutzen wollte, habe ich vorsichtig bearbeitet. Zudem habe ich Passagen aus Büchern zitiert, die er geschrieben hat. Die von ihm geschriebenen Ausschnitte, die ich nicht in wörtliche Rede setze, sind kursiv gedruckt. Die Erklärungen sämtlicher hebräischer Begriffe finden sich im Glossar. Leo Trepp hat in einigen anderen Werken Begebenheiten aus seinem Leben erzählt. Auch davon habe ich einige teilweise übernommen und danke insbesondere den Verlegern Florian Isensee in Oldenburg und Michael Bonewitz in Bodenheim für ihre freundliche Zustimmung. Zu besonderem Dank bin ich auch Frau Dr. Hedwig Brüchert, Frau Rabbiner Bea Wyler, Herrn Prof. Michael Daxner, Herrn Prof. Josef Reiter und Herrn Dr. Ekkehard Seeber verpflichtet, die sicherstellten, dass meine Berichte über Zeiten, in denen ich selbst Leo Trepp noch nicht kannte, korrekt waren. Ebenfalls danke ich Herrn Dr. h.c. Johannes Gerster, der ohne zu zögern bereit war, ein Vorwort beizusteuern, sowie Herrn Hergen Wöbken fürs Gegenlesen des Textes. Nicht zuletzt danke ich meinen beiden Lektorinnen, Frau Sophie Dahmen und Frau Susanne Fischer, die stets für mich da waren, wenn ich sie brauchte.
Ich habe dieses Buch geschrieben in tiefer Liebe und Achtung vor dem Menschen, der mein Fühlen und Denken beeinflusst hat wie kein zweiter, und den in seinen letzten zehn Jahren begleitet haben zu dürfen, etwas ist, das ich als Glück bezeichnen möchte. Es ist dem Andenken seiner Eltern, Maier Trepp z’l und Selma Zipora Trepp z’l, gewidmet.
Gunda Trepp