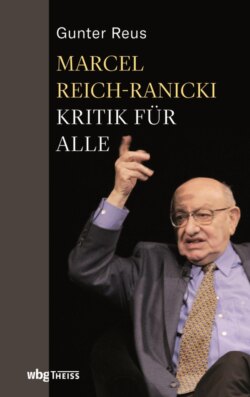Читать книгу Marcel Reich-Ranicki - Gunter Reus - Страница 8
Reich-Ranicki und die Folgen I
ОглавлениеDas Land, an dem er hing, stieß ihn fort und ließ ihn nicht los. Auch in der Fremde setzte es ihm noch übel zu. Er beherrschte die andere Sprache dort, doch Halt und Heimat gab ihm die eigene, mitgeschleppte, auch wenn sie die Sprache der Bedränger war. In ihr konnte er sich behaupten und schützen, konnte schwärmen und lieben, konnte zweifeln und verdammen, konnte wertschätzen und spotten, auch zynisch und ungerecht sein. In ihr nahm er Menschen für sich ein und brachte andere gegen sich auf, fand in gewöhnlichen Worten zu ungewöhnlichen Urteilen über seine Zeit. In ihr machte er sich Freunde mit sprachlicher Klarheit und Feinde mit journalistischer Direktheit. In ihr fand er zur Symbiose von hohem Ton und Alltagsverständlichkeit – ein écrivain journaliste, ein Feuilletonist: Heinrich Heine.
Feuilletonismus – das war und ist in Deutschland stets verdächtig. Der Begriff steht hierzulande immer wieder für fehlende Tiefe und für vorlaute, wenn auch hübsch formulierte Anmaßung. Es ist eine Ironie der Pressegeschichte, dass ausgerechnet ein Feuilletonist genau das Heine ankreidete. In seiner Polemik Heine und die Folgen warf der Wiener Journalist Karl Kraus dem Autor des Atta Troll und des Buchs der Lieder 1911 vor, das Geistige mit dem bloß Informierenden, die Kunst mit dem Journalismus vermengt zu haben. Heine habe Generationen von Zeitungsschreibern gelehrt, ihre „Lumperei mit Troddeln und Tressen“ zu schönen, und er sei es, „der der deutschen Sprache so sehr das Mieder gelockert hat, daß heute alle Kommis an ihren Brüsten fingern können“.1 Was für eine hübsch formulierte Anmaßung – als stehe es nur wenigen und ganz bestimmt nicht den kleinen Gehilfen der Zeitungsverlage zu, den Schönheiten der Sprache nachzuspüren.
Marcel Reich-Ranicki hat sich nicht allzu oft über Karl Kraus ausgelassen. Er erkannte zwar den Sprachkünstler an und nahm in seine voluminöse Kanonbibliothek der deutschen Literatur einige Gedichte und Essays von Kraus auf. Geltungssucht und Selbstgerechtigkeit des Wieners aber stießen ihn ebenso ab wie dessen Presseverachtung.
Ganz anders Reich-Ranickis Verhältnis zu Heine: Dem aus Deutschland Getriebenen fühlte er sich seelenverwandt in seiner feuilletonistischen Selbstbehauptung. Immer wieder benutzte er Heines Topos vom ‚portativen Vaterland‘, um seine lebenslange Verbundenheit mit der Literatur zu beschreiben. Er liebte den Polemiker, den Provokateur und Ruhestörer, der aber ganz anders als Kraus mit Humor und Charme operierte. Er liebte es, wie souverän Heine mit der Sprache und vor allem mit dem Alltagsidiom umging: „So hat er die Sprache der Lyrik und der Prosa erneuert, er hat sie ohne Pardon entrümpelt und anmutig verschlankt und damit die dringend notwendige Voraussetzung für die Demokratisierung der Literatur geschaffen.“2 Im Gegensatz zu Kraus sah Reich-Ranicki gerade in Heines sprachlicher Zugänglichkeit ein journalistisches Verdienst: Er war, schrieb er, „zumindest in Deutschland, der erste, der die Möglichkeiten der modernen Presse erkannte und von ihnen auch ständig Gebrauch zu machen wußte“.3