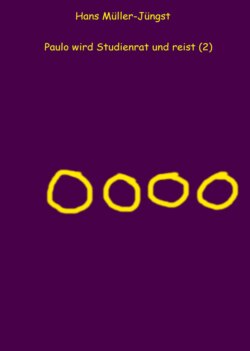Читать книгу Paulo wird Studienrat und reist (2) - HaMuJu - Страница 6
Goch Referendariat
ОглавлениеIrgendwann kamen Tinas Eltern mit Oma Lilli und Till zu Besuch. Sie schliefen alle im Hotel. Wir machten einen langen Spaziergang und gingen abends essen. Goch war eine angenehme kleine Stadt am Niederrhein. Die Hauptgeschäftsstraße war die Voßstraße. An deren Anfang lag die „Buchhandlung Fingerhut“, wo ich immer im modernen Antiquariat rumsuchte und mir billige Bücher zulegte. Frau Fingerhut war sehr belesen und versiert. Die einschlägigen Geschäfte lagen alle auf der Voßstraße, und an deren Ende lag „Haus Huck“, ein gemütliches Restaurant mit bürgerlicher Küche. Bog man dort ab in die Bahnhofstraße, kam man durch das „Steintor“, dem Wahrzeichen Gochs. Hinter unserer Pizzeria zweigte von der Bahnhofstraße die Feldstraße ab, wo es ein Kino gab. Ein Stückchen weiter Richtung Stadtmitte lag Gochs zweites Kino. Am Ende der Feldstraße wohnten drei Referendarskollegen, zweimal Michael und Andrea. Michael I und Andrea waren verheiratet. Sie waren am Gymnasium Goch und in Kevelaer untergebracht. So weit wie ich hatte es niemand.
Der Gocher Bahnhof existierte bei „Faller-Modellbau“ als Original Nachbildung.
Wir mussten einmal pro Woche nach Kleve zur Hauptseminarsitzung, sonst fuhr man da kaum mal hin. Das Seminar lag in Kleve-Kellen. An Kleve war vielleicht die „Schwanenburg“ ganz interessant, ansonsten war dort nicht viel los. Das galt aber auch für Goch. Man musste schon was losmachen! Wir lernten während der Referendarzeit jede Menge Leute kennen. Am Gymnasium in Rheinberg Gabi, Jürgen, Walter, Julia, Joach, Georg u.a. Mit denen traf man sich auch privat, zum Teil bis heute. Als Referendarskollegen kamen außer den Gocher Bekannten gar nicht so viele in Betracht. Die Gocher hatten in der Feldstraße über der landwirtschaftlichen Genossenschaft eine Zweihundert-Quadratmeter-Wohnung gemietet. Da gab es sogar einen Tischtennisraum. Wir hatten dort mal eine große Fete gefeiert. Die beiden Michaels und Andrea waren waschechte Kölner. Michael I war groß und wurde „der Lange“ genannt. Er war ein ganz lustiger Typ, Kölner eben. Seine Frau Andrea machte auf emanzipiert, klopfte Sprüche, war aber auch ganz umgänglich. Mit ihr hatte ich das Fachseminar Geschichte in Xanten. Michael II war ein sehr ruhiger kölnuntypischer Pfeifenraucher, der seine Unterrichtsvorbereitungen beim Hören von WDR 3 schrieb. Er wurde „Hüppeler“ genannt, ich weiß nicht waum. Andrea hatte einen alten „Käfer“. Wir wechselten uns beim Fahren zum Fachseminar ab, „Hüppeler“ und ich hatten das Fachseminar Sozialwissenschaften zusammen, auch in Xanten. Durch Goch floss die Niers, ein klarer, langsam dahinströmender Fluss, in dem ich nie einen Fisch sah. Es hieß, das Wasser wäre nicht von guter Qualität, weil es Einleitungen aus der Landwirtschaft gab. Das Ausflugslokal „Jan an der Fähr“ lag an der Niers. Dort gab es eine kleine Personenfähre mit Handbetrieb: man kurbelte sich an Drahtseilen entlang über den Fluss. „Jan an de Fähr“ wurde schon damals von Bussen angesteuert, in denen zum Beispiel Kegelklubs saßen, die sich einen feuchtfröhlichen Nachmittag machen wollten. Richtung Kleve führte die B 9. Man kam zuerst durch Bedburg-Hau mit seinem großen Landeskrankenhaus. Dann schloss sich das riesige Gebiet des Reichswaldes an. Der Reichswald war künstlich angelegt und von einem schachbrettartigen Wegenetz durchzogen, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde im Reichswald noch heftig gekämpft. Andere Gocher Bekannte waren Ulla, Karl-Heinz, Hilla und Fritz, Ria, Maria. Das waren Gocher Originale mit dem typischen Sing in der Stimme, nach dem Motto: „Kann ich Sie helfen, oder werden Sie schon geholfen?“ (aus einem Gocher Schuhgeschäft)
Ulla war Primarstufenlehrerin, Karl-Heinz war Jurastudent, Fritz studierte Sport, Hilla war S II-Lehrerin am Gocher Gymnasium, Ria war Sonderschullehrerin und Maria war Steuerberaterin.
Meistens gingen wir, wenn wir uns mit diesen Leuten trafen, zu „Lucy“, das war eine sehr nette Kneipe „Hinter der Mauer“. Neben uns gab es in der Bahnhofstraße das Radio- und Fernsehgeschäft „Thonnet“. Bei „Thonnet“ kaufte ich mir einen „Telefunkenreceiver“ und einen Plattenspieler (direktgetrieben) von „Aiwa“. Irgendwann kaufte ich von Willi die Boxen, die er selbst gebaut hatte. Das waren meine ersten HiFi-Bausteine. Ich tauschte mich in diesen Dingen immer mit Jürgen vom Rheinberger Gymnasium aus, der war absolut fit in diesem Metier. Ich fuhr sogar mal zum Boxentest zu ihm nach Krefeld. Wir schlossen dann die Boxen an seine Anlage an und testeten sie mit einer Test-CD.
Jürgen war ein kauziger Typ, unglaublich intelligent, er unterrichtete Sozialwissenschaften, Philosophie und Geschichte. Er hatte ein Fahrrad mit Front-Freilauf. Der Sinn dieser Sache war, dass man die Kettenschaltung beim Rollen betätigen konnte. Ich hatte nie wieder jemanden mit so einem Fahrrad gesehen.
Gabi war manchmal wie versteinert, ich hatte nie richtig zu ihr durchgeblickt. Sie unterrichtete nur Biologie und war aktiv in der GEW, Mitglieder in der GEW waren wir alle.
Julia war die Ex-Frau von Jürgen und die Freundin von Walter. Julia war sehr nett, ein bisschen füllig und konnte sehr gut kochen. Wir hatten bei ihr die erlesensten Dinge gegessen.
Walter kam aus Brachbach, er war also Siegerländer. Walter war ein echter „Kalle“, wie man im Siegerland so sagte. Er wohnte zusammen mit Julia in Mülheim.
Joach war seit einem Jahr an der Schule. Er gab Französisch und Sport. Er war mit Bandu verheiratet, sie ließen sich aber kurze Zeit später scheiden. Joach streckte seine Fühler überall hin aus. Er war ganz in Ordnung. Ich machte mit ihm in den Achtzigern eine Fahrradtour nach Aix-en-Provence.
Georg war ein Kölner Urgewächs und machte auch keinen Hehl daraus.
Wir kannten inzwischen viele neue Leute.
Im Jahre 1979 feierten wir in unserer schönen Wohnung eine große Fete, zu der sogar mein Bruder aus Holland anreiste. Jede Menge Bekannte kamen aus Siegen. Bis heute ist das warme Bier überliefert. Ich hatte keine Möglichkeit, das Bier zu kühlen. So stellten wir die Getränke einfach auf den Speicher nebenan. Der war im Sommer natürlich schön warm, entsprechend warm war das Bier. Dennoch war die Fete klasse. Nachts waren wir an der Niers und waren mit nacktem Hintern im Wasser. Ich musste meinem Bruder eine neue Hose von mir geben. Ein anderes mal waren wir mit Stefans VW-Bus in Holland. Als wir an der Grenze unsere Ausweise zeigen sollten, konnte der Siegener Klaus nur seinen Führerschein vorweisen, er kam aber trotzdem rüber.
Unmittelbar hinter der Grenze gab es eine Heidelandschaft mit richtigen Sanddünen. Das war toll da. Wir fletzten uns in den Sand und tranken Bier.
In unregelmäßigen Abständen hatte ich mit Georg und dem „Langen“ in Hülm, einem Stadtteil von Goch, Fußball gespielt. Der Platz glich mehr einem Acker als einem Fußballplatz, prompt hatte ich mir den Knöchel verstaucht. Das Fußballspielen war sehr anstrengend, es schlauchte und erforderte ziemliche Kondition. Auch in Rheinberg hatten wir ab und zu gegen Schüler gespielt, da machten dann Walter, Jürgen, Georg und Joach mit.
Das Referendariat war die notwendige Zwischenstufe für den Staatsdienst. Die organisatorische Struktur und die hierarchischen Ausprägungen waren katastrophal. Aber so war der Staatsdienst eben, man hätte ja nicht antreten müssen! Im Seminar wurde man sofort Mitglied der DeBeKa. Da gab es nicht soviel zu überlegen. Es wurden Einführungsveranstaltungen abgehalten zu Themen wie Trennungsgeld, Besoldungsgruppen, Urlaubsregelung, Fahrtkostenerstattung. Diese Veranstaltungen waren naturgemäß sehr trocken und man ließ sie widerwillig über sich ergehen. In der Schule gab es eine einführende Hospitationsphase, das hieß, man saß hinten in der Klasse und beobachtete den Unterricht. Das war für den unterrichtenden Lehrer nicht gerade sehr angenehm. Nach und nach entwickelte sich aber ein freundschaftliches Verhältnis zu den Lehrern, und wir gingen nach der Schule oft ins „Cafe Rose“.
Als man dann selbst vor einer Klasse stand, war das schon etwas ganz anderes. Man hatte anfangs eine große Angst, nicht so sehr vor den Schülern, vielmehr Versagensangst. Eine Unterrichtsstunde dauerte fünfundvierzig Minuten, und man saß manchmal Tage an ihrer Vorbereitung. Als käme es darauf an! Das wichtigste war es doch, den Schülern etwas beizubringen. Es konnten Dinge den Unterricht beeinflussen, die sich situativ ergaben, die nie in einem Unterrichtsentwurf stehen könnten. Unwägbarkeiten eben, Versagen technischer Geräte zum Beispiel. Es konnte ja die Birne im Overheadprojektor kaputtgehen! Auf diesen Einwand hin bekam ich einmal zu hören, dass man für solche Fälle immer eine Reservebirne bei sich zu tragen hätte! Eigentlich musste ein Unterrichtsentwurf eine solche Eventualität berücksichtigen und einen alternativen Stundenverlauf vorsehen. Missratene Unterrichtsstunden, sei es nun, dass das Stundenziel nicht erreicht wurde, dass das Tafelbild nicht gut war, dass das Bearbeitungsmaterial nicht bewältigt werden konnte etc., waren immer ein Zeichen von nicht gut vorbereitetem Unterricht. Selbst im Nachhinein denke ich, dass die Unterrichtsplanung durchaus Sinn macht. Sie ist ja nichts anderes als eine Reflexion aller den Unterricht beeinflussenden Faktoren. Ich muss mir vor der Durchführung einer Unterrichtsstunde selbstverständlich im Klaren darüber sein, was konkret diese Stunde erreichen soll, das heißt, ich muss mir überlegen, wem will ich etwas vermitteln, was ist der fachliche Hintergrund des Themas, warum ist dieses Thema für die Schüler wichtig, wohin soll der Unterricht führen, wie gehe ich vor, und warum wähle ich diese Schritte?
Sofort wird klar, dass nicht jede Unterrichtsstunde so geplant werden kann, besonders nicht in der späteren Praxis mit vierundzwanzig Wochenstunden. Es spielt sich da aber eine Routine ein, was nicht heißen soll, dass man dann die alten Schienen langfährt, sondern dass sich eine Sicherheit beim Lehrenden im Umgang mit Schülern herausbildet, dass man quasi automatisch seinem Unterricht eine Motivationsphase vorausstellt und Interesse am Unterricht weckt. Dass man Methodenwechsel betreibt, dass man die Schüler auch fordert.
Das sind Dinge, die sich erst in der eigenen Unterrichtspraxis ergeben. Die Routine gibt einem Festigkeit und Stabilität. Es gibt dann kein Ereignis mehr, das eine Unterrichtsstunde scheitern lassen kann. Selbst manifest opponierende Schüler können abgefangen und zumindest ruhig gestellt, notfalls vor die Tür verwiesen werden. Der Prozess, innerhalb dessen man sich eine solche Routine zu eigen machen sollten, war auf zwei Jahre angelegt. Höhepunkte der Referendarausbildung waren die Lehrproben. Das hieß, dass einen der Fachleiter im Unterricht besuchte und nach einem Unterrichtsgespräch bewertete. Von solchen Lehrproben musste ich in jedem Fach acht absolvieren. Meine Güte, wie war man da nervös, wie hatten die Leute im Vorfeld solcher Lehrproben gelitten! Man musste jeweils einen kompletten Unterrichtsentwurf abgeben, der natürlich im Unterrichtsgespräch auseinandergenommen wurde. Man hatte ja den konkret gelaufenen Unterricht vor Augen und konnte den wunderbar mit dem Entwurf vergleichen, Abweichungen ausfindig machen, sehen, wo Ziele nicht „gegenlesbar“ waren.
„An dieser Stelle hätten sie anders verfahren müssen!“, „Die Motivationsphase war nicht stimmig!“, „Sie hätten in der Schlussphase den Hausaufgaben mehr Raum geben müssen!“, „Die Ergebnissicherung war so nicht fest genug!“, solche oder ähnlich Statements gab es dann zu hören. Wie hasste ich es, so auf dem Präsentierteller serviert zu werden!
Die theoretischen Grundbestandteile der Unterrichtsstunden wurden in den Fachseminaren vertieft. Weil eben alles theoretisch erörtert wurde, gab es da oft ein heilloses Geschwafel. Man fuhr dann mit einem Groll im Bauch wieder nach Hause.
Besonders wurde natürlich nach Unterrichtsbesuchen auf den Fachseminarleiter geflucht. In der Regel ließ er kaum eine gutes Haar an den Unterrichtsstunden.
Die Referendarzeit war insgesamt eine harte Kost. Man bekam aber ein für damalige Verhältnisse ganz annehmbares Gehalt und war insofern besser gestellt, als als Student.
Das Referendariat wurde damals von allen mir bekannten Referendaren massiv kritisiert. Man stand als Referendar zwischen allen Fronten und durchlebte emotionale Ausahmesituationen. Das Schlimmste aber war die Behandlung nach Gutsherrenart.
Die Fachleiter waren keine sonderlich geschulten Lehrer, man wurde zum Fachleiter berufen.
Gleichwohl waren sie in dem Hierarchiesystem mit denkbar großer Machtfülle ausgestattet, die sie praktisch unkontrolliert ausüben konnten. Insofern ergab sich ein großer Widerspruch zwischen der Ausbildungssituation und den zu vermittelnden Unterrichtsinhalten. Es kam vor, dass Hauptseminarleiter den Unterricht ohne auch nur den leisesten Schimmer von der Materie besuchten. Sie waren in ihrer Selbstherrlichkeit unangreifbar. Ich denke, dass da eine Menge Reformbedarf in der Referendarausbildung besteht.
Das Staatsexamen war eine ganz besondere Prüfung: man hielt zwei Unterrichtsstunden vor einem Prüfungskollegium aus einem leitenden Regierungsschuldirektor, den Fachseminarleitern und den Fachlehrern. Die Nervosität war unbeschreiblich. Ich hatte niemals im Leben wieder so einen Druck verspürt wie beim zweiten Staatsexamen. Es schloss sich ein circa einstündiges Kolloquim an.
Ich bestand die Prüfung und fühlte einen riesigen Felsbrocken vom Herzen fallen. Es machte sich eine nie gefühlte Erleichterung breit. Ich brauchte Tage, um mich mit der neuen Situation zu arrangieren, nicht mehr geprüft zu werden, keinen Unterrichtsentwurf mehr schreiben zu müssen, keinen Fachleiter mehr vor der Nase zu haben. Ich weiß noch, wie ich völlig losgelöst am 23. April zum Geburtstag meiner Mutter gefahren war. In Goch gratulierte man sich gegenseitig zum bestandenen zweiten Staatsexamen, es gab eine Abschlussfete beim „Langen“, Hinz und Kunz kamen dahin, alle waren froh, dem Stress endlich entronnen zu sein. Tina und ich hatten in Goch den Niederrhein lieben gelernt. Die flache Landschaft war nicht jedermanns Sache, besonders, wenn man aus einer gebirgigen Landschaft stammte wie Tina. Aber gerade sie war es, die den Niederrhein liebte. Das Siegerland hatte sicher seine Reize, man fühlte sich aber durch die Berge schnell erschlagen, die Häuser drängten sich in den Tallagen und waren in tristes schiefergrau gefasst. Ich dachte, dass sich der eingeengte Horizont auch auf die Menschen auswirkte. Das betraf die Alpenbewohner ganz besonders. Um von A nach B zu kommen, musste man beträchtliche Wege in Kauf nehmen. Das war oben am Niederrhein kein Problem, herrlich war da das Fahrradfahren. Fietsen hießen die Räder da wie in Holland. Fahrradfahren war im Siegerland natürlich mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Man sah auch kaum Fahrradfahrer, wer fuhr auch schon gerne entlang der Hauptverkehrsstraßen durch die Täler und atmete den Auspuffqualm vorbeifahrender Autos ein?
Langsam ging unsere Gocher Zeit zu Ende und wir machten uns über unsere Zukunft Gedanken. Ich musste mich um eine Stelle an einem Gymnasium bewerben, Tina kündigte ihren Job in Wesel. Bis zum Beginn des Schuljahres hatten wir noch drei Monate Zeit! Als der „Lange“, Andrea, Tina und ich bei „Lucy“ saßen, kam uns die Idee, gemeinsam nach Südamerika zu fahren und die dreimonatige Wartezeit damit sinnvoll zu überbrücken. Ich weiß nicht mehr, wer die Idee zuerst hatte, aber niemand widersprach, alle waren von der Sache überzeugt. Der gemeinsame Urlaub würde zeigen, ob unsere Freundschaft auf Dauer angelegt war oder nicht. Gemeinsame Urlaube eignen sich besonders gut für solche Dinge, Problemen, die sich stellen, kann man nicht aus dem Wege gehen und muss sie gemeinsam lösen, oder man bricht die ganze Sache ab. Wir hatten schon öfter etwas mit den beiden unternommen, so waren wir zum Beispiel einen Urlaub lang in Polen, das hatte prima geklappt. Besonders toll war immer das Essen in der Laterne in Kalkar. Das war ein einfach eingerichtetes Restaurant, das von einem ehemaligen Schiffskoch betrieben wurde. Er hatte völlig exotische Gerichte auf der Speisekarte, die so etwas von untypisch für diese Gegend waren. Die Speisen waren ausgezeichnet zubereitet und man freute sich immer schon zu Hause, wenn es abends nach Kalkar ging. Kalkar und Goch waren über zehn Kilometer mit einer kerzengeraden Straße verbunden. Die „Laterne“ lag direkt am Marktplatz. Aber auch in Goch und in der näheren Umgebung gab es gute Restaurants. Manchmal fuhren wir nach Holland zum Chinesen.
Unsere Südamerika-Reise bedurfte natürlich der Vorbereitung, insbesondere mussten wir Spanisch lernen. In Südamerika kam man mit Englisch nicht sehr weit, und an andere Fremdsprachen war schon gar nicht zu denken. Also meldeten wir uns bei der Volkshochschule in Kevelaer an und belegten einen Einführungskurs in Spanisch. Dann planten wir ganz grob, wie wir Südamerika bereisen, das hieß, welche Länder wir sehen wollten. Es kristallisierte sich heraus, dass wir nach Peru fliegen und uns von da aus langsam nach Norden zur Karibik bewegen wollten. Unser Rückflug sollte von Barbados aus gehen. Das war natürlich ein großes Programm, soviel war uns klar. Wir würden Equador, Kolumbien und Venezuela bereisen. In Equador wollten wir einen Abstecher auf die Galapagosinseln machen. Aber zuerst waren wir noch in Goch am Niederrhein. Wir mussten uns ein paar Sachen kaufen, die wir unbedingt für die Reise brauchten, dazu zählte ein Rucksack mit Tragegestell und ein Schlafsack. Wir besorgten uns die Sachen bei Quelle, nachdem wir uns vorher bei „Stiftung Warentest“ sachkundig gemacht hatten. Ich hatte mir während des Referendariats eine „Nikon EM“ gekauft. Das war eine besonders kompakte Spiegelreflexkamera, Sie war aber dennoch zu groß. Ich lieh mir von meinem Schwiegervater eine kleine „Rollei“, die so gut wie gar keinen Platz wegnahm. Ich kaufte zwölf „Fuji“-Diafilme. Das waren vierhundert Fotos. Aber Filme konnte man überall kaufen! Die Spiegelreflexkameras waren damals der größte Hit, man konnte sehr gute Fotos machen. Der Nachteil war, dass man das ganze Zubehör mitschleppen musste, Ich hatte ein 210 mm Zoomobjektiv, ein Weitwinkelobjektiv und einen Blitz. Das alles wurde neben Filmen und Batterien in eine Extratasche gepackt und an die Schulter gehängt, das war schon sehr lästig und schied deshalb für unsere Reise aus. Nur die Kamera ohne Zusatzausstattung mitzunehmen, war uninteressant. Aber wir hatten mit unseren Rucksäcken schon genug zu schleppen. Dann mussten wir noch die Flüge kaufen. Die billigste Flugverbindung ging mit Aeroflot, da wir einen Gabelflug brauchten, verteuerte sich die Sache noch einmal. Wir gingen in das Gocher Reisebüro auf der Steinstraße und trugen da unsere Flugwünsche vor. Dort war man sehr entgegenkommend und verkaufte uns vier Gabelflüge: hin nach Lima von Frankfurt aus, zurück von Barbados nach Luxemburg. Wie wir uns von Lima nach Barbados bewegen wollten, war uns völlig allein überlassen. Wir würden alles weitere vor Ort organisieren.
Der Spanischkurs in Kevelaer war prima, der Lehrer war fasziniert vom Spanischen und verstand es, diese Faszination auf uns zu übertragen. Da ich Latein in der Schule hatte, fiel mir das Spanische relativ leicht. Als Literatur hatten wir Martin Velbinger, „Südamerika“, München 1978 und das „Southamerican Handbook“, das war das Nonplusultra. Der Velbinger schrieb recht locker und gab gute Alltagstipps vom Hotel über Museen, Restaurants, Busverbindungen, Schiffe bis zu Flugverbindungen. Wir hatten ihn sehr oft benutzt. Das „Southamerican Handbook“ war aber unerreicht, wenn da ein Hotel recommended war, konnte man es bedenkenlos nehmen. Auch gesundheitlich mussten wir einige Vorkehrungen treffen. Wir ließen uns am Tropeninstitut in Krefeld eine Gammaglobulinimpfung gegen Hepatitis C geben, wir überprüften unseren Tetanus-Status und nahmen Resochin-Tabletten gegen Malaria mit. Die Gammaglobulinimpfung war mit siebzig DM pro Person sehr teuer. Dann ließen wir uns in unsere Jeans die hinteren Taschen noch einmal innen gegennähen, sodass wir einen sicheren Platz für unser Geld hatten. Eines war aber klar, wer es auf unser Geld abgesehen hätte, würde auch nicht davor zurückschrecken, uns k.o. zu schlagen und dann auszurauben.
Das Innere des Rucksackes schützten wir mit einem Korb aus Kaninchendraht vor Messerschlitzern. Diese Sicherungsmaßnahmen stellten wir deshalb an, weil wir im Vorfeld von bestimmten Vorkommnissen gehört hatten. Die Reise sollte zweieinhalb Monate dauern. Den Hinflug kauften wir für den vierten Mai, den Rückflug für den zwölften Juli. Das war eine lange Zeit, wir glaubten aber, dass das Programm, das wir geplant hatten, eine solche Zeit nötig machen würde. Wir hatten noch ungefähr zwei Wochen für die Vorbereitung, dann würden wir uns in Frankfurt treffen. Das wäre meine erste Fernreise, Tina war schon mal in Südafrika.
Wir fuhren zuerst nach Dillenburg, wo wir uns noch einen Tag aufhielten.
Dann nahmen wir von dort den Zug nach Frankfurt.