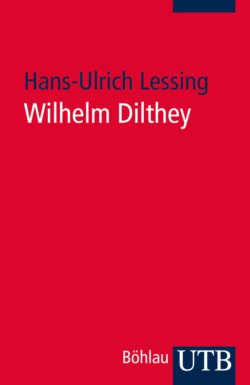Читать книгу Wilhelm Dilthey - Hans-Ulrich Lessing - Страница 9
1 Wilhelm Dilthey: Basisdaten zu Leben und Werk
ОглавлениеDiltheys Leben verlief – von außen betrachtet – unspektakulär. Seine Lebensgeschichte entspricht auf geradezu frappierende Weise der typischen Biographie eines deutschen Professors der Geisteswissenschaften oder der Philosophie in der zweiten Hälfte des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts.
Wie viele andere bedeutende Gestalten der deutschen Geistesgeschichte entstammt auch Dilthey einem protestantischen Pfarrhaus. Sein Großvater war Pfarrer, seine Großmutter Pfarrerstochter, und Diltheys Vater, Maximilian Dilthey (1804 – 1867), war reformierter Pfarrer, Kirchenrat, Dekan und nassauischer Oberhofprediger. Diltheys Mutter, Maria Laura Dilthey (1810 – 1887), kam aus einem künstlerischen Haus und war Tochter des herzoglichen Hofkapellmeisters Johann Peter Heuschkel. Dilthey hatte drei Geschwister: seine Schwester Marie (1836 – 1891) lebte nach kurzer Ehe wieder im Hause ihrer Eltern, sein Bruder Karl (1839 – 1907) war Professor der Archäologie und klassischen Philologie in Zürich und Göttingen, und seine Schwester Lily (1846 – 1920) war verheiratet mit Diltheys Freund, dem Bonner klassischen Philologen Hermann Usener (1834 – 1905).
Wilhelm (Christian Ludwig) Dilthey wurde am 19. November 1833 in Mosbach-Biebrich am Rhein bei Wiesbaden im damaligen Herzogtum Nassau geboren. Dilthey besuchte ein Gymnasium in Wiesbaden und bestand 1852 die Reifeprüfung. Im Sommersemester 1852 begann er – dem Wunsch seines Vaters und der Familientradition folgend – ein Studium der Theologie an der Universität Heidelberg in der Absicht, ebenfalls den Beruf des Pfarrers zu ergreifen. Doch schon bald, das zeigen seine frühen Briefe, geht er auch philosophischen Interessen nach und hört bei dem später sehr bekannt gewordenen hegelianischen Philosophiehistoriker Kuno Fischer (1824 – 1907).
[19]
Nach drei Semestern in Heidelberg wechselt Dilthey zum Wintersemester 1853/54 an die Berliner Universität, wo er neben seinen theologischen Studien bei Karl Immanuel Nitzsch (1787 – 1868) und August Detlev Christian Twesten (1789 – 1876) u. a. auch Lehrveranstaltungen bei dem bekannten Philosophen Friedrich Adolf Trendelenburg (1802 – 1872), der Aristoteliker und entschiedener Hegel-Gegner war, dem Philologen August Boeckh (1785 – 1867) und dem Historiker Leopold von Ranke (1795 – 1886) besucht und die schon in Heidelberg vorgezeichnete Wendung zur Philosophie und Geistesgeschichte schon bald endgültig vollzieht.
In Berlin erhält Dilthey die entscheidenden Anregungen, die die Ausrichtung und Entwicklung seines Lebenswerks bestimmen sollten. Es gibt ein sehr schönes, ebenso autobiographisch wie wissenschaftsgeschichtlich aufschlussreiches Textstück, in dem Dilthey die geistesgeschichtliche Konstellation anschaulich schildert, die in der zweiten Hälfte der fünfziger und beginnenden sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts an der Berliner Universität herrschte. Dieser Passus findet sich in dem Nachruf auf seinen Freund Wilhelm Scherer (1841 – 1886), einen seinerzeit bekannten positivistischen Literaturhistoriker und -wissenschaftler. Sehr lebendig und eindringlich beschreibt Dilthey in diesem Text, in dem er auch die ihn prägenden Lehrer und Anreger nennt, die Situation, in der er sich und mit ihm viele andere Vertreter seiner Generation während ihres Studium befanden und die durch das Spannungsverhältnis zwischen der in Berlin traditionsreichen historischen Schule, dem neu aus Frankreich und England kommenden Positivismus und Empirismus sowie den rasch expandierenden Naturwissenschaften charakterisiert war: „An der Berliner Universität überwogen damals noch von ihrer Gründung her die Geisteswissenschaften. Auf Wilhelm von Humboldt, Fr. A. Wolf, Schleiermacher, Hegel, Savigny als ihre nächsten Vorfahren blickten die Gelehrten zurück. Berlin war noch der Sitz der historischen Schule. Die am meisten hinreißenden Vorlesungen waren die von Ritter und Ranke, in denen der universale erdumspannde Geist empirisch-historischer Betrachtung, wie er von den Humboldts zuerst vertreten worden war, am reinsten sich ausdrückte. Indem Trendelenburg durch die Erkenntnis und die Verteidigung des Aristoteles die Kontinuität der
[20]
philosophischen Entwicklung aufzuzeigen und zu wahren strebte, erschien seine Richtung mit der historischen Schule einstimmig. Berlin war aber auch zweifellos der Mittelpunkt der germanistischen Studien, denen sich Scherer gewidmet hatte. Hier lebte und arbeitete noch Jacob Grimm, zuweilen sah man wohl die schlichte unbeschreiblich imponierende Gestalt durch den Tiergarten schreiten oder vernahm ihn in der Akademie, niemand kann den Eindruck vergessen, der ihn dort über den Bruder sprechen hörte. […] Aber die Jüngeren, die sich zu Berlin in den sechziger Jahren zusammenfanden und sich da ganz anders, als es heute in der Reichshauptstadt möglich wäre, aneinanderschlossen, hatten nun auch ihr eigenes Leben. Ein so spröder und stolzer Zug durch das gelehrte Wirken von Trendelenburg, Müllenhoff, Droysen hindurchging: sie haben doch ihre Schüler niemals einengen wollen. Unter diesen herrschte der Geist einer veränderten Zeit. Die Erfahrungsphilosophie, wie sie Engländer und Franzosen ausgebildet haben, wurde ihnen durch Mill, Comte und Buckle nahe gebracht, und von ihr aus formten sich ihre Überzeugungen. Die aufstrebenden Naturwissenschaften forderten eine Auseinandersetzung mit denselben, wollte man zu festen Ansichten gelangen.“ (XI, 242f.)
Doch wurde – wie Dilthey zu verstehen gibt – seine anfängliche Aufgeschlossenheit oder gar Begeisterung für die moderne positivistisch-empiristische Erfahrungsphilosophie wieder relativiert oder zurückgenommen, denn die Beschäftigung mit der Romantik „regte freiere und der deutschen Wissenschaft gemäßere Betrachtungen über den Zusammenhang der Geschichte an, als Mill, Buckle und Comte gegeben hatten. Eine an Carlyle, Emerson, Ranke erzogene Vertiefung in große Persönlichkeiten lehrte ihre Rolle in der Geschichte anders beurteilen, als jene englischen und französischen Schriftsteller es getan haben.“ (XI, 243; vgl. auch V, 4)
Auf Drängen seines Vaters legt Dilthey im Oktober 1855 sein theologisches Examen in Wiesbaden und im folgenden Jahr in Berlin sein philologisches Examen ab. Es folgt eine mehrjährige Lehrtätigkeit an Berliner Gymnasien, während der er aber seine wissenschaftlichen Projekte weiterbetreibt, die er schon in der Spätphase seines Theologie-Studiums mit der Absicht verfolgt hatte, eine Universitätslaufbahn einzuschlagen. Dilthey beschäftigt sich in diesen Jahren mit dem Plan, „Kirchen- u.
[21]
Dogmengeschichte zum Studium der Geschichte der christlichen Weltanschauung im Abendlande zu verknüpfen“. (BW I, 548) Insbesondere widmet er sich den frühchristlichen theologisch-philosophischen Systemen und der Gnosis, und er will aus diesem Forschungsfeld ein Dissertations-Thema wählen.
Im Jahr 1859 beteiligt sich Dilthey, der sich schon seit einiger Zeit mit Schleiermacher und dessen wissenschaftlichen Nachlass beschäftigt hatte, an einer Preisaufgabe der Schleiermacher-Stiftung und gewinnt im Februar 1860 mit seiner großen Abhandlung Das eigentümliche Verdienst der Schleiermacherschen Hermeneutik ist durch Vergleichung mit älteren Bearbeitungen dieser Wissenschaft, namentlich von Ernesti und Keil, ins Licht zu setzen „den doppelten Preis“. (BW I, 549) Dieser bedeutende Beitrag zur Erforschung der Geschichte der Hermeneutik wird von Dilthey, obwohl er dazu gedrängt wird, nicht publiziert, sondern erst 1966 von M. Redeker aus dem Nachlass veröffentlicht, und zwar im Kontext des von Dilthey nicht vollendeten zweiten Bandes seiner monumentalen Schleiermacher-Biographie. (XIV, 595 – 787).
Das Preisgeld gibt Dilthey, der kurz zuvor seine Schultätigkeit aufgegeben hat, da sich seine wissenschaftlichen Ambitionen mit dem Schuldienst nicht vereinbaren lassen, die Möglichkeit, sich nun ganz auf seine Arbeiten, Projekte und Pläne zu konzentrieren. Er lebt nun mehrere Jahre als Privatgelehrter und freier Publizist in Berlin und veröffentlicht in dieser Zeit eine Fülle von Aufsätzen und Rezensionen, die zumeist anonym oder pseudonym erscheinen.
Seit 1857 publiziert Dilthey wissenschaftliche Arbeiten und engagiert sich bei der Edition von Schleiermachers Briefwechsel. Nach dem Tode des Herausgebers Ludwig Jonas übernimmt Dilthey die Herausgabe der Bände drei (1861) und vier (1864) der Ausgabe Aus Schleiermacher‘s Leben. In Briefen.
Zu Beginn des Jahres 1860 wendet sich Dilthey von der Beschäftigung mit den Kirchenvätern und den gnostisch-neuplatonischen Systembildungen ab und der ersten Periode der Scholastik zu. (Vgl. BW I, 133, 139) Sein Ziel ist es nun, ein Buch über den Ursprung der mittelalterlichen Philosophie zu schreiben. (Vgl. BW I, 152, 256) Aber auch dieser Plan lässt sich ebenso wenig realisieren wie der frühere. Aus der Einleitung zum
[22]
dritten Band der Schleiermacher-Edition, die er auf Druck der Erben Schleiermachers seinem Band nicht voranstellen kann, erwächst ihm der Plan zu einer umfangreichen Biographie Schleiermachers. (Vgl. BW I, 163) Eine schwere Augenerkrankung zwingt Dilthey für mehrere Monate, auf das Schreiben und Lesen zu verzichten. Er entscheidet sich daher kurzfristig, bei seinem Lehrer Trendelenburg mit einer „sehr oberflächliche[n] Abhandlung über Schleiermachers Ethik“ (BW I, 550) zu promovieren. Am 16. Januar 1864 promoviert er mit der Schrift De principiis Schleiermacheri (nur teilweise auf Deutsch publiziert in: XIV, 339 – 357) und habilitierte sich wenige Monate später, am 17. Juni 1864, mit der Untersuchung Versuch einer Analyse des moralischen Bewußtseins (aus dem Nachlass veröffentlicht in: VI, 1 – 55) und beginnt zum Wintersemester 1864/65 als Privatdozent für Philosophie an der Berliner Universität mit seinen Vorlesungen.
Mit Moritz Lazarus (1824 – 1903), dem Begründer einer Völkerpsychologie, der seinem Berliner Freundeskreis angehörte, hatte Dilthey schon früh intensive Gespräche über wissenschaftsphilosophische Probleme geführt. Spätestens ab 1862 befasst er sich auch mit einer „Art Wissenschaftslehre“ (BW I, 262; vgl. 265), die aber, wie viele andere frühe (Buch-)Pläne, die u. a. die „sociale und moralische Natur des Menschen“ (BW I, 320f.) und das Studium des Menschen und der Geschichte (vgl. BW I, 350, 386) zum Thema haben, Fragment bleibt. Auch seine erste Vorlesung im Wintersemester 1864/65 gilt dieser wissenschaftstheoretischen Thematik. Für die Vorlesung lässt Dilthey einen Grundriß der Logik und des Systems der philosophischen Wissenschaften drucken (1865; XX, 19 – 32), den man als Keimzelle seines späteren Unternehmens einer Grundlegung der Geisteswissenschaften ansehen kann.
Schon 1867 wird Dilthey als ordentlicher Professor der Philosophie an die Universität Basel berufen und hält dort seine Antrittsvorlesung über Die dichterische und philosophische Bewegung in Deutschland 1770 – 1800 (aus dem Nachlass veröffentlich in: V, 12 – 27). In Basel arbeitet Dilthey vornehmlich an seiner Schleiermacher-Biographie, beginnt sich aber außerdem in die aktuelle physiologische und physikalische Forschung einzuarbeiten und richtet sein Interesse erstmals verstärkt auf Anthropologie und Psychologie. Dilthey bleibt nur für wenige Se-
[23]
mester in Basel; schon 1869 wird er an die Universität Kiel berufen, an der er bis 1871 lehrt.
1870 veröffentlicht er den ersten Band seiner Schleiermacher-Biographie Leben Schleiermachers (um Partien aus dem Nachlass erweitert in GS XIII), an dessen zweitem Band er in den nächsten Jahren mit großer Intensität arbeitet, ohne ihn abschließen zu können. Immer wieder kündigt Dilthey seinem Verleger den baldigen Druckbeginn an (vgl. z. B. BW I, 802, 823, 830), kann aber sein sehr ehrgeiziges Projekt, das er schon früh als Belastung empfindet, nicht zum Abschluss bringen und bezeichnet schon vor Publikation des ersten Bandes sein Schleiermacher-Projekt, das ihn fast lebenslang begleiten sollte, als „Lebensplage“ (BW I, 510).
1871 wechselt Dilthey an die Universität Breslau, wo er bis 1882 lehrt. In seiner Breslauer Zeit, die zu den philosophisch fruchtbarsten Abschnitten seines Lebens gehört und für seine philosophische Entwicklung von kaum zu überschätzender Bedeutung ist, erarbeitet Dilthey wichtige erkenntnistheoretische und psychologische Konzeptionen und die Grundzüge seiner Philosophie der Geisteswissenschaften.
Nachdem Dilthey in den sechziger Jahren zahlreiche Rezensionen sowie populäre literaturgeschichtliche und biographischen Aufsätze, u. a. zu Schlosser, Schleiermacher, Schopenhauer, Novalis und Lessing veröffentlicht hatte, publiziert er während seiner Breslauer Jahre eine immense Anzahl von Rezensionen, Literaturbriefen, Berichten vom Kunsthandel und kleineren populären biographischen Skizzen und Aufsätzen (u. a. zu Voltaire, Richard Wagner, Balzac, Heinrich Heine, John Stuart Mill, Dickens, George Sand), die v. a. in der Publikumszeitschrift Westermann‘s Illustrirte Deutsche Monatshefte erscheinen und in den Bänden XV – XVII der GS dokumentiert sind. Außerdem veröffentlicht Dilthey 1875 nach einer Reihe von – nicht publizierten – Vorarbeiten mit der so genannten „Abhandlung von 1875“ Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und dem Staat (V, 31 – 73) die wichtigste Vorstufe seines Hauptwerks Einleitung in die Geisteswissenschaften. Weiterhin veröffentlicht er 1877 unter dem Titel Über die Einbildungskraft der Dichter eine ausführliche Besprechung von Herman Grimms Goethe-Buch (XXV, 125 – 169). Dieser Aufsatz ist die erste Fassung von Diltheys berühmtem Goethe-Aufsatz, der später in
[24]
seinen literargeschichtlichen Sammelband Das Erlebnis und die Dichtung (XXVI, 113 – 172) aufgenommen wird.
1874 heiratet Dilthey die Berliner Rechtsanwaltstochter Katharina Püttmann (1854 – 1932), mit der er drei Kinder hat (Max, Helene und Clara, die später den Philosophen und Dilthey-Schüler Georg Misch heiratet). In Breslau schließt Dilthey vermutlich im Herbst 1873 Freundschaft mit dem Grafen Paul Yorck von Wartenburg (1835 – 1897), dem Enkel des berühmten preußischen Generals Ludwig Yorck von Wartenburg. Yorck, ausgebildeter Jurist und vielseitig interessierter Privatgelehrter, bewirtschaftet das Familiengut Klein Oels bei Breslau und wird – neben H. Usener – zum wichtigsten Freund und wissenschaftlich-philosophischen Gesprächspartner Diltheys, der mit ihm seine Veröffentlichungs- und Forschungsprojekte entweder bei seinen vielen Besuchen in Klein Oels oder brieflich erörtert. Der Briefwechsel zwischen Dilthey und dem Grafen (Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck v. Wartenburg 1877 – 1897) ist zweifellos eine der wichtigsten philosophischen Korrespondenzen in deutscher Sprache und für das Verständnis der philosophischen Konzeptionen des „mittleren Dilthey“ eine unverzichtbare Quelle.
Am 22.7.1882 wird Dilthey (zum 1.10.1882) als Nachfolger Rudolf Hermann Lotzes an die Berliner Universität berufen; die Übersiedlung nach Berlin erfolgt Michaelis (29.9.) 1882. Bei dieser Berufung spielt die noch in Arbeit befindliche Einleitung eine bedeutende Rolle. Zur Unterstützung seines Anspruchs auf die Berliner Professur hatte Dilthey Teile des im Druck befindlichen ersten Bandes des Werks an die für Berufungsangelegenheiten zuständigen Beamten im preußischen Kultusministerium, Richard Schöne und Friedrich Althoff, geschickt und Absicht und Anlage seines Buches in Begleitbriefen ausführlich erläutert. (Vgl. den Brief an R. Schoene [vor 6. Juli 1882], BW I, 885 – 888, und Aus Konzepten zum sogenannten „Althoff-Brief“ [Mitte 1882], XIX, 389 – 392)
Im Frühjahr 1883 erscheint der erste Band der Einleitung in die Geisteswissenschaften im Leipziger Verlag Duncker & Humblot (GS I). Der Publikation war eine förmliche Zusage gegenüber dem Verleger der Schleiermacher-Biographie, Georg Ernst Reimer, vorausgegangen, wonach der eigentlich im Sommer 1882 beginnende Druck des zweiten
[25]
Bandes vom Leben Schleiermachers, der für die Veröffentlichung des ersten Bandes der Einleitung zurückgestellt worden war, sofort nach der Publikation, d. h. vor der Veröffentlichung des zweiten Bandes der Einleitung, beginnen sollte. (Vgl. Diltheys Brief an G. E. Reimer vom 13.3.1882, BW I, 874)
Mit Beginn seiner Berliner Lehrtätigkeit stellt Dilthey seine außergewöhnlich umfangreiche Publikationstätigkeit für Westermanns Monatshefte ein und veröffentlicht nun fast nur noch wissenschaftlich-philosophische Schriften. Er entwickelt eine große Produktivität, und in schneller Folge treten nun viele wichtige systematische und historische Schriften Diltheys an die Öffentlichkeit, die zum erheblichen Teil dem historischen und systematischen Kontext des geplanten, aber nie fertig gestellten zweiten Bandes der Einleitung angehören.
1885 erscheint in erster Auflage als Grundlage für seine philosophiehistorischen Vorlesungen sein Biographisch-literarischer Grundriß der allgemeinen Geschichte der Philosophie (6. Aufl. 1905 in: GS XXIII, 1 – 160). 1887 wird Dilthey als ordentliches Mitglied in die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften (Berlin) aufgenommen (vgl. die Antrittsrede, V, 10 – 11) und gibt vom selben Jahr ab in Gemeinschaft mit Hermann Diels, Benno Erdmann und Eduard Zeller das Archiv für Geschichte der Philosophie (ab 1895 umbenannt in Archiv für Philosophie) heraus. Ebenfalls 1887 erscheint in der Festschrift für Diltheys Berliner Kollegen Eduard Zeller mit der Abhandlung Das Schaffen des Dichters (unter dem Titel Die Einbildungskraft des Dichters in: VI, 103 – 241), sein bedeutendster Beitrag zur Poetik. 1888 publiziert Dilthey seinen wichtigsten pädagogischen Text Über die Möglichkeit einer allgemeingültigen pädagogischen Wissenschaft (VI, 56 – 82). Im Jahr 1889 veröffentlicht er die beiden Aufsätze Archive für Literatur (XV, 1 – 16) und Archive der Literatur in ihrer Bedeutung für das Studium der Geschichte der Philosophie (IV, 555 – 575). Gewissermaßen als Folge seiner Forderung nach Literaturarchiven beschäftigt sich Dilthey mit den Handschriften Kants und konzipiert 1893 den Plan zu einer „monumentalen Kantausgabe“ (B, 170), der Akademie-Ausgabe von Kants Gesammelten Schriften, die Dilthey bis 1902 leitet und in die er einen nicht unerheblichen Teil seiner Arbeitskraft und -zeit investiert.
[26]
Im Sommersemester 1890 hält Dilthey seine (einzige) Ethik-Vorlesung, Ethik, in ihren Prinzipien und einzelnen Ausführungen dargestellt (Nachlassveröffentlichung unter dem Titel System der Ethik in: GS X), die er in einem großen Brief an Yorck detailliert vorstellt (B, 90 – 92) und als „Abschluß meiner systematischen Gedanken“ (B, 90) bezeichnet. Im selben Jahr veröffentlicht er die wichtige erkenntnistheoretische Abhandlung Beiträge zur Lösung der Frage vom Ursprung unseres Glaubens an die Realität der Außenwelt und seinem Recht (V, 90 – 135), die zum Umkreis des systematischen Teils des zweiten Bandes der Einleitung gehört, und 1891 beginnt die Reihe großer geistesgeschichtlicher Arbeiten Diltheys zu erscheinen, die ebenfalls dem Kontext des zweiten Bandes zuzurechnen sind: Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 16. Jahrhundert (1891/1892, in: II, 1 – 89), Das natürliche System der Geisteswissenschaften im 17. Jahrhundert (1892/1893, in: II, 90 – 245), Die Autonomie des Denkens, der konstruktive Rationalismus und der pantheistische Monismus nach ihrem Zusammenhang im 17. Jahrhundert (1893; in: II, 246 – 296), Der entwicklungsgeschichtliche Pantheismus nach seinem geschichtlichen Zusammenhang mit den älteren pantheistischen Systemen (1900; in: II, 312 – 390) und Die Funktion der Anthropologie in der Kultur des 16. und 17. Jahrhunderts (1904; in: II, 416 – 492).
1892 veröffentlicht Dilthey mit dem Aufsatz Die drei Epochen der modernen Ästhetik und ihre heutige Aufgabe (VI, 242 – 287) einen weiteren wichtigen Beitrag zur Ästhetik. Die berühmte programmatische Akademieabhandlung Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie (V, 139 – 237), die dem systematischen Zentrum des zweiten Buchs der Einleitung zugehört, wird von Dilthey 1894 veröffentlicht. Sie erfährt in einem Ende 1895 erscheinenden Aufsatz des – mit Dilthey befreundeten – Psychologen Hermann Ebbinghaus eine vernichtende Kritik, die ihn in eine tiefe persönliche Krise stürzt, die für die geplante Ausarbeitung des zweiten Bandes der Einleitung fatale Folgen hat. Die unter dem Titel Über vergleichende Psychologie (1895) geplante, aber nur verkürzt unter dem Titel Beiträge zum Studium der Individualität publizierte Fortsetzung der Ideen erscheint, ebenfalls als Akademie-Abhandlung, 1896 (Rekonstruktion der „Abhandlung von 1895“ in: V, 241 – 316). Die beabsichtigte umfangreiche Antwort auf Ebbinghaus‘ Kritik will Dilthey trotz wiederholter Anläufe
[27]
nicht gelingen. (Vgl. XXII, 337 – 345) Bis etwa Mitte 1896 arbeitet er an seiner psychologischen Konzeption weiter, bricht dann aber enttäuscht seine systematischen Arbeiten an der Einleitung endgültig ab und wendet sich wieder seiner Schleiermacher-Biographie zu, die er sich schon ab Mai 1896 wieder vorgenommen hatte. (Vgl. B, 214) Vom Dezember 1896 widmet er sich diesem Unternehmen intensiver und beginnt, nachdem er es jahrelang offenbar vernachlässigt hatte, wieder zu schreiben (vgl. B, 229, 234f., 239f.) und plant im Sommer 1897 eine Neuauflage des ersten Bandes der Schleiermacher-Biographie (vgl. B, 242), die aber erst gut ein Jahrzehnt nach seinem Tode zustande kommt.
In der achten Auflage von Friedrich Ueberwegs Grundriß der Geschichte der Philosophie veröffentlich Dilthey 1897 eine aufschlussreiche Übersicht meines Systems (mit Zusätzen aus dem Nachlass, in: VIII, 176 – 184, 265 – 266), die seinen systematisch-philosophischen Anspruch deutlich werden lässt.
Seit 1900 verfolgt Dilthey sein neues Großprojekt der Studien zur Geschichte des deutschen Geistes, die in mehreren Bänden eine Darstellung des deutschen Geisteslebens von der germanischen Frühzeit bis zur Gegenwart bieten und Literatur, Musik, Philosophie und Geschichte umfassen sollen. Dieses, nicht nur in Anbetracht seines fortgerückten Alters, sehr ehrgeizige Projekt geht zurück auf eine konkrete Absprache mit dem Cotta-Verlag über eine Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland in der Neuzeit, die im Rahmen einer geplanten Bibliothek deutscher Geschichte erscheinen sollte. (Vgl. Diltheys Brief an Carl von Cotta vom 29. 12.1880 [BW I, 848 – 850] und den Verlagsvertrag vom 3.1.1881) Dieses Projekt, dem man auch Diltheys zahlreiche literaturgeschichtliche Arbeiten zurechnen kann, wird aber aus unbekannten Gründen nicht weiterfolgt.
Konkreter Anlass für das von der Jahrhundertwende ab verfolgte Projekt der Studien ist offenbar das Jubiläum der Berliner Akademie, an dem sich Dilthey mit dem Rundschau-Artikel Die Berliner Akademie der Wissenschaften, ihre Vergangenheit und ihre gegenwärtigen Aufgaben (1900; umgearbeitet vom Herausgeber in: III) beteiligt und der ihn in weitere wissenschaftsgeschichtliche Forschungen hineinzieht. In diesem Zusammenhang publiziert Dilthey noch zwei Abhandlungen in der Deutschen
[28]
Rundschau über Die deutsche Aufklärung im Staat und in der Akademie Friedrichs des Großen (1901; umgearbeitet vom Herausgeber in III) und Das 18. Jahrhundert und die geschichtliche Welt (mit wenigen Änderungen in: III, 207 – 268). Im Sommer 1901 stellt er die Rundschau-Artikel zu dem Buch Drei Epochen deutschen Geisteslebens. Leibniz – Friedrich der Große und die Aufklärung – Die Begründer der geschichtlichen Weltansicht zusammen, das – schon fertig ausgedruckt – von ihm aber vor der Veröffentlichung wieder zurückgezogen wird, da er, mit dem Inhalt des Werks unzufrieden, das Unternehmen breiter anlegen will. In den nächsten Jahren häuft Dilthey eine riesige Manuskriptmenge zu dieser Thematik an, in die er auch älteres Material integriert, von der nach Diltheys Tod aber nur wenige ausgearbeitete Aufsätze in Band XII der GS und dem Buch Von deutscher Dichtung und Musik (Leipzig und Berlin 1933, herausgegeben von G. Misch und H. Nohl) veröffentlicht werden können.
Neben diesen geistesgeschichtlichen Studien verfolgt Dilthey nach der Jahrhundertwende auch wieder intensiver seine Arbeiten zur Grundlegungsproblematik der Geisteswissenschaften. In diesen Zusammenhang gehört der im Jahr 1900 in der Festschrift für den Tübinger Philosophen Christoph Sigwart veröffentlichte wichtige Aufsatz Die Entstehung der Hermeneutik (V, 317 – 331; Zusätze aus den Handschriften, 332 – 338), dem für seine späte Philosophie der Geisteswissenschaften besondere Bedeutung zukommt. Der Publikation vorausgegangen waren die Akademie-Vorträge Über Hermeneutik. 1. Hälfte (Juni 1896) und Über die Hermeneutik von Baumgarten und Semler (Februar 1897).
Ab Anfang 1904 unternimmt Dilthey Arbeiten für eine geplante zweite Auflage der Einleitung (vgl. I, 410 – 426), die aber nicht realisiert wird, und beschäftigt sich seit Ende des Jahres in einer Reihe von Vorträgen in der Berliner Akademie wieder intensiv mit seinem Lebensthema, den Problemen einer philosophischen Grundlegung der Geisteswissenschaften, die aber nur zum geringen Teil in den Sitzungsberichten der Akademie veröffentlicht werden. Von Dilthey publiziert wird nur 1905 die Erste Studie zur Grundlegung der Geisteswissenschaften: Der psychische Strukturzusammenhang (VII, 3 – 23); die Manuskripte der übrigen Vorträge erscheinen – um Nachlassmaterialen ergänzt – in Band VII der GS.
[29]
Etwa ab Mitte 1902 hatte sich Dilthey auch mit dem frühen Hegel beschäftigt und veröffentlicht 1905 die Ergebnisse dieser Forschungen als Akademie-Abhandlung unter dem Titel Die Jugendgeschichte Hegels (IV, 1 – 187; Zusätze aus dem Nachlass: IV, 189 – 282; weitere Fragmente aus Diltheys Hegel wurden später von H. Nohl in den Hegel-Studien 1 [1961], 103 – 134, veröffentlicht). Im selben Jahr, mit dem Ende des Sommersemesters 1905, wird Dilthey von seinen Lehrverpflichtungen befreit.
Eine Sammlung seiner wichtigsten literahistorischen Arbeiten gibt Dilthey 1906 (erschienen kurz vor Weihnachten 1905) unter dem – berühmt gewordenen – Titel Das Erlebnis und die Dichtung heraus. Diese Sammlung, Diltheys erfolgreichstes Buch, enthält überwiegend ältere Aufsätze zu Lessing, Goethe, Novalis und Hölderlin, die von Dilthey umgearbeitet bzw. ergänzt werden (jetzt in: GS XXVI); schon Ende 1907 kann die 2. und 1910 die 3. Auflage ausgegeben werden.
In dem Band Systematische Philosophie der von Paul Hinneberg herausgegebenen Reihe Die Kultur der Gegenwart veröffentlicht Dilthey 1907 seine große Abhandlung Das Wesen der Philosophie (V, 339 – 416). Von Ende 1909 bis 1911 versucht Dilthey – nun mit Hilfe seines Schülers Eduard Spranger – die Schleiermacher-Biographie wiederaufzunehmen, und 1910 erscheint – wiederum als Akademie-Abhandlung – auf der Basis der seit 1904 vorgetragenen Studien zur Grundlegung der Geisteswissenschaften Diltheys letzte große Schrift, die die Grundlegung zum Thema hat: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften (VII, 77 – 188). Aber auch dieser letzte Versuch, die intendierte philosophische Grundlegung der Geisteswissenschaften doch noch – in allerdings im Hinblick auf Umfang und Konzeption weniger anspruchsvoller Form als die Einleitung – zu vollenden, bleibt Fragment: die geplante Fortsetzung des Aufbaus bleibt ungeschrieben. 1911, im Jahr seines Todes, schließlich publiziert Dilthey in dem von seinem Schüler Max Frischeisen-Köhler herausgegebenen, repräsentativen Band Weltanschauung. Philosophie und Religion die große Abhandlung Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in den metaphysischen Systemen, mit der er seine in der Folge vielfach rezipierte Weltanschauungslehre der Öffentlichkeit vorlegt (VIII, 73 – 118; Zusätze aus dem Nachlass: VIII, 119 – 165). Sein letzter Text, den er nicht mehr abschließen kann, behandelt Das Problem der Religion (VI, 288 – 305).
[30]
Neben den von Dilthey selbst veröffentlichten Büchern, Abhandlungen, Aufsätzen und Rezensionen hat er noch eine große Zahl von – z. T. unvollendeten – Manuskripten sowie viele Fragmente, Skizzen, Dispositionen etc. verfasst, die zu einem großen Teil, aber längst nicht vollständig – zusammen mit ausgewählten Vorlesungsnachschriften – in den Bänden seiner GS veröffentlicht wurden. Nicht realisiert blieben u. a. ein Buch über Spinozas Theorie der Affekte (1871; vgl. BW I, 598f., 608, 619), ein großes Buch über die philosophisch-wissenschaftliche Entwicklung in Europa, das von ihm so genannte „zweite Buch“, an dem er etwa seit Mitte 1869 gearbeitet hat (vgl. BW I, 510, 518, 544, 634, 647, 722), sodann eine Aufsatzsammlung Dichter als Seher der Menschheit (Frühjahr 1895; rekonstruiert in GS XXV), ein Buch über Poetik und die Studien zur Geschichte des deutschen Geistes.
Dilthey starb am 1. Oktober 1911 während eines Urlaubs im „Haus Salegg“ in Seis am Schlern (Südtirol) an den Folgen einer Ruhr-Erkrankung; seine Beisetzung auf dem alten Friedhof in Biebrich fand am 7. Oktober 1911 statt.
[31]