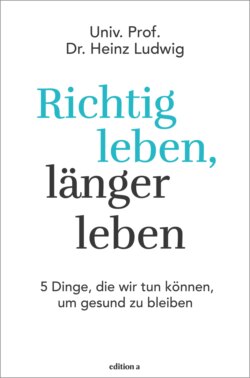Читать книгу Richtig leben, länger leben - Heinz Ludwig - Страница 6
DER FALL ROBERT THUCH
ОглавлениеAls ich Robert Thuch zum ersten Mal sah, war er braun gebrannt und elegant gekleidet. Erst auf den zweiten Blick bemerkte ich, dass er seine noch dichten Haare färbte. Thuch war 18 Jahre davor, mit 49, in die USA ausgewandert und hatte sich in Florida beruflich mit Immobilien beschäftigt, nachdem er dort schon zuvor von Wien aus Geschäfte gemacht hatte. Er schien dabei recht geschickt gewesen zu sein, machte auf mich allerdings den Eindruck, dass er immer eher in einen aufwendigen Lebenswandel als in die Altersvorsorge investiert hatte.
Thuch hatte ein gutes Leben geführt, so viel war sicher, ein beneidenswert freies und an vielen Tagen aufregendes, mit Freunden, die es machten wie er. So erzählte er es mir. Unversehens waren die Jahre vergangen, war seine Jugend vergangen, war der größte Teil seines Lebens vergangen. Wie das eben so ist. Jetzt hatte er ein Dickdarm-Karzinom mit Metastasen in der Leber.
Robert Thuch bereute nichts. Er hatte sein Leben so geführt, wie er es führen wollte, unabhängig, im Bewusstsein dessen, was er tat, und auch, worauf er verzichtete. Er war immer bereit gewesen, seine Entscheidungen klar, nüchtern und ohne Illusionen zu treffen. Das hatte er auch getan, nachdem ihn amerikanische Ärzte über seine Erkrankung informiert hatten. Er war aus den USA zurück in seine alte Heimat Wien gekommen, was viele Patienten, die diese Möglichkeit haben, in seiner Situation tun.
Dies aus pragmatischen Überlegungen. Thuchs amerikanische Krankenversicherung kostete rund 10.000 Dollar im Jahr. Zusätzlich musste er bei allen Behandlungen einen Selbstbehalt von zwanzig Prozent bezahlen. Die für eine Chemo-Immuntherapie nötigen Medikamente kosten etwa 100.000 Dollar im Jahr, womit er alleine damit auf 30.000 Dollar kam, die Kosten für den Aufenthalt im Krankenhaus, die notwendigen Untersuchungen und die Durchführung der Behandlungen noch gar nicht mitgerechnet. Für einen Selbständigen ohne große Rücklagen ist das eine unbehagliche Situation. Ich verstand jedenfalls Thuchs Entscheidung, vor dem amerikanischen Gesundheitssystem nach Wien zu flüchten, wo er nach wie vor sozialversichert war und sich wenigstens des Geldes wegen keine Sorgen machen musste.
Ich vermutete, dass ihn die amerikanischen Ärzte auf ihre nüchterne Art bereits über seine Überlebenschancen und seine Lebenserwartung informiert hatten. Beides war zwischen uns jedenfalls kein Thema und wir begannen umgehend mit der Behandlung. Dazu gehörte eine Chemo-Immuntherapie, die er in dreiwöchigen Intervallen erhielt, damit er zwischenzeitlich in die USA fliegen konnte. Doch die Behandlungen verloren relativ rasch ihre Wirksamkeit. Irgendwann entschied er sich, in Wien zu bleiben, da ihn langsam die Kräfte verließen und er eine Metastase in der Wirbelsäule entwickelt hatte, die nach anfänglich erfolgreicher Strahlenbehandlung wieder zu wachsen und zu schmerzen begann. Wir legten einen Katheter ins Rückenmark, um eine kontinuierliche Opioid-Therapie einzuleiten.
Nach einigen Wochen bat er mich um ein Wort unter vier Augen. »Ganz ehrlich«, sagte er. »Ich würde es gerne beenden.« Für ihn sei jeder weitere Tag nur eine weitere Belastung und es fehle ihm die Perspektive.
Thuch hatte sonst niemanden, mit dem er über diese Dinge sprechen und seine Ängste und Sorgen teilen konnte. Seine amerikanischen Freunde, so sie denn eng genug gewesen wären, kamen nicht zu ihm nach Europa, und wenn sie doch gekommen wären, hätten sie ihm nicht auf Dauer als treue Begleiter zur Seite stehen können. Ab und zu besuchten ihn alte österreichische Freunde, doch sein Kontakt zu ihnen war, soweit ich das mitbekam, abgekühlt.
Ich sagte ihm, das Stationsteam würde ihn aufgrund seiner charmanten Persönlichkeit besonders schätzen, und dass wir uns entsprechend unserem Credo wie bei allen anderen Patienten um das bestmögliche Ergebnis für ihn bemühen würden. Beides stimmte natürlich, doch als Motivation zum Weiterkämpfen war das dünn, das war auch mir klar. Er ließ es dabei bewenden, wohl eher aus Rücksicht auf mich als aus neuem Lebensmut.
Wenige Wochen später sprach er mich noch einmal darauf an. »Die Situation ist für mich extrem belastend, aber ich habe mich damit abgefunden«, sagte er, »ich will die Dinge bloß realistisch betrachten, das habe ich im Leben immer getan.« Trotz all der Schmerzmedikamente habe er dauernd Schmerzen. Außerdem leide er unter den Nebenwirkungen der Schmerztherapie, habe einen trockenen Mund, seine Verdauung funktioniere nur mehr mit einem starken Abführmittel, zudem habe er den Eindruck, dass die Morphintherapie sein Denkvermögen beeinträchtige. »Ich bin nicht mehr der, der ich war. Ich bin allein. Vor mir liegt nichts mehr, auf das ich mich freuen könnte, weder auf einen Besuch morgen, noch auf etwas in fernerer Zukunft, weil ich, so wie sich die Dinge entwickeln, keine fernere Zukunft mehr habe. Weiter zu leben macht für mich objektiv betrachtet keinen Sinn mehr, im Gegenteil. Es ist für mich zu einer schweren Bürde geworden.«
Es wäre Unfug gewesen, ihm neuerlich gut zuzureden. Meine einzige Hoffnung war, ihm mögen trotz aller Beschwerden noch Stunden bleiben, die für ihn wertvoll waren. Das sagte ich ihm. Allerdings war das nicht überzeugend genug, um seine Einstellung noch zu ändern. Doch ich hätte Robert Thuchs Wunsch nach einem vorzeitigen Ende nicht erfüllen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Die Gesetzgebung verhindert es.
Was das betrifft, leben wir in einer paradoxen Welt. Wir töten Ungeborene, die keine Möglichkeit haben, darüber mitzuentscheiden, und wir zwingen Menschen ohne Chance auf Besserung und ohne jede andere Perspektive, die bei klarem Verstand eine rationale Entscheidung für einen Abgang in Würde treffen wollen, weiter zu leiden.
Das Euthanasieverbot haben in Österreich wahrscheinlich Menschen, die nie die Verzweiflung und Aussichtslosigkeit solcher Patienten gesehen haben, als Gesetz festgeschrieben. In den Niederlanden und der Schweiz gehen die Menschen ehrlicher mit diesem Thema um. Sie lügen sich nicht selbst an. Sie erkennen an, dass es Leid gibt, das sich nicht lindern lässt, und Lebenssituationen, in denen es keine Zukunft gibt.
Alles, was wir für Robert Thuch tun konnten, war die sogenannte palliative Sedierung. Das führte dazu, dass er in seinen letzten Tagen keine Schmerzen mehr ertragen musste.
Zuvor regelte er noch seinen Nachlass. Ein Notar besuchte ihn am Krankenbett. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, dass er das Geld, das ihm geblieben war, einer karitativen Organisation hinterließ. Seinen Leichnam vermachte er der medizinischen Universität, damit Studenten daran für ihre Zukunft lernen konnten. Zuvor hatte er sich darüber informiert, dass alles, was danach noch von ihm bleiben würde, in ein von der Stadt Wien zu diesem Zweck gestiftetes Grab kommen würde.
Ich bewunderte ihn dafür, mit welcher Nüchternheit er dabei vorging. Das sagte ich ihm bei unserem letzten Gespräch.
Wir redeten auch über den Tod. Ich erzählte ihm von den zahlreichen gleichlautenden Berichten von Personen, die ein Nahtoderlebnis hatten. Dabei handelt es sich um Menschen, die zum Beispiel nach einem Kreislaufstillstand wiederbelebt werden konnten. Während die Betroffenen reanimiert werden, löst sich ihr Ich aus dem Körper und schwebt zum Beispiel über dem Herzalarmteam, das sich um den Körper kümmert. Die Personen erinnern sich an viele Details der Rettungsversuche und berichten fast unisono von einem nie zuvor erlebten Hochgefühl. Zwar kann kein Mensch beweisen, dass dies auch beim tatsächlichen Tod der Fall ist. Aber diese Personen haben den Eindruck, von einem strahlenden Licht durch einen Tunnel in eine Welt des Heils und der Glückseligkeit gezogen zu werden. »Sollte dies der Realität entsprechen«, sagte ich, »dann sollten wir keinen weiteren Tag auf dieser Erde verschwenden, sondern dem gleißenden Licht ins Glück folgen.«
»Das klingt zwar phantastisch. Allein mir fehlt der Glaube«, antwortete er. »Es ist okay für mich, zu gehen. Hilfreich wäre allerdings, wenn es ein paar mehr Menschen gäbe, von denen ich mich jetzt verabschieden könnte. Aber dann wäre das hier vielleicht ohnedies alles anders gelaufen.«