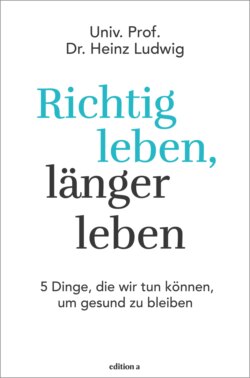Читать книгу Richtig leben, länger leben - Heinz Ludwig - Страница 7
EIN PLAN FÜR DAS LEBEN
ОглавлениеWenn mich Menschen als Onkologen, Krebsforscher und Hämatologen fragen, was sie tun können, um erst gar nicht krank zu werden, um gesund zu bleiben, fallen mir manchmal Maria Alwara und Robert Thuch ein. Ich weiß nicht, ob Maria Alwara ihre Erlebensziele auch ohne die Liebe und die Fürsorge für ihre Tochter erreicht hätte. Ob die Sache mit dem Krebs für Robert Thuch tatsächlich anders gelaufen wäre, hätte es in seinem Leben Freunde und Familienmitglieder gegeben, die zu ihm gestanden wären, ihn unterstützt und liebevoll umsorgt hätten, von denen er sich am Ende verabschieden hätte können, kann ich ebenfalls nicht mit Sicherheit behaupten. Dennoch stehen diese beiden Schicksale für eines der fünf Dinge, die ich allen nenne, die den Fortbestand ihrer Gesundheit selbst in die Hand nehmen und nach Kräften dazu beitragen wollen. Alwara und Thuch sind Beispiele für die Bedeutung unserer Integration in ein soziales Netzwerk, für den Wert enger menschlicher Beziehungen, für die Tragweite des Liebens ebenso wie des Wahrgenommen- und Geliebtwerdens. Unsere diesbezüglichen Erfahrungen können sich nicht nur heilsam auf unseren Geist und unsere Seele auswirken, sondern auch enormen Einfluss auf unseren Körper nehmen.
Gewöhnlich konsultieren mich Patienten erst dann, wenn sie erkrankt sind, und nicht zu einem Zeitpunkt, zu dem sie gesund sind und sie die Frage beschäftigen sollte, wie sie es bleiben können. Es liegt in der menschlichen Natur, dass wir uns wenig Gedanken über unsere Gesundheit machen, solange wir gesund sind. Die Gedanken an Krankheit schieben wir zur Seite und gehen erst zum Arzt, wenn wir Beschwerden haben. Was negative Konsequenzen haben kann, denn mit der richtigen Prävention ließen sich viele Erkrankungen verhindern, die, einmal ausgebrochen, schwer wieder rückgängig zu machen sind.
Dank der Thematisierung der Möglichkeiten der Vorsorgemedizin in Schulen, Medien, durch die nationalen Gesundheitsbehörden und die Ärzteschaft stellen sich immer mehr Menschen die Frage, wie sie gesund bleiben können. Das Verantwortungsbewusstsein für die eigene Gesundheit steigt langsam, aber doch. Dies ist erfreulich, hat allerdings einen problematischen Aspekt. Es steigt auch die Zahl der sich zum Teil widersprechenden und wissenschaftlich nicht abgesicherten Informationen, die vor allem von den Medien und via Internet in Umlauf gebracht und von der Bevölkerung bereitwillig aufgenommen werden. Wahrscheinlich wird das auch in absehbarer Zukunft so sein. Medien können entweder bewusst oder unbewusst Falsches propagieren, um ihre Auflagen, Zugriffszahlen und Einschaltquoten zu erhöhen. Aber wo steht geschrieben, dass dies so bleiben muss. Die Einforderung eines größeren Verantwortungsbewusstseins und die Verpflichtung zur sorgfältigen Recherche samt entsprechenden Konsequenzen bei Verfehlungen scheint mir kein überzogener Wunsch zu sein.
Gerade an mich als Onkologen wenden sich Menschen auch deshalb, weil sie aus den Angst machenden und oft kontroversen Informationen über Krebs eine steigende Bedrohung heraushören, daran zu erkranken.
Was so nicht stimmt. Das Risiko, an Krebs zu erkranken, ist innerhalb der einzelnen Altersgruppen relativ konstant geblieben. Allerdings steigt die Gesamtzahl an Krebserkrankungen wegen der steigenden Lebenserwartung, da Krebs eine Erkrankung des höheren Lebensalters ist und die Bevölkerung in unserer Gesellschaft insgesamt älter wird1.
Manche Krebserkrankungen, wie Magenkrebs, werden in letzter Zeit viel seltener, während andere, wie Lungenkrebs, häufiger auftreten. Vermutlich hat die Abnahme der Häufigkeit von Magenkrebs mit der verbesserten Qualität der Lebensmittel zu tun. In der Nachkriegszeit war der Luxus, den sich unsere Wegwerfgesellschaft heute leistet, noch kaum denkbar. Viele Menschen aßen damals auch angeschimmeltes oder andersartig verdorbenes Brot, wenn es sein musste. Es war eben sonst nichts da. Auch andere Lebensmittel aßen sie verdorben, schon weil es noch keine Kühlschränke gab. Der Eismann brachte das Eis zum Kühlen in Blöcken und es gab noch längst kein Ablaufdatum auf den Verpackungen. Zum Glück hat sich seit damals viel verändert. Denn der Verzehr von schimmelnden und verdorbenen Lebensmitteln erhöht das Risiko, an Magenkrebs zu erkranken, enorm. Ebenso wie der damals übliche häufige Konsum gepökelten Fleisches.
Lungenkrebs dagegen ist häufiger geworden. Was daran liegt, dass Rauchen bei Frauen erst seit wenigen Jahrzehnten sozial ebenso akzeptiert ist wie bei Männern. Ich verstehe es, wenn zum Beispiel Menschen, die beträchtlichem Stress ausgesetzt sind, sich durch Rauchen Entlastung verschaffen. Denn neben den unzähligen negativen Effekten des Rauchens auf den Körper hat es auch positive. Es reduziert Stressempfinden, verstärkt die Herz-Kreislauf-Aktivität, macht munterer, hebt die Stimmung und fördert die Kommunikation. Wir müssten etwas erfinden, das dieselben positiven Effekte wie das Rauchen hat, ohne den Körper zu schädigen, denn der Zusammenhang zwischen Rauchen und erhöhtem Risiko für Lungenkrebs, aber auch für andere Krebsarten, ist durch die Krebsforschung der vergangenen Jahrzehnte ohne jeden Zweifel bewiesen.
Dennoch sterben viel weniger Menschen an Krebs als an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was auf das besonders häufige Auftreten von hohem Blutdruck, hohen Blutfetten und Übergewicht zurückzuführen ist. Ein weiterer Grund liegt in den Fortschritten in der Krebsbehandlung. Bei mehreren Krebsformen ist es gelungen, Krebs zu heilen oder von einer tödlichen in eine chronische Erkrankung umzuwandeln. Für die Zukunft sind weitere rasante Fortschritte zu erwarten, zu denen die Korrektur von Defekten in der Steuerzentrale von Krebszellen sowie Immuntherapie und Zelltherapie beitragen werden. Rasante Fortschritte wird auch die neue Qualität der Datenverarbeitung bringen, die unter dem Begriff Big-Data-Mining zusammengefasst werden kann.
Die Frage, was jeder Einzelne von uns tun kann, um sich gesund zu halten, bleibt trotzdem von überragender Bedeutung. Zwar gibt es bei allen Erkrankungen Faktoren, auf die wir keinen oder nur wenig Einfluss haben, wie etwa unsere genetische Ausstattung oder Umwelteinflüsse, auf die ich später noch eingehen werde. Doch es gibt auch Faktoren, die wir beeinflussen können. Wir haben einen Handlungsspielraum und wir tun gut daran, ihn zu nutzen. Es bedrückt mich manchmal, wie Menschen mangels besseren Wissens oder trotz besserem Wissen leichtfertig darauf verzichten.
Über diesen Spielraum nachzudenken, fing ich wegen der häufig von Patienten gestellten Frage an, was sie zusätzlich zum vorgeschlagenen Behandlungskonzept tun können. Dabei wurde mir klar, dass es tatsächlich verschiedene Dinge gibt, die sie tun können, um die medizinische Therapie zu unterstützen und damit ihre Prognose und ihre Lebensqualität zu verbessern. Damals fing ich an, mich für die wissenschaftlichen Grundlagen der verschiedenen im Raum stehenden Aktivitäten zu interessieren.
Ganz oben auf die Liste der sinnvollen Dinge schrieb ich schon damals das Wort »Lieben«. Inspiriert von Fällen wie jenen von Maria Alwara und Robert Thuch meine ich damit nicht nur die Liebe zwischen zwei Menschen, sondern den gesamten Bereich unserer zwischenmenschlichen Beziehungen und unserer sozialen Integration sowie unsere Liebe und Hingabe zu einer Aufgabe, einer beruflichen Tätigkeit oder einem Hobby.
Im Laufe der Zeit ist meine Liste der sinnvollen Aktivitäten gewachsen, ohne jedoch auszuufern. Denn im Grunde lässt sie sich auf fünf Elemente reduzieren, die ich sowohl meinen Patienten besonders ans Herz lege, jedoch auch gesunden Menschen als Lebensmaxime empfehle. Die Dinge, die Patienten tun können, um gesund zu werden oder zumindest ihre Prognose zu verbessern, sind die gleichen, die Gesunde tun können, um gesund zu bleiben.
Diese insgesamt fünf Dinge lassen sich aus vielen teils umfangreichen wissenschaftlichen Studien ableiten, die Ärzte auf der ganzen Welt durchgeführt haben. Deren Ergebnisse decken sich auch mit meinen Beobachtungen und Erkenntnissen. In diesen fünf Dingen spiegeln sich also sowohl der aktuelle Stand der Wissenschaft als auch meine persönlichen Erfahrungen bei der Behandlung von Patienten wider, aus denen ich seit Langem konsequent und kontinuierlich meine Schlüsse ziehe.
Ich habe mir schon immer die Frage gestellt, was uns zu dem macht, was wir sind. Wie groß ist die Bedeutung unseres genetischen Gerüstes, unserer Lebenserfahrungen und unseres Umfeldes?
Als ich studierte, galt die Immunologie als zukunftsträchtiges ärztliches Forschungsgebiet, heute vergleichbar mit der Molekularbiologie oder der modernen Genetik. Damals wollte ich mehr über die biologischen und biochemischen Grundlagen unserer körpereigenen Abwehr von Krankheitserregern wie Bakterien, Viren und Pilzen wissen. Ebenso galt mein besonderes Interesse den sogenannten Autoimmunerkrankungen, bei denen sich unser körpereigenes Abwehrsystem gegen Komponenten unseres Organismus´ wendet. Wie funktioniert dieses System, dessen zentrale Aufgabe es ist, uns gesund zu halten, was stärkt es und was schwächt es?
Damals waren diese Grundlagen noch ein weites und kaum erforschtes Feld. Das kam meinen Ambitionen und meiner Neugier entgegen. Daher bewarb ich mich um eine Ausbildungsstelle am Wiener Institut für Immunologie, das Carl Steffen, ein brillanter Mediziner und Wissenschaftler, erst kurz zuvor als erstes deutschsprachiges Institut dieser Art gegründet hatte.
Ich wurde aufgenommen. Nach Einarbeitung in die wissenschaftliche Methodik konnte ich sehr bald eigene Projekte bearbeiten. Drei Jahre später wollte ich meine klinische Ausbildung im Fach der inneren Medizin beginnen. Damals gab es zwei Universitätskliniken für innere Medizin, die miteinander konkurrierten, was durchaus sinnvoll sein kann, weil Wettbewerb stimulierend wirkt.
Zu dieser Zeit stellte sich die Frage, ob der Typ I Diabetes, also jene Form, die von Anfang an insulinabhängig ist, die Folge einer Virus-Infektion mit nachfolgender Autoimmunreaktion ist. Nachdem ich am Institut für Immunologie verschiedene, damals moderne Forschungstechniken erlernt hatte, war ich für beide Kliniken interessant, weshalb ich mir als damals erst 27-Jähriger aussuchen konnte, auf welche der beiden Kliniken ich gehen wollte.
Eine der beiden Kliniken befand sich im sogenannten neuen Teil des Wiener Allgemeinen Krankenhauses, dessen alter Teil unter Maria Theresias Sohn, Kaiser Josef II, erbaut worden war. »Wie viel Zeit brauchen Sie?«, fragte mich die Sekretärin von dessen Leiter Prof. Erwin Deutsch vor meinem Bewerbungsgespräch. »Fünf Minuten oder zehn?«
Was mich ziemlich irritierte. Bei dem Gespräch selbst gewann ich den Eindruck, dass die gesamte Klinik sehr effizient und professionell arbeitete. Das beeindruckte mich. Doch um einen Vergleich zu haben, bewarb ich mich auch in der zweiten medizinischen Klinik, die Prof. Karl Fellinger leitete. Der dortige Personalverantwortliche Prof. Rudolf Höfer empfing mich mit freundlichen Worten.
Er erklärte mir sein Forschungsgebiet und kurz auch die Organisation der Klinik. Letztendlich widmete er mir eine halbe Stunde seiner Zeit.
Beide Kliniken waren vielversprechend. Meine Wahl traf ich bemerkenswerterweise nicht aufgrund der wissenschaftlichen Aktivitäten und klinischen Leistungen der jeweiligen Klinik, die ich gar nicht im Detail in Erfahrung brachte. Vielmehr, und ohne dieses Thema in jenen Tagen bis zu Ende durchgedacht zu haben, erschien mir das Zwischenmenschliche, um das es in diesem Buch noch ausführlich gehen wird, schon damals von großer Bedeutung zu sein. Deutsch mag der bessere Wissenschaftler gewesen sein, doch das Gespräch mit Höfer, das ich als freundlich, interessiert und angenehm empfunden habe, veranlasste mich, meine klinische Ausbildung an der Klinik Fellinger zu beginnen.
Das war der eigentliche Anfang meiner klinischen Laufbahn, in deren weiterer Folge ich mich auf die Onkologie und Hämatologie sowie Krebsforschung spezialisierte. Seitdem habe ich viele Patienten wie Maria Alwara und Robert Thuch mit Krebs und anderen schweren Erkrankungen begleiten, behandeln und unterstützen können. Ich habe erfahren, wie unterschiedlich Patienten mit der Diagnose Krebs und den damit verbundenen Belastungen umgehen, wie sie um die Wiedererlangung ihrer Gesundheit kämpfen und wie sie daraus geheilt hervorgehen, mit der Erkrankung als chronischer Begleiterin leben, oder den Kampf verlieren und an ihrer Krankheit versterben.
Auf meiner Empfehlungsliste für Patienten standen anfangs vier Dinge, bei denen ich dafür sorgte, dass sie der besseren Merkbarkeit wegen alle wie »Lieben« mit einem »L« anfingen. Dass sie alle auch noch genau gleich viele Buchstaben hatten, war indes Zufall.
Lieben
Lachen
Lernen
Laufen
Die Liste kam schon aufgrund ihres Sprachrhythmus gut an, verkürzte aber die dahinter stehenden Empfehlungen deutlich. Mit »Lieben« meine ich wie gesagt das gesamte Thema der sozialen Integration und die Leidenschaft für eine Aufgabe. Mit »Lachen« meine ich das Feld des Humors, der positiven Lebenseinstellung und der Zufriedenheit. Mit »Lernen« meine ich das bewusste Benutzen und Trainieren unserer kognitiven Fähigkeiten. Und mit »Laufen« körperliche Aktivität insgesamt.
Schließlich kam zu meinen vier L-Begriffen noch ein fünfter hinzu, von dem ich lange angenommen hatte, dass er ohnedies bereits ausreichend in den Köpfen der meisten Menschen verankert ist. Bis ich feststellte, dass es dabei besonders viele Missverständnisse gibt. Es geht um unsere Ernährungsgewohnheiten, und ich musste mich diesmal schon ein wenig anstrengen, um auch diesen Punkt in einen L-Begriff zu kleiden. Er heißt jetzt
Leichter essen.
Lieben, lachen, lernen, laufen und leichter essen also. Das sind die fünf Dinge, die wir tun können, um gesund zu bleiben. Sie sind fundamental menschlich, sie durchdringen unser gesamtes Leben und betreffen sowohl unsere körperliche als auch unsere geistige Gesundheit, wie ich in den folgenden Kapiteln zeigen werde.
Ich schreibe diese Kapitel dabei nicht etwa in der Absicht, einen Ratgeber zu schaffen, der jedem, der ihm blind folgt, ein gesundes Leben garantiert. Das geht schon deshalb nicht, weil unser Handlungsspielraum beim Versuch, gesund zu bleiben, wie gesagt begrenzt ist. Außerdem glaube ich, dass der Erfolg solcher Ratgeber ganz wesentlich von ihren Lesern abhängt, von deren Fähigkeit, die jeweiligen Empfehlungen tatsächlich in ihr tägliches Leben zu integrieren.
Ich habe mir selbst einmal einen solchen Ratgeber gekauft. »Don’t say yes, if you want to say no« hieß er. (Sag nicht Ja, wenn du Nein sagen willst). Er war für Menschen wie mich gedacht, die Probleme damit haben, anderen einen Gefallen abzuschlagen. Zum Beispiel fällt es mir sehr schwer, eine Einladung zu einem Vortrag, die ich einmal angenommen habe, wieder abzusagen, selbst wenn etwas Wichtiges dazwischen gekommen ist.
Ich musste mit der Zeit lernen, meinen Eigennutz in Entscheidungen miteinzubeziehen, anstatt nur die Wünsche anderer zu erfüllen. Ich weiß nicht so recht, ob mir das inzwischen wirklich gelingt, und wenn ja, welche Rolle dieser Ratgeber dabei gespielt hat. Ich würde sagen, dass er mir immerhin die Probleme und entsprechende Lösungsmöglichkeiten bewusster gemacht hat.
Sollte es mir mit diesem Buch ebenso gelingen, die Probleme und Lösungsmöglichkeiten in Sachen Gesundheit bewusster zu machen, bin ich für den Anfang schon zufrieden. Denn im Grunde stellen die fünf Dinge, die wir tun können, um gesund zu bleiben, einen Plan für ein erfülltes Leben dar. Einen Plan, den wir zum Teil vielleicht schon im Hinterkopf haben, und von dessen Umsetzung uns allzu oft unsere Gewohnheiten, unser gedankenloses Mitschwimmen mit dem Mainstream gesellschaftlicher Entwicklungen oder schlicht die uns inhärente Trägheit abhalten. Ein Plan aber auch, dem nur ein kleines Stückchen zu folgen, jedem von uns nur gut tun kann.