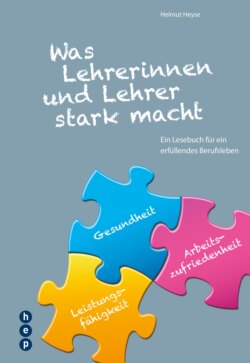Читать книгу Was Lehrerinnen und Lehrer stark macht (E-Book) - Helmut Heyse - Страница 10
1.3 Die Säulen der Lehrergesundheit
ОглавлениеPsychische Gesundheit im Lehrerberuf ist von einer Reihe von Bedingungen abhängig. Sie ruht gleichsam auf vier Säulen:
Abb. 2: Die Säulen der Lehrergesundheit
Individuelle Verpflichtung
An erster Stelle steht die eigene Verantwortung, die physische und psychische Gesundheit nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen, sie nach Möglichkeit zu erhalten oder gar zu verbessern. Krankheit ist ja nicht nur ein individuelles Handicap, sondern wirkt sich auf das materielle und soziale Umfeld aus und stellt auch für Mitmenschen eine Herausforderung dar. Im beruflichen Bereich sind Arbeitnehmer sogar gesetzlich zu dieser Eigenverantwortung verpflichtet:
»[1] Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen« (Arbeitsschutzgesetz von 1996, § 15).
Damit geht einher, die berufliche und persönliche Weiterentwicklung wichtig zu nehmen. Das gilt auch für personale Kompetenzen (→ Teil 2), z. B. einen konstruktiven Umgang mit Stress und Belastungen, emotionale Stabilität, Kommunikation. Der ständige Wandel von Aufgaben, interaktionalen Anforderungen und Belastungen lässt sich nur bestmöglich meistern, wenn man bemüht ist, beruflich auf dem Laufenden zu bleiben.
Verhaltensmanagement
Die Bemühungen der einzelnen Person, durch ihr Tun oder Unterlassen ihre Leistungsfähigkeit und damit ihre Gesundheit günstig zu beeinflussen, werden gemeinhin als gesundheitsförderliches Verhaltensmanagement oder Verhaltensprävention bezeichnet.
Verhältnismanagement
Jeder ist auch in soziale, materielle, organisatorische Bedingungen im engeren und weiteren Lebensumfeld eingebettet. Diese beruflichen und privaten Umfelder mit ihren Forderungen und Erwartungen gesundheitsverträglich zu gestalten, ist Aufgabe und Ziel der Verhältnisprävention bzw. eines gesundheitsförderlichen Verhältnismanagements. Dies bedeutet für die Schule, in dreifacher Weise Gesundheitsverantwortung wahrzunehmen: als Kollegium, als Schulleitung und in schulaufsichtlicher sowie bildungspolitischer Hinsicht.
Kollegiale Herausforderung
Die Chancen und Risiken individueller Gesunderhaltung hängen auch ab von den Interaktionen auf der Kollegiums- und Mitarbeiterebene sowie mit Vorgesetzten und »Kunden« (Eltern, Schülerinnen und Schüler, Betriebe usw.). Denn das Verhalten eines Einzelnen stellt ein Element der individuellen Umfeldbedingungen (Verhältnisse) eines jeweils anderen dar.
Dies gilt in besonderem Maß in Arbeitsfeldern wie Schule, die durch eine hohe Dichte an Interaktionen gekennzeichnet sind. Ob diese unterstützend und förderlich oder verletzend, beeinträchtigend, psychisch belastend erlebt werden, hat gravierende Auswirkungen auf Wohlbefinden, Belastbarkeit, Leistungsbereitschaft und Arbeitszufriedenheit des Einzelnen.
Das schon erwähnte Arbeitsschutzgesetz bestimmt in § 15 (2) zusätzlich, dass »die Beschäftigten auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen [haben], die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind«.
Führungsverantwortung
Neben dem Kollegium nimmt die Schulleitung eine Schlüsselrolle für die Gesunderhaltung der Lehrkräfte und des nichtpädagogischen Personals ein. Ihr obliegt die Sorge für Arbeitsbedingungen, die zumindest nicht gesundheitsschädlich sind. Dies ist das Anliegen der betrieblichen Gesundheitsförderung.
Auch hier macht das Arbeitsschutzgesetz (§ 4) eine Vorgabe. Es verpflichtet Arbeitgeber dazu, »[die] Arbeit […] so zu gestalten, daß eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird«.
In einigen Bundesländern werden in diesem Sinn Gefährdungsanalysen in Schulen durchgeführt; allerdings sind die Spielräume sehr begrenzt, bei erkannten nicht technischen Gefährdungen, z. B. auf der Ebene von Interaktionen, Abhilfe zu schaffen.
Es sollte ohnehin im Interesse des Arbeitgebers liegen, sein Personal so pfleglich zu behandeln, dass es weder durch betriebsbedingte Krankheit und Dienstunfähigkeit hohe Kosten verursacht noch durch innere Kündigung (→ Kapitel 2.4) als Aktivposten ausfällt. Deswegen unterstützen Betriebe zunehmend das individuelle Verhaltensmanagement zusätzlich durch betriebsinterne Angebote, z. B. Wellnessangebote, Sozialarbeiter, Betriebspsychologen, oder finanzielle Beihilfen für private Initiativen, z. B. Yogagruppen, Supervision u. Ä.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) überträgt in ihrer »Empfehlung zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule« (2012) den Schulleitungen bei »der Umsetzung des Gesundheitsmanagements und der Gesundheitsförderung im Rahmen der schulischen Personal- und Organisationsentwicklung eine zentrale Funktion und Verantwortung«.
Sie stellt fest, dass Gesundheitsförderung und Prävention integrale Bestandteile von Schulentwicklung sind und »zum Kern eines jeden Schulentwicklungsprozesses« (ebenda) gehören: »Im Hinblick auf die Gesundheit der Lehrkräfte und des sonstigen schulischen Personals kommt der Umsetzung der Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes eine besondere Bedeutung zu« (ebenda).
Schulinterne Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind demnach nicht luxuriöse Zusatzleistungen, die am Ende des Schuljahres, »wenn noch Zeit ist«, knapp abgehandelt werden können, z. B. als sogenannter Gesundheitstag des Kollegiums. Dauerhafte Gesundheitsbeiträge an einer Schule sind neben einem wertschätzenden sozial-emotionalen Klima z. B. die Transparenz von Regelungen und die Partizipation an Entscheidungen sowie ein funktionierendes Beschwerdemanagement (→ Kapitel 9.2) im Sinn einer permanenten Evaluation der innerschulischen Abläufe.
Sicher kann eine Schulleitung nicht schulaufsichtliche oder bildungspolitische Rahmenbedingungen für die Arbeit in der Schule ignorieren oder außer Kraft setzen. Aber ein Kollegium kann zusammen mit der Schulleitung per Gesamtkonferenz die Grundlinien der unterrichtlichen und pädagogischen Arbeit an der Schule maßgeblich gestalten; die Schulgesetze geben dafür hinreichend Spielraum. Bei näherem Hinsehen erweisen sich nicht selten gut gemeinte Schulprogramme als freiwillige Selbstüberforderung. Und für die Art und Weise ihres Umganges miteinander sind Schulleitung und Kollegium selbst verantwortlich.
Politische Verantwortung
Die Schulleitung als örtliche Vertretung des staatlichen Dienstherrn muss dafür sorgen, dass die gesetzlichen Regelungen und die Verwaltungsanordnungen im Schulalltag umgesetzt werden. Dabei besteht durchaus ein gewisser Spielraum. Schulaufsicht und Bildungspolitik sind ihrerseits aber dafür verantwortlich, dass diese Rahmenbedingungen den Ansprüchen des Arbeitsschutzgesetzes genügen und sich an die Vereinbarungen der KMK halten. Klassenmesszahlen, Unterrichtsverpflichtungen, Lehrpläne, politische und gesellschaftliche Erwartungen an Schule und Lehrerschaft, besondere Bestimmungen für die Schularten wirken sich bis in das familiäre Leben der Lehrerinnen und Lehrer aus.
Im Rahmen des Projektes Lehrergesundheit Rheinland-Pfalz (www.add.rlp.de → Links) wurden die »Landauer Empfehlungen zur Lehrergesundheit – Lehrergesundheit fördert Qualität von Schule« formuliert (Heyse 2014b). Sie appellieren an die Verantwortlichen in der Bildungspolitik und im Bildungswesen, der Lehrergesundheit einen hohen Stellenwert einzuräumen und dies in politisches und administratives Handeln umzusetzen.
Seitens der Bildungspolitik und der Schulaufsicht werden Lehrerinnen und Lehrern ständig neue Aufgaben auferlegt und Reformen angeordnet. Bedauerlicherweise ist dabei zu beobachten, dass den Schulen die dafür erforderlichen Ressourcen oftmals nicht ausreichend zur Verfügung gestellt oder die Lehrkräfte auf diese neuen Aufgaben fachlich nicht hinreichend vorbereitet werden (z. B. Inklusion). Damit sind Gesundheitsgefährdungen und Leistungsschädigungen programmiert. Vielfach dominiert die Wünschbarkeit bei der Umsetzung solcher Maßnahmen die tatsächliche Machbarkeit im Schulalltag. Man baut darauf, dass die Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Idealismus über sich hinauswachsen und mit »interessierter Selbstgefährdung« (→ Kapitel 2.4) auch diese Anforderungen erfüllen – oft der direkte Weg in eine »erschöpfte schulische Arbeitswelt« (Badura & Steinke 2011). So wird in den Landauer Empfehlungen gefordert, dass Gesetze und Verwaltungsanordnungen nicht nur einem Kostencheck unterzogen werden, um die fiskalischen Konsequenzen transparent zu machen. Mindestens gleichbedeutend ist ein Belastungscheck, um abzuschätzen, welche Aufgaben und Anforderungen zusätzlich auf die Betroffenen zukommen und welche Möglichkeiten der ausgleichenden Entlastung es gibt.
Lehrergesundheit wird mithin von vier Verantwortlichkeiten getragen, die aufeinander bezogen sind und nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Eine Einstellung wie »Ich tue erst etwas für meine Gesundheit, wenn hier andere Verhältnisse herrschen« ist ebenso fehl am Platz wie »Gehen Sie erst mal in einen Stresskurs, dann halten Sie das hier auch aus«. Selbst optimale berufliche Verhältnisse können ungeeignete Personen nicht zu Leistungsfähigkeit oder Unwillige nicht zu Leistungsbereitschaft und Kollegialität führen – und beste Eignung und Leistungsfähigkeit sowie Engagement können durch chaotische, sozialfeindliche, gesundheitsschädigende Verhältnisse an einer Schule zunichte gemacht werden.