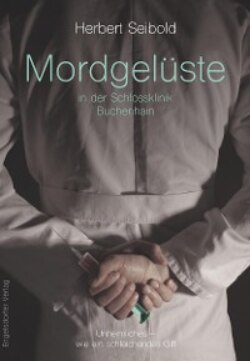Читать книгу Mordgelüste in der Schlossklinik Buchenhain - Herbert Seibold - Страница 7
Acht Monate zuvor: Im Verwaltungsschlösschen des Klinikums
ОглавлениеDoktor Kurt Muniel reckte sich in seinem Sessel und versuchte sich zu entspannen. Er hatte auch heute, wie seit Tagen, nicht seinen besten Tag. Wenn er sich mit seinen Zahlen quälte, war er sonst eher glücklich. Das war immer seine größte Stärke – gewesen. Aber jetzt hatte er – das war für ihn neu – so richtig Angst. Grundlos? Er hatte vor zwei Wochen sein nachhaltiges strategisches Konzept in der Klinik Buchenhain vorgestellt und damit durchgesetzt, dass Patienten nach der mittleren Verweildauer entweder nach Hause oder in andere Kliniken entlassen werden mussten, wenn die interne Verlegung in die Geriatrie mit seiner abrechnungstechnisch günstigen „Frühkomplexbehandlung“ nicht möglich war. Eine Kalkulation nach Maß, wie er mit strengem Gesichtsausdruck bekannt gab. Sie seien wie auf rauer See alle in einem Boot.
In dreißig Minuten hatte er eine Betriebsversammlung angesetzt, für die er seine Gedanken ordnen musste. Da schellte das Telefon. „Ja, Muniel?“ Es war seine Frau, die wieder einmal Geld für die Putzfrau und einen größeren Betrag für den Gärtner brauchte. „Was soll das? Hat das denn nicht Zeit bis heute Abend? Ich habe dir doch gestern Abend schon dreihundert Euro dafür gegeben. Ich hab jetzt keine Zeit.“ Er knallte den Hörer auf und stöhnte. Die Sekretärin hatte gerade die Tür einen Spalt geöffnet und wegen der dicken Luft sofort wieder geschlossen. Dabei war diese Störung noch harmlos, verglichen mit den unerwarteten Ereignissen nach der Versammlung.
Es traf ihn wie ein Schock, als er nach seiner großen Rede in der Betriebsversammlung am Vormittag dieses 15. März leichten Schrittes und wie durch ein Wunder – dank der gelungenen Rede – ausnahmsweise gut gelaunt in sein Büro trat. Er stockte. „Frau von Hess, was ist denn hier los? Warum ist es hier so kalt? Wer hat denn wieder das Fenster offen gelassen – war diese schreckliche Putzfrau mit ihren giftigen Putzmitteln schon da?“ Die Nacht zuvor war ungewöhnlich kalt gewesen, während der ganze Februar eher warm gewesen war.
Veronika von Hess-Prinz, wie sie mit vollem Namen hieß, seine Sekretärin, war fünf Minuten zuvor beschwingt mit einem frischen Blumenstrauß in der Hand und ihrer Lieblingsarie von Verdi, „La donna è mobile“, auf den Lippen ins Zimmer getreten. Doch das Lied blieb ihr im Halse stecken. Sofort rief sie fast hysterisch mit sich überschlagender Stimme und das Schlimmste befürchtend im Konferenzsaal an und war erleichtert, zu hören, dass ihr Chef wohlauf sei und sich gerade auf dem Weg zu ihr mache. Sie hatte Schlimmes befürchtet, als sie schaudernd bemerkte: „Es weht wie Kühle hier!“ Einen Augenblick hatte sie doch tatsächlich geglaubt, ihr Chef sei nach der Versammlung, als sie selbst zum Blumenkauf kurz weg war, zurückgekehrt und habe sich aus dem Fenster gestürzt. Der war schon seit Tagen schlecht drauf und nicht erst seit dem heutigen Telefonat mit seiner Frau. Normalerweise zitierte sie auch nicht Shakespeare – schon gar nicht am Vormittag. Tragik lag ihr sowieso fern, weil sie von Natur aus heiter gestimmt war.
Sie hatte den Vorhang zur Seite geschoben und war sofort blass geworden. Auch ihr Chef hatte – kurz darauf eingetreten – sofort geahnt, warum der weiße Store im Büro sich bei seinem Eintritt bewegt hatte. Er sah entsetzt auf das zerbrochene Fenster und dann sah er auch schon den Stein auf dem Fußboden. Um den Stein war ein Blatt Papier mit einem Teufelsgesicht gewickelt und darauf in Druckbuchstaben geschrieben: „Dem seelenlosen Psychopathen als Warnung. Das nächste Mal ein Bömbchen? Uns ist es todernst!“
Die Sekretärin musste sich setzen. Sie rang um Luft und Haltung. Ein Racheakt oder ein Bubenstreich? Muniel sank ebenso stöhnend auf seinen Sessel. Dabei hatte er heute Morgen gedacht, dass er in diesem Jahr nach ökonomischen Erfolgen einen strahlenden Frühling erwarten könne. Was in diesem Augenblick niemand, auch er, nicht ahnte: Es könnte sein letzter oder vorletzter Frühling sein.
Nach dem Steinwurf hatte Kurt Muniel zum ersten Mal ein mulmiges Gefühl, als würde sich die Romantik des Raums im Jugendstil in einen brutal ausgeleuchteten Tatort verwandeln. Es war ein ähnlich dumpfes Gefühl wie gestern Abend, als er kurz vor Dienstschluss eine unglaubliche E-Mail und zwei Minuten später eine weit schrecklichere erhielt. Die erste Mail vom Vorstand war für ihn einfach nur entmutigend und enttäuschend, weil darin die Unzufriedenheit der Mitarbeiter mit seinem angeblich harschen Führungsstil angeprangert wurde. Der Mitarbeiterwechsel sei beängstigend. Muniel kapierte. Der Druck, den seine Vorstandskollegen auf ihn ausübten, durfte natürlich nicht an die Mitarbeiter weitergegeben werden. Darüber konnte er im Nachhinein sogar noch lachen. Zwei Minuten später verging ihm aber endgültig das Lachen. Eine E-Mail – Spam? – auf seinem Outlook! Mit kaltem Schweiß auf der Stirn las er: „Ab jetzt sollten Sie sich warm anziehen, Herr Geschäftsführer!“
Er fühlte sich, als lastete ein unheimlicher Fluch auf ihm. Dabei hatte doch alles so positiv angefangen. Sein Konzept war eine Kombination aus Sparen und vom Land unterstützten Investitionen in Behandlungsmethoden, die nach dem Verzeichnis des Operationen- und Prozedurenschlüssels, abgekürzt OPS genannt, den meisten Gewinn einbrachten. Okay! Es war ihm tatsächlich gelungen, in den Bilanzen schwarze Zahlen zu schreiben. Wie ein neuer Trainer, der einen Verein vor dem Abstieg rettet. Die Mitarbeiter und der Vorstand hatten anfänglich nicht alle mitgezogen. Er hatte die Reformen auf der Vorstandsebene allein durchfechten müssen.
Jetzt fühlte er sich trotz seiner Erfolge wie auf einem Schleudersitz in diesem herrlichen Schloss im Buchenhain, dem Gebäude der Krankenhausverwaltung. Er fröstelte. In seinem Hirn breitete sich mit seinen trüben Gedanken eine beklemmende unbestimmte Angst aus. Letzte Nacht schon war er in Schweiß gebadet aufgewacht nach einem Albtraum, in dem ihm ein Mann im Talar, wie ihn sein strenger Vater trug, ein schwarzes Band um den Hals gelegt hatte.
Nun rannte er wie in Trance zum Spiegel und sah sein fahles verschwitztes Gesicht. Wegen der Kälte hatte er seinen Mantel angezogen, den er aber wegen plötzlicher Hitzewallungen wieder auszog. Seine trüben Gedanken – das spürte der Geschäftsführer – standen in krassem Gegensatz zu den heiteren Ornamenten der Belle Epoche in seinem Büro.
Er erinnerte sich: Der Bauherr des Schlösschens – ein Textilindustrieller – war auch nicht – es schien ihm jetzt wie ein Fluch – bis zu seinem Tode glücklich gewesen, da die guten Zeiten der Textilindustrie durch die Billigproduktion zuerst aus Indien, dann aus China und Bangladesch beendet wurden.
Dieser Industriezweig war auch ohne Finanzkrise schon vor Jahren in die Knie gegangen. Doktor Muniel hatte die früheren unbeschwerten Zeiten der Kliniken ohne Deckelung der Budgets schon nicht mehr kennengelernt. Seine Assoziationen waren von Anfang an durch die schlechteren Bedingungen der Kliniklandschaft von negativen und düsteren Gedanken an die Zukunft überschattet: In seinem Gesicht hatte sich ein ständiger Verdruss mit tiefen Längsfalten eingenistet. Er entkam dieser Stimmung nur durch bewusstes Planen und den Aufbau seines Selbstbildes von Macht und Bedeutung. Das Unbewusste machte wohl dabei nicht so leicht mit. Die Angst keimte in seinem Körper wie ein giftiges Kraut. Er sprach die Einsamkeit seiner Gedanken schon lange nicht mehr aus.
„Ich müsste doch nicht zuletzt wegen der jetzt erreichten schwarzen Zahlen glücklich sein.“ Das Krankenhaus hatte den Wettbewerbsdruck überlebt und ähnlich strukturierte Häuser in der Umgebung bis vierzig Kilometer einfach weggedrängt. „Unsere Arbeitsplätze blieben erhalten, weil die Bilanzen wieder stimmten. So hart es klingt, war das Krankenhaus wie ein schwer erkrankter Patient gewesen, bevor ich kam.“
Er redete sich das nicht nur ein. Es stimmte tatsächlich. Auch der Vorstand, der sich aus dem Alltag des Betriebs heraushielt, nickte geschlossen den Halbjahresbericht ab. Auch diese Herrschaften waren fest davon überzeugt, dass die Situation fürs Erste entschärft war. Sein Büro in einem Schloss – glaubte er – sei ein guter Ort, in dem er sich wohlfühle und Erfolge plane!
Er hielt die Einsamkeit seiner Gedanken nicht mehr aus. Er griff zum Telefon und bat seine Sekretärin herein. „Frau von Hess-Prinz! Ich brauche Sie, Ihren Optimismus und den Rat einer intelligenten und fühlenden Frau. Sie haben die Gabe, den Dingen ihre bleierne Schwere zu nehmen, als könnten Sie durch Nebel in eine unbeschwerte helle Zukunft schauen.“
Frau von Hess war Sekunden später in seinem Büro. Sie brachte einen Espresso mit. Muniel bot ihr keinen Stuhl an, sondern überfiel sie gleich mit einem Schwall von Worten: „Finden Sie, dass die heitere Atmosphäre des Schlosses nicht zu unserem harten Tagesgeschäft passt?“
Die Sekretärin – eine schlanke blonde Frau in den Vierzigern und im Gegensatz zu ihrem heiteren Gesicht mit strenger Hochfrisur – hatte eine bezaubernde, fast verzaubernde Art, auch unangenehme Situationen mit einem Lächeln zu überstehen. Sie wirkte echt. Keine Masche. Ob der ungewöhnlichen Frage aus dem Munde ihres sonst so spröden Chefs war sie doch sehr erstaunt, fasste sich aber schnell und sprach mit dunkler leiser Stimme und ihrem charakteristischen lächelnden Blick. Sie kannte das Sprichwort, dass nur der, der leise spricht, sich durchsetzen kann. Einen Augenblick fühlte sie sich wie die Pythia von Delphi.
„Ich glaube schon, dass wir für die Zukunft – sollte sich das Glück unseres Hauses nicht im Dunkeln verlieren …“ Sie schaute flüchtig in die Ferne und kurz darauf ihn fest, mit einem fast magischen Blick, an. „Im Umgang miteinander sollten wir entspannter, ja humorvoller sein. Der Alltag darf uns einfach nicht knechten oder niederdrücken! Aber auch die Geschichte von Schlössern – Sie sprachen ja von Schlössern als Paradigmen einer heiteren Welt – zeigt uns die Realität. Schlösser haben – verzeihen Sie, wenn ich etwas aushole – oft auch traurige Geschicke – denken Sie an das Schloss Neuschwanstein, das selbst einem von Geburt begünstigten König Ludwig nur Unglück gebracht hat. Auch moderne Schlösser wie das Schloss Bellevue in Berlin, das erst kürzlich in die Schlagzeilen geriet. Ein Schloss, das bis jetzt als repräsentatives Symbol einer integeren, wenn auch volksfernen Politik galt und seit den jüngsten Schlagzeilen einen komischen Beigeschmack bekommen hat.“
„Wie scharfsinnig und intellektuell Sie argumentieren, Frau von Hess-Prinz! In meinem Fall habe ich aber nie auch nur eine Sekunde an meinen eigenen Vorteil gedacht, sondern immer nur an das Krankenhaus!“
„Deswegen bewundere ich Sie auch so, Herr Doktor Muniel, aber Dank können Sie von den Menschen nicht erwarten“, erwiderte seine Sekretärin und meinte es ehrlich.
„Ja, ich musste viele unbequeme Entscheidungen treffen, unfähige Leute entlassen, trotz nicht voll besetzter Stellen nicht nur Ausländer, die unserem Standard nicht entsprachen, was viel böses Blut erzeugt hat.“ Als Gipfel fehlender Solidarität – wie Muniel fand – hatte der Geriatriechef Professor Seneca bei der letzten Sitzung die Haltung der Verwaltung in Personalfragen mit der seelenlosen Verwaltung in Kafkas Schloss verglichen! Ein für den neuen Geschäftsführer unglaublicher Fauxpas. Der schäumte immer noch vor Wut, da sein eigenes Verwaltungsschlösschen wirklich nicht als Paradigma einer unheimlichen Macht taugte. „Die Ungeheuerlichkeit dieses Vergleichs konnte nur von einem weltfremden Humanisten und versteckten Bösmenschen, zumindest von einem hoffnungslosen Träumer stammen!“
Frau von Hess zuckte kurz zusammen, als sie seine heraustretenden Augen sah. Sie machte sich ganz klein und hatte sogar kurz ihr Lächeln eingestellt.
Muniel aber fuhr jetzt unerwartet ruhiger fort: „In meinem Fall spielt Macht eine untergeordnete Rolle, ich bin doch – finden Sie nicht auch? – eher, wie soll ich sagen, altruistisch“, murmelte mit sich selbst wieder zufrieden der Verwaltungsdirektor und leckte sich die spröden und trockenen Lippen.
Frau von Hess-Prinz nickte ihm zu, musste aber zweimal schlucken. Bevor sie etwas sagte, dachte sie mit Blick in sein Gesicht, dass es Lippen seien, die schon lange nicht mehr geküsst worden waren.
Kurt Muniel fuhr stattdessen fort: „Manche Institutionen, zum Beispiel in Krankenhausverwaltungen der Universitätskliniken, sozusagen in C5-Positionen, wie die Stellungen von Verwaltungsdirektoren dort ironischerweise genannt werden – C4 ist normalerweise die höchste akademische Position in der Universität –, mögen kalte Machtinstrumente sein. Solche Verwaltungen schaffen eine tiefe Kluft zu den Menschen im Krankenhaus. Gut, dass es bei uns nicht so ist. Ich habe das Krankenhaus durch Visionen und klare Ziele vorerst gerettet und damit auch Arbeitsplätze! Jeden Morgen müssten mir die Ärzte zum Dienstantritt die Füße küssen.“ Der Geschäftsführer merkte nicht, dass er diese langen, immer wiederkehrenden, selbstzufriedenen Sätze schon zu oft vorgetragen hatte.
„Herr Doktor.“ Frau von Hess-Prinz’ Gesicht blieb auch jetzt gelassen freundlich und sie legte lächelnd ihre Hand auf seinen Unterarm. „Bitte quälen Sie sich nicht mehr so. Ich hole uns jetzt noch einen doppelten Espresso. Sie sind ja noch ganz blass. Ich habe übrigens schon dem Hausmeister Bescheid gesagt. Er wird sich um die Reparatur des Fensters kümmern.“
„Ich danke für den Espresso. Ich glaube aber – hm –, ich brauche eher einen doppelten Grappa“, entgegnet ihr Chef immer noch sichtbar genervt und fügte hinzu: „Haben Sie denn, Frau von Hess“, er hatte eine tiefe Falte auf der Stirn und sie bemerkte einen abrupten Umschwung von der Vertrautheit in die Distanziertheit mit ihr bekanntem Unbehagen, „eine Vorstellung, wer diesen Stein geworfen haben könnte?“
„Ich jedenfalls nicht, Herr Direktor“, feixte Veronika von Hess-Prinz und lächelte dabei schelmisch.
„Könnte es beim nächsten Mal eine Bombe sein, die neben mir hochgeht, während ich mich mit Zahlen am Schreibtisch herumschlage?“, fürchtete Muniel nun.
Frau von Hess schlug sofort einen sachlichen Ton an: „Jedenfalls kommt einer aus dem Umfeld der Klinik infrage und keine dummen Jungs von der Unterstadt und keine Palästinenser, obwohl von dort mehrmals im Monat E-Mails kommen, in denen um Assistentenstellen gebeten wird. Ja, auch entlassene Mitarbeiter sind nicht ausgeschlossen. Ich bin keine Profilerin. Spontan denke ich an einen impulsiven, eher einfach gestrickten Menschen, der Konflikte mit der Faust statt mit Argumenten und Worten zu lösen gewohnt ist. Im Moment fällt mir kein Konkreter mit Gesicht ein. Vielleicht ein Pfleger oder Handwerker, wenn nicht gar der Gärtner. Sie müssen Ihre Personalbesprechungen rekapitulieren. Haben Sie jemanden dieser Personengruppe – auch verdientermaßen – hart zurechtgewiesen? Übrigens! Bevor das Fenster ausgewechselt wird, müssen wir die Kriminalpolizei wegen der Spurensicherung holen – aber ohne Blaulicht und Uniformen. Ich sage gleich noch dem Hausmeister Bescheid – sorry, Sir! Darf ich dafür ausnahmsweise Ihr Telefon benutzen?“
Veronika konnte mit schwierigen Männern wirklich professionell umgehen und war jetzt ganz in ihrem Organisationselement. Sie spürte, dass ihr Herzklopfen verschwunden war, ihr wurde trotz der Kälte im Raum heiß und daran waren nicht die kommenden Wechseljahre schuld. Ihre Augen blitzten selbstbewusst. Selbst Muniel merkt manchmal, dass ich die Dinge im Griff habe, dachte sie zufrieden. Sie drehte sich zu ihm um. Er tippte gerade auf seinem Smartphone. Es störte sie nicht einmal, dass ihr Chef schon wieder wie geistesabwesend auf seinem Handy herumtippte.
Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit hatte sie regelmäßig Herzklopfen gehabt, wenn sie an seine Tür klopfen musste. Das Gefühl, das ihren Brustkorb zu sprengen drohte, wurde durch Gewöhnung zunehmend besser, eine leichte Angst blieb aber, wenn er seinen harten und entschlossenen Blick auf sie richtete, besonders aber, wenn er laut wurde. Ich bin die Einzige, die seine Laune verbessern kann, hatte sie schon von Anfang an gedacht, als er ihr Chef geworden war und sie sein galliges unstetes Wesen erkannt hatte. Sie hatte sich eine Entspannungsstrategie zurechtgelegt. „Durch meinen Optimismus wird er mir aus der Hand fressen und mein Lächeln wird seinen Frust ersticken“, sagte sie sich mehrmals am Tag wie ein Mantra vor. Dafür ging sie auch in Meditationskurse. Sie hatte viele Gesichter – das musste sie wohl auch bei diesem Chef. Sie sah ihn jetzt an wie eine Mutter ihr unglückliches Kind.
„Darf ich mich kurz setzen, obwohl ich schon zu lange Ihre kostbare Zeit in Anspruch nehme, Herr Doktor?“ Sie konnte ihn tatsächlich für Sekunden verzaubern. Mit einer Grandezza, wie sie von einem Baron kommen könnte, bot er ihr nämlich – oh Wunder – einen Stuhl an. Für Sekunden konnte er schlagartig eine andere Seite – die Gentleman-Seite – von sich zeigen. Veronika nutzte jetzt einfach diese andere Seite ihres Chefs und verteilte ihre Süßigkeiten, indem sie flötete: „Sie haben doch schon viel erreicht. Der Vorstand der Klinik GmbH müsste Ihnen tatsächlich – wie Sie selbst bemerkten – die Füße küssen. Ich bin ja so froh, dass es dank Ihrer Führung bergauf geht.“ Sie war erstaunt, dass ihr dieses Lob ohne zu stottern und ohne rot zu werden über die Lippen kam.
„Werden denn meine Bemühungen und Erfolge wahrgenommen?“, brummte er kaum hörbar, wurde aber allmählich lauter. Seine Stimme krächzte jetzt schon fast als Zeichen, dass Emotionen in ihm kochten. Auf dem Gesicht selbst konnte man noch keine Regung ablesen. Das Wort ‚Pokerface‘ kursierte schon mal unter den Mitarbeitern, wenn vom Verwaltungschef die Rede war.
„Natürlich sollte ich immer froh gestimmt sein, wenn, ja wenn da nicht der ständige Kampf um positive Bilanzzahlen wäre und wenn ich nicht so Schwierigkeiten hätte, die Mitarbeiter der Kliniken alle mit ins Boot zu kriegen. Wieso verstehen die das nicht? Die Sache ist doch ganz einfach, für einfache Ärzte vielleicht aber deshalb schwierig, weil die zwar Patienten und Krankheiten, aber nicht gleichzeitig gewinnrelevante Zahlen im Kopf behalten können. Als wenn das Gegensätze wären – für intelligente Menschen! Aufnahmen und Entlassungen können doch leicht so gesteuert werden, dass ein positiver ‚case mix‘ zustande kommt und Einnahmen die Ausgaben, auch die hohen Personalkosten, übertreffen. Zugegeben, unsere Patienten sollten nur so krank sein, dass die mittlere Verweildauer nie zu lange oder zu kurz wird und die Diagnosen die kalkulierten Bilanzen durcheinanderbringen. Patienten als Zahlen – so was darf man ja nicht laut sagen!“
Muniels Stirnfalte war wieder verschwunden und er machte ein Gesicht, als ob er dieses – wie alle glaubten – kranke System besiegt hätte. Veronika nickte ergeben, sie kannte die Litanei der Verzweiflung, wenn er sie für ein Seelenstündchen missbrauchte. Ohne Mühe ergab sie sich in ihr Geschick, ihm zuhören zu müssen.
„Meine Güte, alles wäre einfacher, wenn im Jahr 2003 nicht das diagnoseabhängige Bezahlsystem der Fallpauschalabrechnung, kurz DRG, eingeführt worden wäre“, kam Muniel auf sein Lieblingsthema zurück und wie aus einem alten einstudierten Drehbuch ergänzte seine Sekretärin: „Ja, die Gesundheitspolitik hat nicht nur kluge Entscheidungen getroffen. Es steht mir aber nicht zu, Namen aus der Politik zu nennen.“
Er lächelte sie jetzt – oh großes Wunder – sogar an und sie spürte, dass ihre Spannung nachließ und damit auch der Druck in ihrem Unterleib. Das ihr sehr unangenehme Glucksen im Bauch hatte auch aufgehört. Sie war sich nicht sicher, ob ihr Chef diese Geräusche vernahm. Sie hoffte, mit Yoga und modernen „Freidiäten“, wie sie neuerdings selbst im Supermarkt angeboten wurden, auch noch dieses Problem zu lösen. Wir Frauen sind stark und unsichtbar mächtig! Ich muss nur wissen, wie mit ihm umzugehen ist, dass es auch mir dabei besser geht, dachte sie zufrieden und legte ihre Hand auf seinen Unterarm. Sie kannte das Spiel.
Danach ging sie wieder in ihr Zimmer. Was beim Wechsel der Geschäftsführer vor einem halben Jahr in der lokalen Presse nur eine kleine Notiz war, sollte für das Krankenhaus große Auswirkungen haben. Die Insider wussten natürlich mehr, behielten das meiste aber für sich. Nachdem das Klinikum in den vergangenen sechs Jahren, quasi exakt mit Beginn der Einführung des neuen Abrechnungsverfahrens, wie die Hälfte der Kliniken in Deutschland nur noch rote Zahlen geschrieben hatte, war der alte Geschäftsführer Gottfried Trost, dessen Politik nicht mehr in die moderne Geschäftsphilosophie zu passen schien, vom Vorstand in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet worden. Viele erinnerten sich noch an die pathetische Abschiedsrede des alten Verwaltungsdirektors wie an einen Wechsel vom Herbst zum Winter! Auch Doktor Muniel blieb die Rede in lebhafter Erinnerung. Als Gipfel einer unpassenden und geradezu abwertenden Konnotation einer flexiblen ökonomischen Geschäftsführung hatte er es nach Muniels Einschätzung doch tatsächlich gewagt, in seiner Abschiedsrede vor großem Publikum und Orchester die Lebensqualität der Patienten und der Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen.
In seiner Rede strotzte er nur so von Selbstbewusstsein – seine Brust weitete sich unter dem breiten kurzen Hals, als er mit dramatischem Gesicht loslegte: „Ich blicke wenigstens in eine schöne Vergangenheit zurück. Die Akzeptanz des Hauses war während meiner Amtszeit immer groß. Wir müssen keine großen Gewinne erwirtschaften und auch nicht an die Börse gehen und uns größer vorkommen, als wir sind. Die niedergelassenen Ärzte wiesen nur zu uns ein, weil die Patienten unser Haus schätzten.“ Die genanten Ärzte unter den Zuschauern nickten begeistert und warfen sich zufriedene Blicke zu. Muniel hatte sich kurz umgesehen und nicht ohne Unbehagen festgestellt, dass alle, nicht nur diese Gruppe, zustimmend genickt hatten.
„Auch die Mitarbeiter konnten jederzeit zu mir kommen, was für mich zwar anstrengend war, aber auch befriedigend. Wenn sie das Büro verließen, konnte ich sehen, dass sie einen Motivationsschub bekommen hatten. Ihr Abschiedsgruß klang wie Musik in meinen Ohren, was – meine Damen und Herren – zwar pathetisch klingen mag, aber die schlichte Wahrheit ist. Die Profitzahlen waren für mich wichtig, aber gleichbedeutend waren die menschlichen Aspekte bei diesem harten Job.“ Wie ein Prophet aus alter Zeit hatte er den Zeigefinger gehoben, um dann wie im Triumph vom Podium an seinen Platz zurückzukehren. Dass er an der letzten Stufe stolpernd fast gefallen wäre, verschmälerte nicht den guten Gesamteindruck.
Der neue Geschäftsführer saß damals in der ersten Reihe. Nur die strenge Pflegedirektorin, die neben ihm saß, sah, wie er bei der Rede mehrmals unmerklich den Kopf schüttelte. Dieser Trost hat tatsächlich nichts begriffen, dachte Doktor Muniel damals. Meistens hörte er der Rede aber gar nicht zu und saß mit einem Katzenlächeln wie selbstverliebt im Stuhl und driftete mit seinen Gedanken in seine eigene Welt. Er betrachtete die Fenstermalereien, die sich als selten gelungene Exemplare des Jugendstils präsentierten. Immer wieder verlor er sich in diesen Bildern von den tanzenden Frauen, die er fast wie nur für ihn geschaffene Trugbilder wahrnahm. Die Tänzerinnen schienen wie im Traum direkt auf ihn zuzukommen. Das beklemmende schwarze Band um seinen Hals in seinen späteren Albträumen war damals noch nicht zu spüren.
„Du bist jetzt der ausgewiesene Manager, der Erfolg für das Haus verspricht“, schienen ihm die Tänzerinnen zuzuflüstern. Jetzt bedurfte das Haus eines anderen Verwaltungsdirektors, eines Mannes von ganz anderem Kaliber. Herr Doktor Kurt Muniel – auf den Titel sowie seine Doktorarbeit zum Thema „Die Deckungsbeitragsrechnung im Krankenhaus unter Berücksichtigung des unberechenbaren Kostenfaktors Patient“ legte er größten Wert und trotz vieler Neider waren im Internet bis jetzt keine Plagiatsvorwürfe erhoben worden – hatte trotz seiner fünfundvierzig Jahre und leichtem Bauchansatz eine noch sportliche Figur und hielt sich an das Motto: „Eine Stunde Tennis pro Tag ist das Minimum für einen hart arbeitenden Manager!“ Dynamisch lief er über die langen Krankenhausflure, hatte es immer eilig, war wie auf der Flucht vor etwas nicht Sichtbarem. Wovor eigentlich?, dachte da so mancher.
Unter den Assistenten kursierte schon am ersten Tag ein Spruch des Chefs der Geriatrie: „Muniel ist immer auf der Flucht, vielleicht vor den roten Zahlen oder nur vor sich selbst!“ Mit diesem Satz konnten viele etwas anfangen. Veronika von Hess-Prinz, die Chefsekretärin, die damals bei der Verabschiedung von Herrn Trost in der zweiten Reihe gesessen hatte, dachte auch nach Monaten immer noch an die alten Zeiten, die sie aber vor dem Angesicht ihres Chefs und der Belegschaft schon gar nicht preisen konnte und wollte. Ihr Bauchglucksen war beim Anblick des „Neuen“ aufgetreten und war beim Klang der „Ode an die Freude“, die vom Orchester im Fortissimo anlässlich der Verabschiedung des alten Geschäftsführers gespielt wurde, wieder verschwunden. Das war die Geburt einer neuen Taktik, sich abzulenken und sich wieder wohlzufühlen.
Wenn sie sich später bei der Arbeit über den „Neuen“ ärgerte, schlug sie auf die Tastatur ihres Computers ein, träumte vom „Alten“ und von Beethovens Musik und summte die „Ode an die Freude“. Sie gönnte sich Entspannungspausen sowie Erinnerungen an den alten Herrn Trost. Es war für sie noch bis vor Kurzem wie eine Verhaltenstherapie. Ihr alter Chef hatte in ihrer Erinnerung eine eher behäbige Ausstrahlung mit gütigem Lächeln auf dem runden Gesicht. Jedes Mal, wenn sie ihm einen Milchkaffee brachte, hatte er sie zu einem kleinen Plausch zu sich an den Tisch gebeten. Nicht lange, aber lange genug, dass sie sich froh wieder an ihre Arbeit machen konnte. Er neigte damals schon zur Glatze, die in einen Stiernacken überging, und war eindeutig bauchspeckdominant übergewichtig. Seit sie ihn zuletzt gesehen hatte, war sie auf der Suche nach einem anderen die Stimmung aufhellenden Chef wie ihrem alten.
Die letzte Erinnerung an ihn hatte sie sogar traurig gemacht. Sie sah ihn zuletzt im Supermarkt. Total glatzköpfig und deutlich vorgealtert mit hängenden grauen Wangen. Kein glückliches Gesicht. Doch man sieht selten glückliche alte Gesichter, besonders nicht in Supermärkten, wenn sie in die Abrechnungszettel starren. Ein Blick in seinen Einkaufswagen schien alles andere als tröstlich. Nur fetthaltige Fertiggerichte und Kohlenhydrate vom Billigsten, nichts Frisches, kein Gemüse und Salat, dafür aber Zigaretten! Sie war sehr erstaunt, dass ihr alter Chef jetzt auch noch damit angefangen hatte. Sollte er seinen eigenen Tod herbeisehnen? Oh je!, dachte sie dabei, konnte oder wollte ihn aber nicht begrüßen. Sie war wie blockiert! Sollte er inzwischen Single geworden sein? Seine Frau war doch noch relativ jung gewesen. Hat sie ihn verlassen, nachdem das üppige Gehalt ausblieb? Der arme alte Kerl. Der Herrgott meint es nicht gut mit den Seinen! Bekümmert verließ sie den Supermarkt, immer noch in Gedanken an Herrn Trost. Die Ungerechtigkeit seines Schicksals sah sie sehr wohl. Das hatte dieser herzensgute und auch kompetente Mann nicht verdient.
An ihrem Arbeitsplatz sah sie den Frust im Gesicht ihres neuen Chefs mit anderen Augen. Ihr Chef war immer akkurat gekämmt, zog sich jeden Morgen einen geraden Scheitel in das duschnasse Haar mit dem beginnenden Grauansatz und den Geheimratsecken. Was aber die bösen Zungen und selbst seine Sekretärin nicht wussten, war die frühe traurige Kindheit ihres Chefs.
Sein Vater – ein pietistischer Pastor – hatte ihn als Kind regelmäßig geschlagen, wenn er nicht korrekt mit Mittelscheitel frisiert war. „Gott mag keine Schlamper“ war dessen Standardsatz. In der Schule war er auch gemobbt worden. Muniels hageres Gesicht hätte schön sein können, wenn die tiefen senkrechten Falten an den Wangen und seine spröden Lippen nicht wären. Er war schon einmal wegen eines Magengeschwürs behandelt worden. Sein leicht schräger Mund und die von oft wiederkehrenden Herpesbläschen gezeichneten Lippen luden seine Frau und in der Fantasie der Sekretärin nicht gerade zum Küssen ein. Diese lädierten Lippen waren der Sekretärin erstmals aufgefallen, als sie ihm auf Facebook eine Nachricht über das Krankenhaus zeigte. Darin stand Ungeheuerliches: „Der Geschäftsführer wäre lieber Arzt geblieben. So bräuchten wir ihm nicht eine Spritze mit unbekanntem tödlichem Inhalt ansetzen und ihn zwingen, seine zynischen Ansichten über die Mitarbeiter zu rächen.“
Es war eine hinterhältige Drohung, die das Blut zum Stocken brachte. Von wem kam so was? Waren Verbrecher hinter ihm her? Berieten Psychopathen untereinander, wie sie ein rätselhaftes Drehbuch, ein tödliches Spiel inszenieren sollten? Wie räche ich mich an einem unbequemen und zynischen Vorgesetzten? Steckten jetzige oder frühere Mitarbeiter des Krankenhauses dahinter?
Auch in der Personalkantine war dieser Internetauftritt hinter vorgehaltener Hand diskutiert worden. Niemand konnte sich aber vorstellen, wer hinter der Drohung stand. Ein naseweiser Assistent, Doktor Gscheidle aus Ulm, meinte nur lapidar: „Wer Angst sät, wird Angst ernten.“ Betroffen nickten alle am Tisch.
Zu Hause machte seine Frau sich große Sorgen um ihn. „Kurt, du bist doch auf deine Mitarbeiter angewiesen. Du lähmst ja ihre Motivation durch deine gnadenlose Strenge – schau doch mal in den Spiegel!“, warf ihm seine Frau manchmal vor.
Wenn man ihn bei seinen Gängen über die langen Flure ansprach, verlangsamte er nur unmerklich sein Schritttempo und neigte dazu, den ihn Ansprechenden grundsätzlich nicht anzuschauen. Eine Augenbraue zog dabei nach oben, die andere blieb unbeweglich: Eine pantomimische Meisterleistung! Der linke Arm schwang kräftig mit, der rechte bewegte sich nicht. Fast so wie bei Putin, durchzuckte es Frau von Hess. Ein psychiatrischer Konsiliarius hatte sich mal verplaudert: „Euer Verwaltungschef hat, glaub ich, ein Asperger Syndrom und eine Erwachsenenform des ARDS!“
Auch die Sekretärin hatte eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass eine seltene, fast unmerkliche Veränderung von Kurt Muniels Gesichtsmuskeln als Lächeln zu deuten war. Tatsächlich wirkte diese von ihm als Freundlichkeit angelegte Mimik auf seine Mitarbeiter eher wie Eisregen. Unterhaltungen waren zeitlich nur sehr begrenzt möglich. Er selbst hielt sein Lächeln für gewinnend.
Amalie, seine Frau, hatte seit einem halben Jahr Bemerkungen über seine kalte Überheblichkeit eingestellt. Jeder Kritik enthielt sie sich, seit er einmal handgreiflich geworden war. Voller Wut hatte sie ihn einen pathologischen Narziss und Soziopathen genannt. Nein, das hätte sie nicht sagen sollen. Seitdem zeigte sie keine Wut mehr. Im Spiegel versuchte sie ihr von leichten Furchen verändertes Gesicht mit einem geheimnisvollen Lächeln zu verschönern.
Ihrer einzigen Freundin Christine im Tennisclub war dieses sybillinische wie einstudierte Lächeln aufgefallen. Sie erzählte Amalie aber nicht, dass sie dieses Lächeln wie eingefroren erlebte, ein Dauerlächeln, wie von manchen bekannten Politikergattinnen gezeigt. Stattdessen schmeichelte sie Amalie mit Lob für ihren entspannten Gesichtsausdruck. „Amalie, wunderbar – du wirkst ja so entspannt. Ich merke es auch an deinem Spiel. Nicht mehr so verkrampft hältst du den Schläger in der Hand.“
Amalie legte ihr nur ihre Hand auf die Schulter und sagte: „Du bist eine verdammte Schmeichlerin!“
Die Chefsekretärin Veronika von Hess-Prinz und Amalie Muniel waren nie befreundet gewesen. Allerdings trafen sie sich bei offiziellen Feiern der Klinik und schwätzten nach dem zweiten Glas Wein gelegentlich auch mal persönliche Dinge. Veronika hielt sich dabei immer zurück. Amalie begann seit einigen Jahren an den Hüften ein wenig in die Breite zu gehen und aus Frust und Stress sich schon mal über ihren Mann zu beklagen. Es kam ihr nach dem zweiten Glas Sekt gewissermaßen aus den Poren. Als Veronika sie zum ersten Mal erlebt hatte, dachte sie: Ach! Auch so eine frustrierte Ehefrau! Vorher ein sonderbares Lächeln und jetzt ein Gesicht, das wohl einiges zum Verbergen hat.
Amalie hatte sich einmal nach dem dritten Glas Sekt bei der Sekretärin Veronika über ihn beklagt, ohne zu berücksichtigen, wen sie vor sich hatte. Themen wie Frust in der Ehe ganz allgemein wurden schon vorher eher abstrakt als Allgemeinthema angeschnitten. Nach all den Jahren, in denen die Karriere des Mannes Vorrang hatte, Jahre, in denen Schlucken- und Duldenmüssen zum Alltag gehörten, traute sie sich jetzt, Tabuthemen anzusprechen.
Mordgedanken kamen in den Gesprächen natürlich auch im Scherz nicht vor. Dabei hatte Frau Muniel schon einmal geträumt, statt Salz, Pfeffer und Zucker weniger Bekömmliches – nämlich für die Leber und Nerven giftiges Pulver – in den Salat oder die Brombeermarmelade zu streuen – sie hatte ja immerhin Pharmazie studiert. Sie wusste, dass N-Nitrosodimethylamin ein schwer nachweisbares Lebergift ist, das Mutationen im Erbgut verursacht, so Leberkrebs erzeugt und nach Monaten und Jahren zum Tode führen kann. Von einem Mordfall mit diesem Gift an der Uniklinik Ulm vor dreiunddreißig Jahren hatte sie immerhin bei Google gelesen und hatte sich die Originalarbeit über den Fall besorgt, die der Oberarzt der Abteilung Gastroenterologie und sein Chef verfasst hatten. Mit der Sekretärin hatte sie diese Träume natürlich nicht erörtert. Glücklicherweise hakte sie solche Gedanken spätestens nach dem ersten morgendlichen Espresso als reine Fantasiegebilde ab – vorerst? Über eines war sie sich ganz sicher, dass sie nicht zur Mörderin taugte. Ihre Erziehung, ihre anerzogene Religiosität, ihre Ängstlichkeit und vor allem ihre Passivität würden sie Zeit ihres Lebens vor solchen Schritten bewahren. Sie bekam schon Herzklopfen, wenn sie daran dachte.
„Wie können denn die forensischen Psychologen und Psychiater behaupten, dass jeder Mensch in extremen Situationen oder im Kollektiv zum Mörder werden könne? Blödsinn!“
Natürlich hatte sie auch das Interview mit dem Psychiater Andreas Marneros über das Böse, das in uns allen steckt, und über die Liebe, die zum Tode führen kann, im Spiegel gelesen. Intimizid – die Tötung des Intimpartners – war seine werbewirksame Wortneuschöpfung. Blödes Geschwätz eines Psychiaters, dachte sie dabei! Das kommt doch nur in der islamischen Welt vor, war ihre Privatmeinung. Ihr Mann in seiner eiskalten Arroganz war ja der Meinung, dass sie nur Modehefte und nie das Ärzteblatt lese.
Diese Ignoranz von Kurt regt mich gar nicht mehr auf. Das weiß doch jeder, dass jedes Jahr Ehe jeweils Lichtjahre von der ursprünglichen romantischen Nähe entfernt. Statt Wut kommt dann nur noch Langeweile auf. Die Folge davon: manchmal ein strahlender jüngerer Liebhaber – ist das nicht die logische und zugleich befreiende Lösung? Insgeheim war sie richtig stolz über ihre Einfälle, die sie natürlich nie äußern würde!