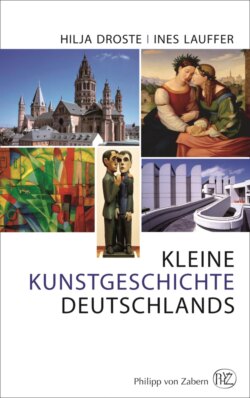Читать книгу Kleine Kunstgeschichte Deutschlands - Hilja Droste - Страница 14
KAROLINGISCHE BUCHMALEREI UND ELFENBEINARBEITEN
ОглавлениеDie karolingische Malerei präsentiert sich vor allem in den Handschriften. Mosaike aus der Zeit sind mit Ausnahme von Germigny-des-Prés in Frankreich nicht erhalten und auch die Wandmalerei ist größtenteils verschwunden. Der größte Bilderzyklus befindet sich in der Klosterkirche St. Johann im graubündischen Müstair; sie entstand im 9. Jahrhundert. Nur noch Fragmente finden sich in Paderborn, Trier oder der Lorscher Torhalle. So werden also die Buchmalereien beziehungsweise die Miniaturen der karolingischen Handschriften – benannt nach dem dafür häufig benutzten Rotpigment minium – zu den wichtigsten Zeugen der Malerei um 800.
Der Übergang von der zerbrechlichen Papyrusrolle zum Buch (codex oder liber genannt), das aus Pergamentblättern zusammengeheftet und durch einen starken Einband zusammengehalten wird, bedeutet nicht nur eine bessere Haltbarkeit der Schriftdenkmäler, sondern bedingt auch einen anderen Bildaufbau: Statt des fortlaufenden Rollenbildes musste nun ein geschlossenes Einzelbild geschaffen werden. Folgenreich für die Buchmalerei sind dabei die beinahe parallele Entwicklung des Pergamentkodex auf der einen und die Durchsetzung des Christentums auf der anderen Seite. Fortan war es eine der Hauptaufgaben dieser Codices, das Alte und das Neue Testament in ihren Miniaturen zu bebildern. Solche Miniaturen schmücken bereits die ältesten Relikte einer illustrierten Bibel, die Quedlinburger Italafragmente (um 400, Berlin und Quedlinburg), oder die Wiener Genesis (6. Jh.).
Was wir heute als karolingische Renovatio umschreiben, ging nicht nur, aber zumindest in den ersten Jahren, vom Hof Karls des Großen aus. Er versuchte seine Macht nicht allein durch territoriale Gewinne in kriegerischen Auseinandersetzungen zu stärken, sondern auch auf künstlerischem und intellektuellem Gebiet. Dabei übernimmt die karolingische Buchmalerei Impulse sowohl aus der Flächengestaltung der insularen Ornamente als auch aus den spätantiken und byzantinischen figürlichen Darstellungen im Raum und vereint diese zu einem neuen, dem karolingischen Stil.
Die Kompilation verschiedener Formensprachen wird schon in der ersten karolingischen Prachthandschrift offensichtlich. Das nach seinem Schöpfer benannte und zwischen 781 und 783 entstandene Godescalc-Evangelistar – es enthält im Gegensatz zum Evangeliar nicht die vier Evangelien im vollen Wortlaut, sondern nur jene in der Messe zu lesenden Abschnitte – ist das älteste Werk aus dem Hofskriptorium Karls des Großen in Aachen. In ihm sind bereits alle Bildthemen der karolingischen Prachtevangeliare zu finden – vor allem die Autorenporträts der vier Evangelisten mit ihren Symbolen und eine Christusdarstellung –, ebenso deren Ausstattungsmerkmale, insbesondere die Gold- und Silberschrift auf purpurgefärbtem Pergament.
In ihrer Typologie sind die vier Evangelistendarstellungen des Godescalc-Evangelistars so prägend gewesen, und dabei stilistisch so neu, dass das Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte diese monumentalen Gestalten des Godescalc-Evangelistars im Jahr 1948 als die „Ahnherren der deutschen Malerei“ bezeichnete. Aber auch weitab aller deutschtümelnden oder auch nur nationalen Geschichtsschreibung ist zu erkennen, dass hier eine neue Epoche europäischer Malerei beginnt; hier zeigt sich erstmals der Stil der karolingischen Malerei.
Ein weiteres herausragendes Werk aus dem Aachener Hofskriptorium ist das Lorscher Evangeliar, das mit seinem Entstehungsdatum um 810 als die letzte dieser Handschriften gilt und um 820 als Schenkung an das mittelrheinische Kloster Lorsch kam. Heute muss man durch halb Europa fahren (Rom, Bukarest, London), um seine einzelnen Teile zu bewundern.
Auch hier ist der Text in Gold und Silber auf Purpur geschrieben, die Seiten der Evangelien sind zweispaltig angelegt und Ornamentrahmen umschließen die Seiten. Den Evangelien vorgelagert sind die mit Arkaden gegliederten Kanontafeln, hier im Lorscher Exemplar auch noch die Vorreden. Erst darauf folgen die Evangelien selbst – das heilige Wort –, denen jeweils ein Autorenporträt des Evangelisten vorangestellt ist. Diese Autorenporträts sind unter einer Rundbogenarkade platziert, in deren Lünette das jeweilige Attribut erscheint: Matthäus ist frontal zu sehen, mit der Feder in der erhobenen Hand; Markus in Schrägansicht schreibend; Lukas mit dem Buch im Schoß, in Schrägansicht nachdenkend; und schließlich wiederum frontal der Evangelist Johannes (Abb. 2), der seine Feder eintaucht. Die Darstellung von Markus fällt aus der Reihe der von antiken Autorenporträts inspirierten Evangelistenbilder. Während diese einen beruhigten, beinahe klassischen Ausdruck zeigen, ist das Blatt des Markus von Dynamik geprägt. Die gewundenen Säulen, der bewegte Hintergrund der Lünette und das Podest, das aus der Bildfläche herauszukippen droht, unterscheiden sich ebenso deutlich von den übrigen Porträts wie die geschraubte Bewegung des Evangelisten.
2 Lorscher Evangeliar, Miniatur des Evangelisten Johannes und Textseite mit Beginn des Prologes, Vatikan, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 50, fol. 67v
Neben diesen vier Evangelisten gehören aber noch zwei weitere Miniaturen zur Ausstattung des Lorscher Evangeliars, wovon vor allem die Darstellung Christi, die eine ganze Seite einnimmt, hervorzuheben ist. Christus, umgeben von einem kreisrunden, mit den Evangelistensymbolen und Ornamenten verzierten Band, ist frontal wiedergegeben. Die rechte Hand zum Segensgestus erhoben, hält er mit der linken die Bibel auf dem Schoß. So sitzt er mit goldenem Nimbus auf dem himmlischen Thron. Diese Form der Christusdarstellung wird als Maiestas Domini bezeichnet, wie sie seit dem Anfang des 5. Jahrhunderts ihre Ausprägung gefunden hat und sowohl in der Klosterkirche in Müstair wie auch in der Aachener Pfalzkapelle zu finden war. Vergleichbar monumental ist Christus nur ein weiteres Mal in den Schriften der Hofschule wiedergegeben worden, nämlich im Godescalc-Evangelistar. Beide Maiestas-Domini-Darstellungen zeigen einen bartlosen, jugendlichen Christus, der auf römische Vorbilder zurückzuführen ist. Dieser Darstellungstypus wird uns neben dem byzantinischen Porträt des bärtigen und langhaarigen Weltenerlösers immer wieder begegnen. Die Vielgestaltigkeit des Christusbildes ist für das Frühmittelalter durchaus typisch.
Nicht umsonst heißen diese Handschriften Prachthandschriften. Nicht nur zwischen den Buchdeckeln erstrahlen die einzelnen Buchseiten in Gold und Silber, sondern sie erhielten auch ein wertvolles Gehäuse: Die Buchdeckel, aus Elfenbein geschnitzt und mit Edelsteinen besetzt, zählen zu den Höhepunkten karolingischer Elfenbeinarbeiten. Auf dem Vorderdeckel (Abb. 3) des Lorscher Evangeliars thront Maria mit dem Jesuskind, flankiert von Johannes dem Täufer und Zacharias; über ihr schweben zwei Engel, die einen Clipeus (Medaillon) mit dem Brustbild Christi halten, unter ihr sind die Geburt Christi und die Verkündigung an die Hirten in Szene gesetzt. Die Komposition des Rückdeckels ist in ihrer Anordnung identisch: Hier ist der triumphierende Christus auf der Mitteltafel dargestellt, auf Löwe und Drache stehend (nach Psalm 90,13), und flankiert von zwei Engeln, über ihm ein von zwei weiteren Engeln gehaltener Clipeus mit dem Kreuz als Siegeszeichen. Die Szenen zu seinen Füßen zeigen diesmal die Heiligen Drei Könige bei Herodes und bei der Anbetung des Kindes. Nicht nur im Aufbau, sondern auch thematisch sind die Deckel aufeinander abgestimmt. Sie schildern die beiden Erscheinungsformen Christi: seine Menschwerdung und seine über das Böse triumphierende Wiederkunft, also seine menschliche und seine göttliche Gestalt. Wie bei den Miniaturen, so sind auch bei den Elfenbeinarbeiten Werke aus der (Spät)Antike nicht sklavisch kopiert, sondern inhaltlich und formal neu interpretiert worden.
Die mittelalterlichen Buchdeckel der Prachthandschriften waren bisweilen auch Meisterwerke der Goldschmiedekunst. Allerdings sind aus der Karolingerzeit keine Beispiele überliefert – einzig ein Silberbecher aus Pettstadt und das sogenannte Ardennenkreuz oder die Aufzeichnungen des Einhardsbogens künden von Kenntnissen auch auf diesem Gebiet.
Neben den Handschriften der Hofschule, zu denen außer dem Lorscher Evangeliar und dem Godescalc-Evangelistar insgesamt neun weitere zählen (wobei das Lorscher Evangeliar am meisten Nachwirkung gezeigt hat), entstanden zeitgleich am Hof Karls des Großen noch weitere, nicht weniger eindrucksvolle Werke. Sie alle zeichnen sich durch einen deutlich abgrenzbaren Stil aus – ein charakteristisches Merkmal ist das Fehlen einer besonders betont ausgeschmückten Initiale. Zu diesen gehört auch das heute in Wien befindliche Krönungsevangeliar (Ende 8. Jh.), auf das die Kaiser ihren Krönungseid schworen. Auch die in dieser Traditionslinie stehenden Evangelistendarstellungen lehnen sich an spätantike Vorbilder an und entsprechen demselben Typus wie die des Lorscher Evangeliars. Gelegentlich zeigen sie aber auch wesentlich dynamischere und in eine Landschaft integrierte Autorenbilder, wie etwa im Schatzkammerevangeliar (Anfang 9. Jh., Aachen, Domschatzkammer) oder – bis in den Strich hinein vibrierend, so als würde sich die Linie der schreibenden und kratzenden Feder des Evangelisten Matthäus über das ganze Blatt ausbreiten – im sogenannten Ebo-Evangeliar aus Reims (816–835). Reims wurde in den Jahren nach dem Tod Karls des Großen neben Metz und Tours zum Zentrum der Buchmalerei.
3 Einband des Lorscher Evangeliars, Vorderdeckel, Marientafel aus Elfenbein, London, Victoria and Albert Museum
Zwischen 780 und 900 entstanden nicht nur Codices zum liturgischen Gebrauch, auch antike Autoren wurden kopiert und naturwissenschaftliche Schriften illuminiert. Dennoch lag ein Schwerpunkt auf der liturgischen Literatur und innerhalb dieser auf den Evangelien als den Verkündern der Frohbotschaft Gottes. Die in diesen Prachthandschriften verwendeten edlen Materialien – Gold und Silber auf Purpur, Elfenbein und Edelstein – künden von der hohen Stellung des geschriebenen Wortes als Wort Gottes im Christentum.