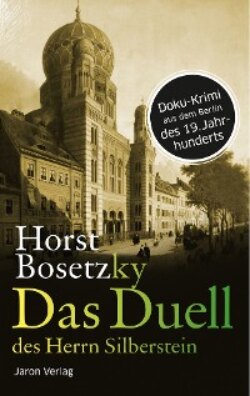Читать книгу Das Duell des Herrn Silberstein - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 7
Kapitel 2
Оглавление»ES IST EIGENTLICH eine böse Zeit! Das Lachen ist teuer geworden in der Welt, Stirnrunzeln und Seufzen gar wohlfeil.« So hatte Wilhelm Raabe Die Chronik der Sperlingsgasse beginnen lassen. »Die Menschen haben lange Gesichter und schwere Herzen, und wenn sich zwei Bekannte begegnen, zucken sie die Achsel und eilen fast ohne Gruß aneinander vorbei; – es ist eine böse Zeit!«
Das fand auch Louis Krimnitz, als er am 4. März 1856, einem Dienstag, ruhelos durch die Berliner Innenstadt lief – den Mühlendamm entlang, durch die Spandauer-, die König- und die Klosterstraße. Was ihn trieb, wusste er nicht genau. Es war wohl ebenso die Angst vor dem Alleinsein wie die Hoffnung, per Zufall einem Menschen zu begegnen, der einen Auftrag für ihn hatte. Hier war die Chance am größten, denn zwischen Alexanderplatz und Schloss, Friedrichsgracht und Garnisonkirche war die Stadt am lebendigsten, hier war das Viertel des gewerbetreibenden Volkes und der Juden. Die Geschäftigkeit erinnerte ihn an einen Ameisenhaufen. Im Parterre gab es kaum Wohnungen, alles war zu Läden und Warenlagern umgewandelt worden. Selbst die vielen Bierlokale dienten weniger der Entspannung als dem Abschluss von Geschäften, zumindest vereinten sie das Angenehme mit dem Nützlichen. Die hier angesiedelten Gasthöfe wie der »Kronprinz« und der »König von Portugal« wurden überwiegend von Geschäftsreisenden frequentiert.
Wer Louis Krimnitz zum ersten Mal sah, der hielt ihn für einen preußischen Landjunker, der nach Berlin gekommen war, um sich hier in den Weinstuben und den einschlägigen Etablissements kräftig zu amüsieren. Oder war er vielleicht doch einer jener neureichen Fabrikbesitzer oder Eisenbahnbauer, die dabei waren, die Welt zu erobern? Jedenfalls hatte er etwas an sich, das Ehrfurcht erheischte, und andere fühlten sich klein in seiner Gegenwart. Das hatte seine Ursache ebenso in seinem massigen Körper wie in seinem Blick, von dem die Freunde sagten, er sei der eines Dompteurs, vor dem im Zirkus die stärksten Löwen kuschten. Doch all das war Täuschung, war Maske und Fassade, denn in Wahrheit war Louis Krimnitz ein sehr unsicherer Mensch, immer auf der Flucht vor sich selber und getrieben von der Angst, wieder abzustürzen und dort zu landen, wo er hergekommen war: in der absoluten Armut.
Am 12. November 1822 war er im Armenhaus des Städtchens Dramburg geboren worden, und seine Mutter, eine Magd aus einem nahe gelegenen Dorf, hatte drei Tage später Pommern auf Nimmerwiedersehen verlassen. Louis hieß er nach seinem Vater, einem französischen Matrosen, den seine Mutter in einem Stettiner Lokal kennengelernt hatte. Nach einer stürmischen Liebesnacht hatte er sich in Richtung Guyana davongemacht, und da man seinen Nachnamen nicht kannte, waren alle Nachforschungen im Sande verlaufen. So war es Louis’ Schicksal gewesen, ohne jede Nestwärme in diversen preußischen Waisenhäusern aufzuwachsen. Aber immerhin, verhungert und erfroren war er nicht, darüber hinaus hatte er lesen und schreiben gelernt, die grundlegenden Rechenkünste dazu. Selbst der Tatsache, dass er täglich mehrfach geschlagen worden war und man ihn zur Strafe immer wieder in dunkle Keller gesperrt hatte, vermochte er im späteren Leben einiges abzugewinnen: Gelobt sei, was hart macht. Er konnte sich quälen und schinden wie kein Zweiter und schaffte, nachdem er seinen Militärdienst abgeleistet hatte, den Aufstieg vom Tagelöhner zum Bauunternehmer. Angefangen hatte er als Gleisbauarbeiter bei der Berlin-Anhaltinischen Eisenbahn, und als fünf Jahre später, im Jahre 1846, die Frankfurter Bahn nach Breslau verlängert wurde, hatte er mit seinen Ersparnissen, vor allem aber mit geliehenem Geld schon eine kleine Firma gegründet und den Auftrag zum Bau mehrerer Schrankenwärterhäuschen bekommen. Schnell hatte er begriffen, dass man nur zu etwas kommen konnte, wenn man andere für sich schuften ließ. Und billige Lohnsklaven gab es viele, gerade nach der gescheiterten Revolution von 1848.
Im Jahre 1851 hatte es Louis Krimnitz schon zu einem zweistöckigen Haus in der Cöpenicker Straße gebracht, das unten sein Bureau beherbergte, während sich oben die Wohnräume, das Schlafzimmer, die Küche und die Kammer für das Dienstmädchen befanden. Geheiratet hatte er auch, doch seine Frau war ihm schnell weggestorben. Schon das erste Wochenbett war für sie zu viel gewesen. Wenn Krimnitz nun eine Gesellschaft gab, musste seine Schwägerin einspringen.
Und oft lud er zu kleinen Feiern ein, denn er wusste, dass er lukrative Aufträge nur dann bekam, wenn er einflussreiche Leute kannte. So hatte er die bewundernswerte Eigenschaft entwickelt, sich Männern von Rang zu nähern und ihr Gefallen zu finden. Er war ein Schmeichler und Ohrenbläser, wie ihn viele brauchten, um sich wichtig und bedeutsam zu finden. Bald war er für ihr Selbstbild unentbehrlich, und sie lohnten es ihm, indem sie ihn denen ans Herz legten, die Bauaufträge zu vergeben hatten.
Dennoch plagten Krimnitz zu Beginn des Jahres 1856 erhebliche finanzielle Sorgen. Eine solche Pechsträhne hatte er noch nie erlebt. Für eine Fabrikantenvilla in Cöpenick hatte er bereits erhebliche Vorleistungen erbracht, als der Bauherr insolvent geworden und ins Gefängnis gewandert war. Ein Händler aus Schlesien hatte ihn hereingelegt und Marmor von so minderer Qualität geliefert, dass der schon Risse bekam, wenn ein Kind auf die verlegten Platten trat. Dazu war ihm in Teltow ein Fabrikschornstein umgestürzt und hatte die Dächer mehrerer Häuser durchschlagen. Da sein Polier geschludert hatte, zahlte seine Versicherung nicht, und er musste für den Schaden selber geradestehen. Seine Kassen waren nun leer, und Kredite bekam er keine mehr, denn sein Grundstück war schon über Gebühr mit Hypotheken belastet. Von den Schulden, die er bei privaten Banquiers hatte, gar nicht zu reden. Was ihm jetzt allein noch helfen konnte, war ein großer Auftrag, bei dem ihm der Bauherr einige Silbergroschen vorschoss.
Nur ein Wunder konnte ihn noch retten. In der Hoffnung darauf ging er in die alte Post, wo die Siechen-Brauerei ein Lokal eröffnet hatte. Kaum war er eingetreten, lobte er seinen untrüglichen Instinkt, denn wer dort in der Ecke saß und sich an seinem Seidel festhielt, war kein Geringerer als der Architekt Eduard Knoblauch. Man kannte sich gut. Knoblauch war Mitte der fünfzig. Begonnen hatte er als Feldmesser, war dann Baumeister geworden und durch zahlreiche Wohnhäuser und Villen am Thiergarten und in der Friedrichstadt hervorgetreten. Bis in den Vorstand des Architekturvereins und in die Akademie der Künste hatte er es inzwischen gebracht, und in den Salons munkelte man, der Bau des Jüdischen Krankenhauses würde ihm übertragen werden. »Die denken, bei dem Namen muss er Jude sein – ist er aber nicht.«
Krimnitz begrüßte ihn ebenso freudig wie mit der gebührenden Hochachtung und fragte, ob er wohl an seiner Seite Platz nehmen dürfe.
»Warum nicht …«
Krimnitz dankte und setzte sich. Er fand, dass Knoblauch schlecht aussah. Er schien an einer verdeckten Krankheit zu leiden. »Es geht Ihnen doch gut …«
Knoblauch seufzte. »Die Planungen für das neue Krankenhaus nehmen mich stark in Anspruch.«
»Wenn Sie Hilfe brauchen …« Es war mehr ein eigener Hilferuf als ein Angebot.
Knoblauch wich ihm aus. »Ich muss erst einmal Silberstein und Rana ausstechen.«
Krimnitz lachte. »Stechen ist ein treffendes Wort. Die beiden scheinen doch immer nahe daran, aufeinander einzustechen, sobald sie sich begegnen.«
»Vielleicht bin ich deswegen der lachende Dritte«, sagte Eduard Knoblauch.
»Und wenn, dann …« Krimnitz blieb nun nichts übrig, als den direkten Weg zu gehen. »… dann wäre ich Ihnen von Herzen verbunden, wenn Sie sich dabei meines bewährten Bauhofes bedienen würden. Wir setzen alles so um, wie Sie es entworfen haben.«
Knoblauch leerte seinen Seidel. »Verbindlichsten Dank. Wenn der Fall wirklich eintreten sollte, werde ich mich gern an Ihr Angebot erinnern.«
Krimnitz spürte genau, dass es für ihn bei Eduard Knoblauch nichts zu gewinnen gab. Schnell stand er auf und verließ mit einem unfreundlich gemurmelten Abschiedsgruß die Stätte seiner Niederlage. Am besten, er machte sich auf den Heimweg und betrank sich zu Hause.
Als er die Inselbrücke überquerte und vor sich die tiefen und strömenden Wasser der Spree erblickte, kam ihm der Gedanke, sich selbst zu töten. Ein paar Sekunden Todeskampf, dann wäre er von allem Elend erlöst. Aber wahrscheinlich war er ein zu guter Schwimmer, um unterzugehen, trotz seiner schweren Kleidung. Was gab es noch für Möglichkeiten? Den Strick. Die Balken in seinem Dachstuhl trugen ihn alle Mal. Nein, er war schließlich kein Verbrecher, und er wollte nicht wie am Galgen enden. Die ehrenhafteste Methode war immer noch die, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen. Schnell und schmerzlos war man im Jenseits. Aber er hatte keine Pistole. Dann beschaff dir eine! Dazu reichte sein Geld noch alle Mal. In einer ganz bestimmten Conditorei in der Kommandantenstraße bekam er sicher eine.
Und so war es dann auch. Nachdem er ein Glas Champagner getrunken hatte – nobel ging die Welt zugrunde –, ließ er sich eine Droschke kommen und an den Rand des Thiergartens fahren. Am Kemperplatz stieg er aus und wandte sich zur Luiseninsel. Entseelt auf den Gedenkstein der Königin niederzusinken, das hatte etwas, zumal wenn man Louis hieß.
Alles schien ihm reizvolles Spiel zu sein, bis er dann am Ziel angekommen war und die Waffe unter dem Mantel hervorzog, um sie zu entsichern. War es wirklich das bessere Los, seinem Leben ein Ende zu setzen? Gab es einen Gott, dann hatte er schlechte Karten – gab es keinen, dann … Der Gedanke an das absolute Nichts, an ein Verlöschen für immer und ewig ließ ihn erzittern. Und für jeden Aufschub dankbar, wandte er sich um, weil er hinter sich Schritte zu hören glaubte. Richtig, da kamen zwei Damen den Weg entlang. Beide teuer gekleidet, die eine aber offenbar die Herrin. Gott, die kannte er! Das war Marie Therese aus Zeitz, die heimliche Geliebte eines der vielen Fürsten aus Thüringen und Sachsen. Er kannte sie, weil er für ihren Besitzer ein Jagdschloss gebaut hatte. Der war nun vor Kurzem verstorben und hatte ihr wahrscheinlich nicht wenig hinterlassen.
Ohne sich weiter zu besinnen, eilte er der Schönen hinterher.
DIE EINWOHNERZAHL Berlins näherte sich immer mehr der magischen Grenze von 500 000 Seelen, das Militär mit seinen Angehörigen eingerechnet, und um die halbe Million möglichst schnell zu erreichen, verleibte sich die Stadt fortwährend ein, was an ihrem Rande gedieh, und dachte dabei zur Zeit namentlich an die Kämmerei-Ortschaften Wedding und Neu-Moabit, aber auch an Deutsch-Rixdorf.
Als Louis Krimnitz davon in der Zeitung las, fragte er sich unwillkürlich sogleich nach den Chancen, die sich ihm dadurch bieten könnten. Man würde, wenn alles wuchs, größere Rathäuser brauchen, neue Schulen, Wasserwerke und dergleichen. Und wenn er sich ranhielt, würde auch er ein paar Stücke vom großen Kuchen abbekommen. Die Redakteure gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die allgemeine Flaute bald vorüber sein und in den Sechzigerjahren ganz sicher der Aufbruch zu neuen Ufern erfolgen würde. Bis dahin galt es durchzuhalten. Wie aber? Krimnitz ging in sein Bureau hinüber, um die wichtigsten Bücher aus den Schubladen zu nehmen und noch einmal durchzusehen. Aber nicht hier unten, wo es kalt und ungemütlich war, sondern oben in der Küche, wo es dank Linas Kochmaschine auch jetzt noch mollig warm war. Außerdem gab es dort etwas zu essen und zu trinken.
Einsam war es am frühen Abend im großen Haus in der Cöpenicker Straße. Seine Schreiber und Buchhalter hatten Feierabend gemacht, und seine Zugehfrau war bei ihrer Mutter in Treptow. Mit der Petroleumlampe in der Hand stieg er die Treppe zum ersten Stockwerk hinauf. Als er den langen Flur entlangging, kam er am Bild seiner Frau vorbei. Ein begnadeter Künstler hatte es gemalt, und es war so lebensecht geraten, dass Krimnitz immer zusammenzuckte, wenn Elisabeths Blick ihn traf: »Warst du also wieder bei einem Flittchen?!« Nur um dich zu vergessen! Seit anderthalb Jahren war sie nun tot, im Wochenbett gestorben, das Kind mit ihr. Wie jeden Tag murmelte Krimnitz auch heute: »Ach, Elisabeth, mit dir hat mich das Glück verlassen.«
Aber noch war ja nicht aller Tage Abend. Mit seinen 33 Jahren war er ein Mann im besten Alter, und kam er erst wieder zu Geld, so kam er auch zu einer respektablen Frau. Marie Therese wäre eine gewesen, und ihr Vorleben störte ihn wenig, ganz im Gegenteil, doch als er sie im Thiergarten angesprochen hatte, war er auf die nächste Woche vertröstet worden. Dabei flüsterte sie ihm etwas ins Ohr, das sogar ihn noch erröten ließ.
Er entkorkte eine Flasche französischen Rotwein, füllte sein Glas bis zum Rand, nahm einen Schluck und setzte sich an den Küchentisch, um als Erstes die Schuldscheine durchzusehen und nach ihrer Fälligkeit zu ordnen. Die achthundert Thaler, die er Meir Rosentreter zurückzuzahlen hatte, wären schon gestern fällig gewesen, doch er hatte keine Möglichkeit gefunden, so viel Geld aufzutreiben. Nicht zuletzt aus diesem Grund hatte er daran gedacht, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen. Und wäre Marie Therese nicht zufällig des Weges gekommen, läge er in diesem Moment schon in der Leichenhalle.
Er schrak zusammen. Unten hatte jemand am Klingelzug gerissen … Er brauchte gar nicht ans Fenster zu treten und nach unten zu schauen, er wusste auch so, wer da Einlass begehrte: Meir Rosentreter natürlich. So zu tun, als sei er nicht zu Hause, wäre vergeblich gewesen, dazu war der Schein seiner Lampe zu hell. Außerdem konnte er sich nur noch dadurch retten, dass er mit Rosentreter redete und ihn dazu brachte, ihm ein weiteres Moratorium zu gewähren. Machte er nicht auf, lief der Geldverleiher morgen früh zum Gericht, um ihn anzuzeigen. Also ging er nach unten, schloss auf und bat Rosentreter einzutreten, um mit ihm in Ruhe über alles zu reden. »Oben bei mir in der Küche, da liegen alle Bücher …«
»Wo auch immer«, sagte Rosentreter, als er unten ablegte. »Doss gelt fargnigt und pajnigt ale.«
»Wie?«
»Das Geld vergnügt und quält alle«, übersetzte Meir Rosentreter.
»Geld genug liegt oben bei mir im Geheimfach«, sagte Krimnitz. »Sie werden’s gleich sehen.«
»Das wäre meines Herzens Freude und Wonne«, erwiderte Rosentreter. Es war seine Lieblingswendung. Diesmal gebrauchte er sie in der Version der Luther-Bibel, denn christliche Freunde hatten ihm gesagt, dass der 6. Vers des 63. Psalm so besser klänge und zu verstehen sei als in der Fassung von Leopold Zunz, wo es ja hieß: »Wie von Fett und Mark ist gesättigt meine Seele, und mit Jubellippen lobsingt mein Mund.« Das mit den Jubellippen mochte noch angehen – aber Fett in der Seele? Krimnitz waren solche sophistischen Fragen egal, er nickte nur und ging voran. Er hatte das Gefühl, zum Richtplatz geführt zu werden. Der Henker war dicht hinter ihm. Wie herrlich wäre es gewesen, wenn ihn statt des kleinen Rosentreter eine Frau wie Marie Therese aufgesucht hätte oder wenn er den Banquier wegen der Anlage eines Vermögens empfangen würde und nicht wegen seiner Schulden.
Als ihm Meir Rosentreter dann gegenübersaß, fiel Krimnitz auf, wie ähnlich sie sich sahen. Beide hatten den gleichen kräftigen Körperbau, was bei einem Juden doch erstaunte, und Haare so schwarz, wie es sehr selten vorkam in Berlin. Bei Krimnitz mochte das daran liegen, dass sein Vater ja Franzose war. Als er daran dachte, fiel ihm sogleich eine Geschichte ein, mit der sich Rosentreter vielleicht erweichen ließe.
»Ich habe Nachricht aus Le Havre, dass mein leiblicher Vater endlich gefunden worden ist. Es soll ein gewisser Louis Virenque sein, zur Zeit Kapitän auf einem Handelsschiff, ein wohlhabender Mann. Ich habe ihm schon geschrieben. Wenn er erfährt, dass er einen Sohn hat, der unverschuldet in Not geraten ist, wird er mich sicher auslösen.«
Rosentreter strich sich über die Haare und lachte. »Eine schöne Geschichte, Herr Krimnitz, aber wie sagte mein Vater immer: Hob ich nit kejn kowed, wil ich lechol hapochess hobn doss gelt. Habe ich keine Ehre, will ich wenigstens Geld haben.«
»Fassen Sie mal einem nackten Mann in die Tasche!«
»Soll das heißen, Herr Krimnitz, dass Sie auch heut nicht zahlen können?«
»Ja … leider …«
Meir Rosentreter stand auf. »Dann werde ich nicht anders können, als …«
Krimnitz presste die Handflächen gegeneinander und hob beschwörend die Arme. »Ich bitte Sie, haben Sie doch Mitleid mit mir!«
Rosentreter wandte sich zum Gehen. »Ich brauche das Geld so dringend wie Sie, und es ist mein Geld. Wenn Gutherzigkeit mein Tod ist, dann …«
»Wenn ich hier alles verkaufen muss, bin ich hinterher ein Bettler!«
»Ich warte jetzt ein halbes Jahr, und länger kann ich nicht mehr warten!« Damit war Rosentreter an der Treppe angekommen, die zwar ziemlich breit war, aber doch sehr steil nach unten führte.
»Raus hier!«, schrie Krimnitz. Hass flackerte in ihm auf, und ehe er sich’s versah, hatte er dem Geldverleiher mit der rechten Faust einen kräftigen Stoß versetzt.
Rosentreter stürzte die Treppe hinunter, schlug hart auf die Stufen auf, überschlug sich mehrmals und blieb schließlich unten liegen, ohne sich noch einmal zu rühren. Krimnitz war sofort gewahr, dass Rosentreter tot sein konnte. Er erschrak nur mäßig darüber. Sein erster Gedanke war: Der hartherzige Geldverleiher hatte es nicht anders verdient. Aber ihm war auch auf der Stelle klar: Lief er jetzt zur Polizei und führte sie zur Leiche von Rosentreter, dann bestraften sie ihn – und zwar wegen Mordes. Das hieß, dass er am Galgen endete, zumindest aber in der Hausvogtei einzusitzen hatte, bis er ins Greisenalter kam.
»Nein!«, schrie er da. »Nein! Nicht dieses Lumpen wegen.« Und dann überlegte er lange, wie er sich noch retten konnte. Schließlich hatte er einen Plan: Am besten, er zog sich die Kleider seines Opfers an, sofern sie nicht voller Blut waren oder jedenfalls schnell gereinigt werden konnten, und trat dann als Meir Rosentreter eine Reise an.
Nach einer knappen Stunde war er so weit. Er lief zur Oberbaumbrücke, überquerte die Spree und pfiff sich am Stralauer Thor eine Droschke herbei. »Zum Bahnhof der Frankfurter Eisenbahn.« Immer bemüht, so wie ein Jude zu sprechen, also »nu« zu sagen, »du megst« oder »e« statt »ein«, klagte er dem Kutscher sein Leid: dass er noch nach Frankfurt an der Oder müsse, um dort Geldgeschäfte abzuwickeln. Auch am Fahrkartenschalter im Bahnhof redete er mehr als nötig und ließ zweimal seinen angeblichen Namen fallen: »So wahr ich Meir Rosentreter heiße …« Der Beamte sah zwar ein wenig einfältig aus, das aber merkte er sich vielleicht.
Im Coupé war Krimnitz allein, was ihm zupasskam, denn so gab es keinen Zeugen dafür, dass er den Zug schon in Erkner verlassen würde. Schnell suchte er mit seinem kleinen Koffer in der Hand die Toilette auf und schloss sich ein.
Hineingegangen war er als Meir Rosentreter, heraus kam er als Louis Krimnitz. Im Koffer steckten jetzt die Sachen des Geldverleihers. Ganz unauffällig löste Krimnitz nun ein Billett nach Berlin. Beim Warten auf den Zug gab er sich alle Mühe, niemandem aufzufallen. Dass die Laternen auf dem Perron nur matt leuchteten, kam ihm dabei zu Hilfe. Im Abteil setzte er sich in die dunkelste Ecke, und er hatte offenbar Glück, denn keiner der übrigen Fahrgäste schien ihn zu kennen. Zwar wäre es noch keine Katastrophe gewesen, einen Bekannten zu treffen, aber besser war es schon, wenn ihn niemand auf der Strecke sah. Am Bahnhof verzichtete er auf eine Droschke und lief zu Fuß nach Hause, so schnell es eben ging, ohne dass er auffiel. Denn Rosentreters Leiche musste fortgeschafft werden – und die Nacht war kurz.