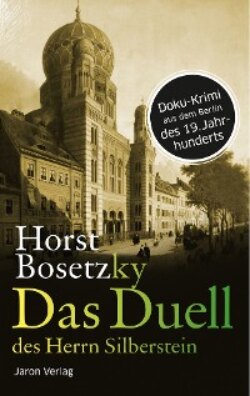Читать книгу Das Duell des Herrn Silberstein - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 9
Kapitel 4
Оглавление»DU STEHST immer noch am Brandenburger Thor, willst noch nicht zu Bett gehen, aber auch nicht mehr viel unternehmen. Gut. Da biete ich dir zweierlei. Rechts von dir winkt der gastliche ›Pariser Keller‹, das fashionabelste dieser unzähligen, nach Hamburger Art entstandenen Delicatessenlocale, wo Dünnwald … seine guten Weine der Vernichtung Preis giebt, wenn du selbst den Preis giebst. Oder willst du noch eine Stunde die Sinne erregen, so folge mir zu Kroll, gehe aber dennoch vorher eine halbe Stunde in den Pariser Keller.«
So wie es Ludwig Löffler in seinem Reiseführer Berlin und die Berliner von 1856 empfahl, wollte es auch Karl-Hermann Rana halten, als er am Sonnabend kurz vor Mitternacht die Friedrichstraße entlangkam und auf die Linden zuhielt.
Eigentlich hätte er Karl-Hermann Frosch heißen müssen, doch sein Großvater väterlicherseits, hoher Beamter in der K.-u.-k.-Monarchie, hatte keine Kosten und Mühen gescheut, von diesem Nachnamen loszukommen. Zu sehr hatte er ihn der Lächerlichkeit preisgegeben. Bei Frosch, da assoziierte doch ein jeder: feige, glubschäugig und glibbrig. Bestenfalls wurde er als »unser Froschkönig« verspottet. Die Kaiserin hatte schließlich ein Einsehen gehabt und der Latinisierung seines Namens zugestimmt: rana, ae hieß »der Frosch«. Das Dumme war nur, dass das Gesicht des Karl-Hermann Rana in der Tat etwas Froschhaftes hatte und viele Menschen genügend Latein verstanden, um seinen Namen ins Deutsche rückübersetzen zu können. Und das taten sie bei seinem Anblick mit einem ununterdrückbaren Reflex, denn Ranas braune Augen traten so stark hervor, dass sie auf Stielen zu sitzen schienen. Hinzu kamen sein breiter Mund und eine Haut, deren Farbe so fahl wie Roggenmehl war und bei entsprechender Bekleidung fast grünlich schimmerte, aber auch die Eigenart, bei der geringsten Erregung im Raume hin und her zu springen, mit riesigen und extrem nach außen weisenden Füßen. Ein Faun war er, ein immer fröhlicher Zecher und einer, der nichts so liebte wie das Spiel. Ja, sein ganzes Leben verstand er als Spiel.
Zur Welt gekommen war er am 17. April 1817 in Salzburg als Sohn eines Diplomaten und einer Frau aus dem Volke, der Tochter eines Zuckerbäckers. Dieser, sein heiß geliebter Großvater, hatte ihn als Kind angeregt, aus Marzipan, Nougat und anderen süßen Materialien Türme, Burgen und Schlösser zu formen. »Das wird einmal ein großer Baumeister!«, hatten da die Erwachsenen ausgerufen, und er hatte das später immer als Prophezeiung verstanden. Dieser Berufswunsch hatte sich dann verfestigt, als sein Vater einige Jahre in Griechenland und Italien verbrachte und Karl-Hermann die großen Bauwerke der Antike aus nächster Nähe bestaunen konnte.
Nach dem Studium in Wien und München hatte er an der Isar sein Examen gemacht und sich im süddeutschen Raum mit dem Bau mehrerer Kirchen, Landhäuser und städtischer Verwaltungsgebäude schnell einen Namen gemacht. Wegen hoher Spielschulden war er dann im Jahre 1851 nach Preußen ausgewichen und hatte sich in Berlin mit kleineren Aufträgen über Wasser gehalten. Zumeist hatte er Villen entworfen und hochgezogen für Bauern, die durch den Verkauf ihrer Wiesen und Felder zu Geld gekommen waren – immer mit viel Schinkel an der Fassade. Aber auch am Bau des ersten Berliner Wasserwerks, das gerade am Stralauer Thor in Betrieb gegangen war, war er beteiligt.
Rana war ein ausgesprochener Nachtmensch. Jeden Abend trieb es ihn in die Stadt hinaus. In seiner Wohnung in der Behrenstraße glaubte er zu ersticken. Eine Ehefrau, die ihn im trauten Heim gehalten hätte, gab es nicht. Ein lupenreiner Hagestolz war er mitnichten, aber die Schönen und die Reichen mochten ihn nicht, und auf ein biederes Hausmütterchen konnte er gern verzichten. Überkam ihn die Fleischeslust, zog er los, sich eine Frau zu suchen, die bezahlbar war und wieder verschwand, wenn sie ihm lästig zu werden begann.
Als er Unter den Linden angekommen war und nach links zum Pariser Platz abbiegen wollte, kam ihm ein Mann entgegen, der ihm in diesem Moment höchst lästig war, weil er ihn an seine Arbeit erinnerte. In der Tat fragte ihn Louis Krimnitz sofort, ob er nicht eine tüchtige Maurerkolonne benötige oder einen Lastkahn voller Kies. Vielleicht auch Ziegel aus Zehdenick?
»Nichts von alledem, mein Lieber, das Einzige, was ich derzeit brauche, ist ein üppiges Weib.«
»Das geht mir nicht anders, ich bin gerade auf dem Wege ins Gesellschaftshaus.«
»Nicht zu Kroll?«
»Da geh ich erst wieder hin, wenn eine italienische Nacht angekündigt ist.«
Rana überlegte nicht lange. »Schön, dann begleite ich Sie. Ist ja auch näher.« Während Kroll’s Etablissement noch hinter dem Brandenburger Thor gelegen war, brauchten sie zum Gesellschaftshaus nur ein kurzes Stück die Friedrichstraße hinaufzugehen und dann rechts in die Dorotheenstraße einzubiegen, schon waren sie am Bauhaus 7.
Auf dem Weg dorthin begegnete Rana einem Kunsthändler, den er schon lange kannte und der ihm immer wieder Pikantes anzubieten hatte. Er trug ein Gemälde unter dem Arm, dessen Rahmen so groß war, dass er ihn, sosehr er ihn unter die Achsel presste, mit den Fingerspitzen kaum noch greifen konnte. Das Kunstwerk war nicht nur von einem weißen Laken verhüllt, sondern auch noch, gleich einem Paket, mit Bindfäden gesichert.
Rana lachte. »Na, Rotzis, was haben Sie denn da wieder Schönes zu verbergen?«
Der Kunsthändler trat nahe an ihn heran, um ihm ins Ohr zu flüstern, dass es ein einmaliger Genuss sei, dieses Bild zu betrachten. »Wieder etwas aus der Bibel, 1. Buch Mose, 19. Kapitel: Wie Lots Töchter ihren Vater betrunken machen, damit sie seinen Samen bekommen. Wollen Sie mal einen Blick drauf werfen?« Er zog das Laken ein Stück zurück.
Rana war begeistert. »Sofort gekauft! Das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Schaffen Sie’s zu mir nach Hause, das Geld bringe ich Ihnen morgen vorbei.«
Im Gesellschaftshaus ging es so zu, wie es bei Löffler zu lesen war: »Allmählich finden sich die Tänzerinnen ein; die durch Toilette zu einer gewissen Geltung gebrachten Reize werden zur Schau gestellt, der Liebe-Markt beginnt. Gegen Mitternacht vergrößert sich die Gesellschaft und nimmt den ihr zukommenden gemischten Charakter an. Die Herren, bis dahin nur spärlich durch einige brotlose Ladendiener und duftende Frisörgehilfen vertreten, mehren sich durch edlere Ankömmlinge. Der Jurist kommt und sieht sich bald von seinen schönen, erst kürzlich entlassenen Sträflingen, der Arzt von der gesundeten Bevölkerung der Charité umgeben. Der Künstler findet seine Modelle, der Offizier in Civil lässt über das Ganze seine sieggewohnten Blicke schweifen, der Provinziale murmelt etwas von ›unterhaltenen Frauenzimmern‹. Die Logen füllen sich, die entlegenen Tische werden besetzt, und so mancher von der ängstlichen Frau erwartete Ehemann schwelgt, unbekümmert um die Entdeckung, an der Seite einer Marchande d’amour.«
Nach einer solchen suchten nun auch Karl-Hermann Rana und Louis Krimnitz: nach blonden Locken, nach dunklen Augen, nach einer in schottische Seide gezwängten schmiegsamen Taille. Doch auf wen stieß Rana? Auf seinen alten Freund Hans Wilhelm v. Rochow auf Plessow, Rittergutsbesitzer, Leutnant a. D. und Mitglied des Preußischen Herrenhauses. Sie setzten sich an einen Tisch, an dem sie weithin ungestört waren, und gaben Krimnitz ein Zeichen, sich doch bitte anderswo zu platzieren.
»Was gibt es Neues?«, fragte Rochow, nachdem er eine Flasche Wein geordert hatte.
Rana schmunzelte. »Du bist es doch, der Geschichtsträchtiges erlebt.«
»Ich hoffe jedenfalls.« Rochow wusste, worauf der Privatarchitekt da anspielte: auf die Ereignisse im Jockeyclub, der im »Hotel du Nord« Unter den Linden angesiedelt war. Junge Adlige trafen sich dort regelmäßig zum Glücksspiel, und Polizeipräsident v. Hinckeldey hatte dem Leutnant Damm befohlen, in die Räume einzudringen, die Runde aufzulösen und die Namen der Spieler festzuhalten. Zwei von ihnen waren daraufhin aus Preußen ausgewiesen worden. »Eine bodenlose Frechheit. Dieser Armleuchter v. Hinckeldey tut so, als sei er der König.«
Rana lächelte. »Man hört, seine Majestät haben geruht, die Razzia höchstpersönlich anzuordnen.«
Rochow zog die Augenbrauen hoch, um anzudeuten, was vom Geisteszustand Friedrich Wilhelms IV. zu halten war. »Wrangel und Prinz Wilhelm stehen fest zu uns, und das ist es, was zählt.« Rochow holte einen Artikel der Vossischen Zeitung aus der Brusttasche und faltete ihn auseinander. »Hör mal, was sie schreiben: dass sich der Adel von dieser Aktion brüskiert fühlt … Und dann über mich: ›Hans v. Rochow war so wenig damit einverstanden, dass er den Weg der Beschwerde betrat und hierbei Ausführungen machte, welche der General-Polizei-Director als beleidigend für sich ansehen zu müssen glaubte.‹ Schön, nicht?«
»Aber dich gefordert hat er nicht?«
»Zum Duell? Nein, leider nicht. Dazu war die Dosis diesmal noch zu niedrig. Aber wir werden sie zu steigern wissen. Denn eines steht fest: Dieser Hinckeldey muss eliminiert werden!«
KARL LUDWIG FRIEDRICH V. HINCKELDEY entstammte dem niederen Beamtenadel und war am 1. September 1805 in Sachsen-Meiningen als Sohn eines Geheimen Regierungsrats geboren worden. Er hatte von 1823 bis 1826 Rechtswissenschaften an den Universitäten Berlin und Göttingen studiert und war dann in den preußischen Staatsdienst eingetreten, wo er, erzkonservativ wie er war, schnell Karriere machte. 1834 wurde er zum Regierungsrat ernannt, 1842 kam er als Oberregierungsrat nach Merseburg, und am 14. November 1848 holte man ihn nach Berlin, um ihn zum Polizeipräsidenten zu berufen. Für Ruhe und Ordnung sollte er sorgen und das liquidieren, was von der Revolution noch geblieben war.
Diese Aufgabe erfüllte er überaus einfallsreich. Rücksichtslos und ohne jeden Skrupel ließ er alle jagen, die im Geruch standen, demokratisch zu sein. Im April 1851 gründete er den Deutschen Polizeiverein, dessen Aufgabe es wurde, die Kräfte der Geheimpolizei in den Staaten des Deutschen Bundes zu koordinieren. Ziel war »die Ausspähung, Prävention und Bekämpfung jeglicher oppositionell erachteter Bestrebungen«. Durch verschiedene Machenschaften gelang es ihm zudem, 1853 zusätzlich Generalpolizeidirektor zu werden, das heißt Leiter der Polizei im Ministerium des Innern. Er sorgte dafür, dass die Theater- und Pressezensur verschärft wurde, ließ Zeitungen beschlagnahmen und schuf eine gigantische Überwachungsmaschinerie. So wurden alle Reisenden und die Menschen, die sich in Berlin niederlassen wollten, überwacht, selbst wenn sie von Adel waren. Haussuchungen und Razzien in Wirts- und Vereinshäusern waren an der Tagesordnung, und es wimmelte überall von Spitzeln. Und vermochte er »subversive Elemente«, auch in den eigenen Reihen, auf diese Art und Weise nicht unschädlich zu machen, so wurden falsche Zeugen ins Spiel gebracht. Joseph Fouché hätte seine helle Freude an diesem Mann gehabt.
Karl-Hermann Rana war ein durch und durch dionysischer Mensch, und er liebte nichts mehr als das Spektakel, ja den Skandal. Und da sollte er im März 1856 voll auf seine Kosten kommen. Beim sogenannten Karussellreiten der Hof- und Gardeoffiziere hatten sich auch acht Polizeibeamte Zugang verschafft. Als sie von den erzürnten Adeligen des Platzes verwiesen wurden, ließen sie den Polizeipräsidenten herbeirufen. Hinckeldey erschien auch prompt, wurde aber am Eingang von mehreren Offizieren zurückgewiesen. Rochow, der mit dem preußischen Innenminister Ferdinand von Westphalen in der Nähe stand, beleidigte Hinckeldey derart rüde, dass der nicht mehr an sich halten konnte und Rochow zum Duell forderte.
»Der ist dem lieben Rochow also voll ins Messer gelaufen«, sagte Rana später zu seinem Freund Benno Frühbeis.
»Hinckeldey hat sich darauf verlassen, dass der König das Duell verbieten würde.« Benno Frühbeis war Schauspieler am Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater und hatte Freunde, die am Hofe ein und aus gingen und stets auf dem Laufenden waren.
»Hat er aber nicht?«
»Nein.«
Rana schüttelte den Kopf. »Aber Hinckeldey hat doch bekanntermaßen ›ein schwaches Gesicht‹, wie die Berliner sagen.«
Frühbeis lachte. »Ja, kurzsichtig wie ein Maulwurf ist er, und meine Zugehfrau hat gesagt: ›Der sieht doch uff zwölf Schritte keen Möbelwagen.‹ Darum soll er sich ja auch mit dem König so gut verstehen: Der läuft ja auch öfter gegen die dicksten Bäume.«
Rana zog an seiner Zigarre. Den Rauch trinken, nannte er das. »Ja nun, wer weiß, wozu es gut ist … Wo und wann wollen sie sich denn duellieren?«
»Nächsten Montag um zehn Uhr morgens in der Jungfernheide, gleich am Forsthaus Königsdamm. Willst du hingehen?«
»Natürlich. Rein zufällig werde ich zur Stelle sein.« Seine Neugierde war größer als seine Angst, vielleicht in irgendwelche polizeilichen Ermittlungen verwickelt zu werden und dadurch womöglich den einen oder anderen Auftrag zu verlieren. »Ein Duell, wunderbar! Ein Leben ist ja so kurz, und wann hat man schon einmal Gelegenheit, ein solches Schauspiel zu verfolgen.«
»Apropos Schauspiel.« Frühbeis griff zur Rotweinflasche, um sich nachzuschenken. »Ich komme mit, denn wer weiß, vielleicht kriege ich bald einmal eine Rolle, in der ich mich duellieren muss, und dann ist es sicher von Vorteil, so etwas schon einmal mit eigenen Augen gesehen zu haben.«
So saßen sie denn am 10. März schon frühmorgens in einer Droschke, um sich durch den Thiergarten nach Lietzow fahren zu lassen. Rechts hinter dem Charlottenburger Schloss ging es über die Spree hinweg. Auf der Holzablage hinter der Brücke entdeckten sie Louis Krimnitz, der gerade beim Löschen einer für ihn bestimmten Ladung Hand anlegte. Sie winkten ihm zu, sahen aber keinen Anlass, anzuhalten und mit ihm zu plaudern. Die Gefahr, zu spät zu kommen, war zu groß, und Krimnitz musste ja auch nicht unbedingt wissen, was sie zu dieser frühen Stunde in die Jungfernheide trieb.
»Ein komischer Kerl«, sagte Benno Frühbeis. »Ich traue ihm nicht so recht über den Weg.«
»Er hängt an mir wie eine Klette.«
»Eher wie ein Parasit«, korrigierte ihn Frühbeis.
»Wie auch immer – ohne mich kann er sich aufhängen, und ich möchte nicht schuld daran sein. Außerdem brauche ich ihn bei meinen Festen. Keiner singt so schön wie er die schauerlichsten Balladen, und keiner schleppt so schöne Frauen herbei.«
Knapp hinter dem Belvedere, wo die Spree einen scharfen Bogen nach Westen machte, ließen sie den Kutscher halten. Sie entlohnten ihn und wanderten dann einen staubigen Feldweg entlang, der zum Nonnendamm führte. Über die Nonnenwiesen, deren östlichen Zipfel sie gerade berührten, zogen feuchte Nebelschwaden.
»Welch eine Kulisse!« Benno Frühbeis geriet ins Schwärmen.
»Doch diese Morgenstunde hat nicht Gold, sie hat den Tod im Munde«, sagte Rana.
»Ist das nicht dasselbe? Nur der Tod nimmt uns die Angst vor ihm. Also ist er golden.«
»Verschon mich mit deiner verqueren Philosophie!«, rief Rana. »Das Einzige, was mir am Tod gefällt, sind die Todsünden, zwei vor allem: die Wollust und die Völlerei.«
So ging es noch eine Weile hin und her, bis sie auf ein breites Waldstück stießen, an dessen südlichem Rand sich der Königsdamm von Spandau Richtung Wedding zog. Bald entdeckten sie die beiden kleinen Gruppen um v. Rochow und um v. Hinckeldey und suchten Deckung hinter einem Wall aus aufgehäuften Feldsteinen, umgestürzten Bäumen und verfilzten Brombeerbüschen.
Die Lichtung wurde zur Bühne, und sie bekamen ein Drama zu sehen, wie es nicht mal das Königliche Schauspielhaus zu bieten hatte.
»Ein bisschen absurd ist es schon«, flüsterte Benno Frühbeis. »Da lässt der Junkerclub auf einen schießen, der selber von Adel ist und, indem er die Opposition niederhält, doch nur dessen ureigenste Interessen vertritt.«
»Egal, ich bin für Rochow, denn Hinckeldey hat mich um ein Haar in den Ruin getrieben.« Worauf Rana da anspielte, war die Affäre um die »Einmann-Pissoirs«. Hinckeldey hatte sich schon lange über das wilde Plakatieren in der Stadt geärgert und den Unternehmer Ernst Litfaß über 150 Reklamesäulen aufstellen lassen. Die waren innen hohl und boten Platz für ein kleines Urinal. Zwang man die Männer dort hinein, war viel für die öffentliche Schicklichkeit wie die Hygiene getan. Die Berliner nannten ihren Polizeipräsidenten daraufhin »Pinkel-Bey« und reimten: »Ach, lieber Vater Hinckeldey, / mach uns für unsre Pinkelei / doch bitte einen Winkel frei.« Aber die Sache scheiterte schließlich, weil sie den einen zu albern und den anderen wegen des schwer zu installierenden Abflusses zu teuer erschien. Rana aber hatte schon einige Vorleistungen erbracht und war nun um einiges ärmer geworden.
Benno Frühbeis packte ihn am Arm. »Pass auf, Hinckeldey zielt schon.«
Als Beleidigter hatte der Polizeipräsident den ersten Schuss. Doch seine Pistole versagte. Als er mit seiner Waffe zum zweiten Mal anlegte, verhöhnte ihn Rochow auch noch, indem er ihm eine besonders breite Brust darbot. Die Kugel ging prompt um einiges daneben.
»Jetzt Rochow!« Benno Frühbeis duckte sich und schloss die Augen.
Rana dagegen reckte den Kopf in die Höhe. »Er wird so nobel sein und Pinkel-Bey am Leben lassen.«
»DIE BERLINER KIRCHHÖFE verdienen eine besondere Beachtung«, heißt es im 1861 erschienenen Berlin-Führer von Robert Springer, »nicht nur wegen ihrer freundlichen Anlagen und wegen der sorgfältigen Pflege der Gräber, sondern auch wegen der Denkmäler der merkwürdigen Männer, deren Überreste auf ihnen ruhen.« Auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof waren es der »Philosoph und Kanzelredner« Schleiermacher und Ludwig Tieck, der »Reigenführer der Romantiker«. Auf dem Kirchhof der Invaliden fanden sich die Gräber der Generale Scharnhorst, Tauentzien und Winterfeld, und der Dorotheenstädtische Kirchhof hatte Fichte, Hegel, Hufeland, Schinkel, Beuth und Borsig zu bieten. Der Hallesche Kirchhof, die alte Begräbnisstätte der Jerusalemer Gemeinde, stand ihm aber mit E. T. A. Hoffmann, Chamisso, Iffland und Heim kaum nach. »Auf zehn verschiedenen Kirchhöfen«, schließt Springer, »sind jetzt Leichenhäuser für Todte, zur Errettung vom Scheintode, eingerichtet …«
Nicht erwähnt ist der alte Friedhof der Nikolai- und Mariengemeinde an der Prenzlauer Allee, auf dem Carl Ludwig Friedrich v. Hinckeldey seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Und scheintot war er auch nicht gewesen, denn zu präzise, nämlich links zwischen der vierten und der fünften Rippe, war ihm Rochows Kugel in die Brust gedrungen. Der Arzt, der dem Duell beigewohnt hatte, konnte nichts mehr ausrichten.
Eine große Zahl von Berlinerinnen und Berlinern war herbeigeströmt, um dem Polizeipräsidenten die letzte Ehre zu geben.
»Die Berliner sind schon ein komisches Völkchen«, fand Benno Frühbeis, der aus dem Fränkischen kam. »Erst hassen sie diesen Hinckeldey, dann machen sie ihn zum Märtyrer. Und sogar die Freunde seines Mörders kommen zu seiner Beerdigung.« Das war auf Rana gemünzt, der neben ihm stand.
»Ich bin ja kein Berliner, ich bin Österreicher.« Der Architekt lachte und wies nach vorn, wo seine Majestät Friedrich Wilhelm IV. zu sehen war, und mit ihm waren General von Wrangel, früherer Vorgesetzter Hinckeldeys, und fast alle Kabinettsmitglieder anwesend. »Wo so viele noble Menschen sind, darf ich nicht fehlen. Schließlich war ich in meinem frühen Leben auch mal König, wenn auch nur Froschkönig.«
»Fehlt nur noch, dass Rochow selber die Grabrede hält.«
Der war aber in seiner Wohnung Unter den Linden verhaftet worden, nachdem man ihn, als der Duelltod des Polizeipräsidenten bekannt geworden war, im preußischen Herrenhaus kräftig gefeiert hatte.
Hunderttausend Menschen folgten dem Sarg vom Trauerhaus zum Beerdigungsplatz, denn die Berliner sahen das Ganze als politischen Mord, zumal das Gerücht ging, dass noch zwei »Ersatzleute« des Junkerclubs bereitgestanden hätten für den Fall, dass Hinckeldey der Gewinner des Duells gewesen wäre. Hinckeldey wurde nun als einer gesehen, der gegen die verhassten Junker Front gemacht hatte. Außerdem hatte er sich nie persönlich bereichert und der Stadt vieles Segensreiche beschert, so die erste Telegrafenanlage für Polizei und Feuerwehr, die längst nötige Kanalisation, ein Wasserwerk und eine nicht geringe Anzahl von Gesindeherbergen, Volksküchen, Bade- und Waschanstalten. Als der Sohn des Lokomotivkönigs August Borsig am Grab für die Familie Hinckeldeys sammelte – sieben Kinder waren zu versorgen –, kamen nahezu 11 000 Thaler zusammen.
»So viel würden es bei mir nicht werden«, sagte Rana.
Benno Frühbeis lächelte. »Du wirst ja auch nicht bei einem Duell enden, sondern im Bett einer Kurtisane.«
»Weiß man’s?« Rana zeigte auf Friedrich Silberstein, der gerade an der Seite seines Sohnes vorüberkam. »Dieser Hundsfott übt bestimmt schon jeden Tag.«
»Nun mal’s nicht an die Wand.«
»Warum nicht, es gäbe ein schönes Gemälde.«