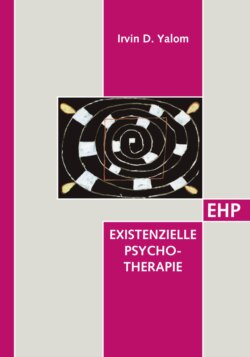Читать книгу Existenzielle Psychotherapie - Irvin D. Yalom - Страница 46
Erste Bewusstheit des Todes
ОглавлениеWann weiß das Kind zum ersten Mal vom Tod? Verschiedene Datenquellen stehen zur Verfügung (von denen alle beeinträchtigt sind durch die Hinder nisse, die ich beschrieben habe): Sorgfältige Längsschnitt-Untersuchungen – durch Eltern oder geschulte Beobachter; psychologische Tests – vor allem Wortdefinitionen (das heißt »Tod«, »Leben«, »lebendig«), Geschichten-Vervollständigungen, TAT (Thematischer Apperzeptions-Test), Analyse von Kinderzeichnungen; systematische Beobachtungen durch das Personal in Krankenhäusern oder Heimen; und Fallberichte von Kindertherapeuten oder Erwachsenentherapeuten, die retrospektive Daten liefern.
Der Tod und die Entwicklung der Sprache. Die objektiveren Messungen hängen von der jeweiligen Sprachfähigkeit des Kind ab. Anthony versuchte, die Frage »Wann weiß das Kind vom Tod?« zu beantworten indem sie dreiundachtzig Kinder bat, das Wort »tot«, das in einen Test über allgemeine Vokabeln eingefügt war, zu definieren. Die Antworten von 100 Prozent der Kinder, die sieben Jahre und älter waren (und von zwei Dritteln der sechs Jahre alten Kinder), deuteten auf ein Verständnis von der Bedeutung des Wortes hin (obwohl sie oft in ihren Definitionen Phänomene einbezogen, die nicht logisch oder biologisch wesentlich waren). Nur drei der zweiundzwanzig Kinder, die sechs Jahre oder jünger waren, wussten überhaupt nichts von der Bedeutung des Wortes.19
Ein anderer objektiver Zugang zum Problem ist es, die Entwicklung des Begriffs »lebendig« oder »Leben« bei Kindern zu untersuchen. Bei jungen Kindern scheint es viel Verwirrung über die Eigenschaften von lebenden Wesen zu geben. J. Sully bemerkte 1895, dass junge Kinder alle offensichtlich spontanen Bewegungen als ein Zeichen des Lebens ansehen und daher glauben, dass Objekte wie Feuer oder Rauch lebendig sind.20 Piaget nahm an, dass der Animismus der Kinder (der, wie er glaubte, mit dem Animismus primitiver Menschen verglichen werden kann) in vier Stadien aufgeteilt werden kann. Zuerst werden die unbelebten Objekte im Allgemeinen so betrachtet, als hätten sie Leben und Willen. Zu Beginn des siebten Lebensjahres schreibt das Kind nur den Dingen Leben zu, die sich bewegen. Vom achten bis zum zwölften Jahr schreibt das Kind denjenigen Dingen Leben zu, die sich selbst bewegen; und danach wird die Ansicht des Kindes in zunehmendem Maß die von Erwachsenen.
Piaget hielt das Thema des Todes für ein Hilfsmittel bei der Entwicklung eines reifen Begriffs der Kausalität. In den frühen Gedanken des Kindes wird Motivation als Quelle betrachtet, und die Erklärung von der Existenz der Dinge und jeder Ursache wird mit einem Motiv in Zusammenhang gebracht. Wenn das Kind sich des Todes bewusst wird, erfährt dieses Gedankensystem eine Umwälzung: Tiere und Menschen sterben, und ihr Tod kann nicht als Ergebnis ihres Motivs erklärt werden. Allmählich fangen die Kinder an zu verstehen, dass der Tod ein Naturgesetz sein muss – ein Gesetz, das einheitlich und unpersönlich ist.21
Bei dem Versuch zu verstehen, was lebt oder Leben hat und was unbelebt ist, geht das Kind durch eine große Verwirrung. Beispielsweise glaubte mehr als ein Drittel der sieben- bis achtjährigen Kinder in einer Studie, dass eine Uhr oder ein Fluss lebt; drei Viertel hatten das Gefühl, dass der Mond lebt, während zwölf Prozent das Gefühl hatten, dass ein Baum nicht lebt.22 Die Verwirrung des Kindes wird wahrscheinlich erhöht durch die verwirrenden Botschaften aus der Umgebung. Das Kind wird nie klar und genau über diese Dinge durch die Erwachsenen unterrichtet. Es ist verwirrt durch Puppen und mechanisches Spielzeug, welches Leben simuliert. Dichterische Freiheit in der Sprache ist eine weitere Quelle der Verwirrung (»Wolken rasen über den Himmel«, »der Mond schaut zum Fenster herein«, »der Bach tanzt zum Meer«).
Beobachtung von Kindern. Diese Studien der linguistischen Entwicklung haben viele Entwicklungstheoretiker und Kliniker dazu veranlasst, den Zeitpunkt der Bewusstheit des Kindes vom Tode viel später anzusetzen, als durch die direkten Beobachtungen nahegelegt wird, die ich jetzt betrachten werde. Vielleicht erheben Forscher unnötig strenge Anforderungen für die Beweisführung. Gibt es irgendwelche Gründe dafür, dass ein Kind in der Lage sein muss, »lebendig« oder »tot« zu definieren, um in seinem Innersten zu wissen, dass es wie Insekten, Tiere oder andere Menschen eines Tages aufhören wird zu sein? Forscher, die sehr junge Kinder untersuchen, stellen übereinstimmend fest, dass diese sich in beträchtlichem Ausmaß mit dem Tod beschäftigen. Der theoretische Einwand, dass das Kind, das jünger als acht oder zehn ist, abstrakte Konzepte nicht verstehen kann, geht an der Frage vorbei. Wie Kastenbaum und Aisenberg hervorheben: »Zwischen den Extremen von ›Nicht-Verstehen‹ und expliziten, integrierten, abstrakten Gedanken gibt es viele Wege, über die der junge Geist in eine Beziehung mit dem Tod eintreten kann.«23 Trotz einer gewissen Vagheit ist der Ausdruck »in eine Beziehung mit dem Tod eintreten« hilfreich: Das sehr junge Kind denkt über den Tod nach, fürchtet sich vor ihm, ist neugierig auf ihn, registriert Wahrnehmungen, die sich auf den Tod beziehen und die es sein ganzes Leben lang behalten wird, und errichtet Abwehrmechanismen gegen den Tod, die auf Magie gründen.
Kastenbaum und Aisenberg berichten von Beobachtungen über David, einem achtzehn Monate alten Kind, das einen toten Vogel in seinem Garten entdeckte. Der Junge schien benommen zu sein und sein Gesicht nahm, seinen Eltern zufolge, »einen erstarrten, ritualisierten Ausdruck an, der ganz stark stilisierten griechischen Masken für Tragödienaufführungen ähnelte.«24 David war ein typisches Kleinkind, das dazu neigte, alles in seiner Reich weite aufzuheben und zu untersuchen; in diesem Fall jedoch kauerte er sich neben dem Vogel nieder, machte aber keine Anstrengung, ihn zu berühren. Ein paar Wochen später fand er einen weiteren toten Vogel. Diesmal hob er den Vogel auf und bestand mit Hilfe von Gesten, die die Nachahmung von einem fliegenden Vogel einschlossen, darauf, dass der Vogel zurück auf den Ast eines Baumes gesetzt würde. Als seine Eltern den toten Vogel auf den Baum setzten und der Vogel leider nicht flog, bestand David wiederholt darauf, dass der Vogel auf den Baum gesetzt werden sollte. Ein paar Wochen später konzentrierte sich die Aufmerksamkeit des Jungen auf ein einzelnes herabgefallenes Blatt, und er war sehr beschäftigt mit dem Versuch, es wieder auf den Baum zurückzulegen. Als es ihm nicht gelang, das Schicksal des Blattes zu revidieren, beauftragte er seinen Vater, das Blatt wieder am Baum festzumachen. Da David nicht in der Lage war zu sprechen, kann man sich der genauen Natur seiner inneren Erfahrung nicht sicher sein, aber sein Verhalten legt nahe, dass er sich mit dem Begriff des Todes auseinandersetzte. Es ist sicher keine Frage, dass die Begegnung mit dem Tod neuartiges und ungewöhnliches Verhalten hervorrief
Szandor Brant, ein Psychologe, berichtet von einem Vorfall, an dem sein Sohn Michael im Alter von zwei Jahren und drei Monaten beteiligt war.25 Michael, der von seiner Flasche ein Jahr lang entwöhnt worden war, fing an, mehrmals in der Nacht aufzuwachen und hysterisch nach der Flasche zu schreien. Als man ihn fragte, bestand Michael darauf, dass er die Flasche haben müsse, oder »ich werde nicht in Gang kommen«, »mir wird das Benzin ausgehen«, »mein Motor wird nicht laufen, und ich werde sterben.« Sein Vater sagt, dass bei zwei Gelegenheiten unmittelbar vor Michaels Aufwachen in der Nacht bei einem Auto im Beisein des Kindes das Benzin ausgegangen war und es viele Diskussionen darüber gab, wie der Motor »gestorben« war, und wie die Batterie dazu kam, »tot« zu sein. Michael schien überzeugt zu sein, so schließt sein Vater, dass er weiter Flüssigkeit trinken müsse, sonst würde er auch sterben. Michaels sichtbare Besorgnis über den Tod hatte sogar früher in seinem Leben begonnen, als er eine Fotografie von einem toten Verwandten sah und endlose Fragen an seine Eltern über den Status dieses Verwandten richtete. Michaels Geschichte deutet darauf hin, dass der Tod eine Quelle großen Kummers für das sehr junge Kind sein kann. Darüber hinaus erkannte Michael, was auch für den vorherigen Fall gilt, in einem sehr frühen Alter den Tod als ein Problem – vielleicht, wie Kastenbaum nahelegt, das erste vitale Problem und ein Hauptanstoß für kontinuierliche geistige Entwicklung.26
Gregory Rochlin schließt auf der Grundlage mehrerer Spielsitzungen mit einer Reihe normaler Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren ebenfalls, dass das Kind im sehr frühen Alter lernt, dass das Leben ein Ende hat, und dass der Tod für es selbst ebenso wie für jene kommen wird, von denen es abhängt.
Meine eigenen Untersuchungen haben gezeigt, dass das Wissen vom Tod, einschließlich der Möglichkeit des eigenen Todes, in einem sehr frühen Alter erworben wird, und zwar weit früher, als normalerweise vermutet. Im Alter von drei Jahren ist die Angst vor dem eigenen Tod auf eindeutige Weise mitteilbar. Wieviel früher als im Alter von drei Jahren diese Information erworben wird, ist eine Angelegenheit wenig stichhaltiger Spekulation. Die Verständigung mit einem jüngeren Kind über dieses Thema ist unwahrscheinlich. Sie wäre auch zu fragmentarisch. Wichtiger ist, dass der Tod in einem Kind von drei Jahren bereits als eine Furcht, als eine Möglichkeit angefangen hat, wesentliche Wirkungen zu erzeugen.27
Der Beweis steht jedem, der bereit ist, Kindern zuzuhören und ihr Spiel zu beobachten, leicht zur Verfügung, stellt Rochlin fest.28 Überall auf der Welt spielen die Kinder Spiele von Tod und Auferstehung. Es gibt viele Gelegenheiten, etwas über den Tod zu lernen. Eine Fahrt zum Fleischmarkt sagt jedem Kind mehr, als es zu wissen wünscht. Möglicherweise bedarf es keiner Erfahrung; möglicherweise hat, wie Max Scheler behauptet,29 jeder von uns ein intuitives Wissen vom Tod. Ungeachtet der Quelle des Wissens ist jedoch eines sicher: Die Tendenz, den Tod zu verleugnen, sitzt tief in jedem von uns, sogar im frühen Lebensalter. Das Wissen wird aufgegeben, wenn unsere Wünsche dem entgegenstehen.
Wenn die Realität mit Macht hereinbricht, wanken die noch jungen todesverleugnenden Abwehrmechanismen und erlauben es der Angst durchzubrechen. Rochlin beschreibt einen dreieinhalbjährigen Jungen, der seine Eltern mehrere Monate lang immer wieder gefragt hat, wann er oder sie sterben würden.30 Man hörte ihn murmeln, dass er selbst nicht sterben würde. Dann starb sein Großvater. (Dieser Großvater lebte in einer entfernten Stadt und war dem Kind kaum bekannt.) Der Junge begann, häufige Albträume zu haben und verzögerte das Schlafengehen regelmäßig; er setzte offensichtlich das Schlafengehen mit dem Tod gleich. Er fragte, ob es wehtun würde zu sterben, und sagte, dass er Angst hatte zu sterben. Sein Spiel deutete auf seine Beschäftigung mit Krankheit, Tod, Töten und Getötet-Werden hin. Obwohl es schwierig ist, mit Sicherheit zu wissen, was »Tod« für die innere Welt des präoperationalen Kindes bedeutete, schien es, dass dieses Kind viel Angst mit ihm assoziierte: Tod bedeutete, in die Kloake geschüttet zu werden, verletzt zu werden, zu verschwinden, im Abwasserkanal weggeschwemmt zu werden, auf dem Friedhof zu verwesen.
Ein anderes vierjähriges Kind verlor auch einen Großvater, der an seinem dritten Geburtstag starb. Der Junge bestand darauf, dass sein Großvater nicht tot war. Dann, als ihm gesagt wurde, dass sein Großvater an Altersschwäche gestorben sei, wollte er die Versicherung haben, dass seine Mutter und sein Vater nicht alt waren, und erzählte ihnen, dass er nicht älter werden würde. Ein Teil des Transskripts dieser Spielsitzung zeigt sehr deutlich, dass dieses vierjährige Kind »in eine Beziehung mit dem Tod eingetreten war«.
D: Letzte Nacht fand ich eine tote Biene.
Dr.: Sah sie tot aus?
D: Sie wurde getötet. Irgendjemand ist darauf getreten, und daran ist sie gestorben.
Dr.: So tot wie Menschen tot sind?
D: Sie sind tot, aber sie sind nicht wie tote Menschen. Überhaupt nicht wie tote Menschen.
Dr.: Gibt es da einen Unterschied?
D: Menschen sind tot und Bienen sind tot. Aber sie werden in die Erde gelegt und sie sind zu nichts nütze. Menschen.
Dr.: Sind zu nichts nütze?
D: Nach langer Zeit wird sie wieder lebendig werden (die Biene). Aber ein Mensch nicht. Ich will nicht darüber reden.
Dr.: Warum?
D: Weil ich zwei lebende Großväter habe.
Dr.: Zwei?
D: Einen.
Dr.: Was geschah dem anderen?
D: Er starb vor langer Zeit. Vor hundert Jahren.
Dr.: Wirst du auch lange leben?
D: Hundert Jahre.
Dr.: Also was?
D: Ich werde vielleicht sterben.
Dr.: Alle Menschen sterben.
D: Ja, ich auch.
Dr.: Das ist traurig.
D: Ich muss es trotzdem.
Dr.: Du musst?
D: Sicher, mein Vater wird sterben. Das ist traurig.
Dr.: Warum?
D: Kümmern Sie sich nicht drum.
Dr.: Du möchtest nicht darüber sprechen.
D: Ich will jetzt zu meiner Mutter.
Dr.: Ich werde dich zu ihr bringen.
D: Ich weiß, wo tote Menschen sind. Auf Friedhöfen. Mein alter Großvater ist tot. Er kann da nicht mehr weg.
Dr.: Du meinst, von wo er begraben ist.
D: Er kann da nicht mehr weg. Niemals.31
Melanie Klein kommt aufgrund ihrer Erfahrungen bei der Analyse von Kindern zu dem Schluss, dass die sehr jungen Kinder eine intime Beziehung zum Tod haben – eine Beziehung, die sehr viel früher einsetzt als das begriffliche Wissen über den Tod. Die Furcht vor dem Tod ist, so stellt Klein fest, ein Teil der frühesten Lebenserfahrung des Kleinkindes. Sie akzeptiert Freuds Theorie aus dem Jahr 1923, dass es einen universellen unbewussten Todestrieb gibt, aber sie argumentiert, dass, wenn das menschliche Wesen überleben soll, es eine diesen ausgleichende Furcht vor dem Verlust des Lebens geben muss. Klein betrachtet die Furcht vor dem Tod als die ursprüngliche Quelle der Angst; sexuelle Angst und Über-Ich-Angst sind daher Nachzügler und abgeleitete Phänomene.
Meine analytischen Beobachtungen zeigen, dass es im Unbewussten eine Furcht vor der Vernichtung des Lebens gibt. Ich würde auch meinen, dass, wenn wir die Existenz des Todesinstinkts annehmen, wir auch annehmen müssen, dass es in den tiefsten Schichten des Geistes eine Antwort auf diesen Instinkt gibt, in Form einer Furcht vor der Vernichtung des Lebens. Die Gefahr, die aus dem inneren Wirken des Todesinstinkts hervorgeht, ist die erste Ursache der Angst … die Furcht davor, verschlungen zu werden, ist ein unverhüllter Ausdruck der Furcht vor totaler Vernichtung des Selbst … Die Furcht vor dem Tod dringt in die Kastrationsangst ein und ist ihr nicht »analog« … Da die Reproduktion der wesentliche Weg ist, dem Tod entgegenzuwirken, würde der Verlust der Genitalien das Ende der kreativen Kraft bedeuten, die das Leben erhält und weiterführt.32
Kleins Argument, dass die Besorgnis um die Reproduktion aus der Todesfurcht fließt, ist, glaube ich, schlagkräftig und stellt die traditionellen analytischen Ansichten dessen, was »primär« im geistigen Leben des Individuums ist, infrage. Kurt Eissler, der früh in der psychoanalytischen Bewegung intensiv über den Tod nachdachte, kam zu der Schlussfolgerung, dass die frühe Beschäftigung des Kindes mit Sexualität eine abgeleitete Fragehaltung ist, sekundär zu einer früheren und erschreckenden Bewusstheit des Todes:
Verfeinerte Forschung auf diesem Gebiet könnte zeigen, dass die Erforschung der generativen Prozesse (das heißt der »Tatsachen des Lebens«) durch das Kind eine Neuauflage einer früheren und kurz andauernden Erforschung des Todes ist. Möglicherweise wendet sich das Kind von solcher Erforschung wegen der sie begleitenden Schrecken ab und wegen der äußersten Hoffnungslosigkeit und darauf folgenden Verzweiflung hinsichtlich irgendeines möglichen Fortschritts bei dieser Erkundung.33
Andere Autoren, die Kinder genau beobachtet haben, sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass das junge Kind unabhängig davon, ob es intellektuell in der Lage ist, den Tod zu verstehen, doch das Wesen der Sache begreift. Anna Freud, die mit jungen Kindern während des deutschen Luftangriffs auf London arbeitete, schrieb: »Man kann mit Sicherheit sagen, dass alle Kinder, die zur Zeit des Luftangriffs auf London über zwei Jahre alt waren, sich bewusst waren, dass die Häuser einstürzen, wenn sie bombardiert werden, und dass die Menschen in den einstürzenden Häusern oft getötet oder verletzt werden.«34 Sie beschrieb ein viereinhalbjähriges Kind, das den Tod ihres Vaters erkannte: Die Mutter des Kindes wollte den Tod des Vaters ihren Kindern gegenüber verleugnen, aber das Kind bestand darauf: »Ich weiß alles über meinen Vater. Er ist getötet worden und wird niemals zurückkommen.«
Furman arbeitete mit einer großen Zahl von Kindern, die ein Elternteil verloren hatten, und sie zog den Schluss, dass die Kinder während ihres zweiten Lebensjahres ein grundlegendes Verständnis des Todes erlangen könnten. Das Verständnis des Todes wird durch irgendeine Art früher Erfahrung vergrößert, die dem Kind hilft, die notwendigen geistigen Kategorien zu bilden. Furman zitiert das folgende Beispiel:
Suzie war kaum drei Jahre alt, als ihre Mutter starb. Bald nachdem ihr diese traurige Nachricht überbracht wurde, fragte Suzie: »Wo ist Mami?« Ihr Vater erinnerte sie an den toten Vogel, den sie vor nicht allzu langer Zeit gefunden und begraben hatten. Er erklärte, dass auch Mami gestorben war und begraben werden musste. Er würde ihr zeigen wo, wann immer Suzie das wünschte. Einen Monat später berichtete Suzie ihrem Vater: »Jimmy (der sechs Jahre alte Sohn des Nachbarn) hat mir erzählt, dass meine Mami bald wiederkommen würde, weil seine Mami es so gesagt hat. Ich sagte ihm, dass das nicht wahr ist, weil meine Mami tot ist, und wenn du tot bist, dann kannst du niemals zurückkommen. Das stimmt, Vati, nicht wahr?«35
Eine Mutter berichtete das folgende Gespräch mit einem Kind im Alter von drei Jahren und neun Monaten:
Jane hat keine religiöse Unterweisung erhalten und ist bis jetzt niemals dem Tod in Verbindung mit irgendeinem menschlichen Wesen aus ihrem Bekanntenkreis begegnet. Vor ein paar Tagen begann sie, mir Fragen über den Tod zu stellen. …Das Gespräch begann damit, dass Jane fragte, ob Menschen im Frühling wie die Blumen zurückkehren würden. (Etwa vor einer Woche war sie sehr aufgeregt gewesen, weil ihre Lieblingsblume abgestorben war, und wir hatten sie getröstet, indem wir ihr sagten, dass sie im Frühling zurückkehren würde.) Ich antwortete, dass sie nicht in der gleichen Weise zurückkämen, sondern anders, möglicherweise als Babys. Diese Antwort verwirrte sie offensichtlich – sie hasst Veränderung, und dass die Menschen alt werden –, denn sie sagte: »Ich möchte nicht, dass Nan anders ist, ich möchte nicht, dass sie sich verändert und alt wird.« Dann: »Wird Nan sterben? Werde ich auch sterben? Stirbt jeder?« Als ich ›ja‹ sagte, brach sie in wirklich herzzerbrechendes Weinen aus und sagte immer wieder: »Aber ich will nicht sterben, ich will nicht sterben …« Sie fragte dann, wie die Menschen sterben, ob es weh tun würde, ob sie ihre Augen wieder öffnen würden, wenn sie tot wären, ob sie sprächen, äßen und Kleider trügen. Plötzlich mitten in all diesen Fragen und Tränen sagte sie: »Jetzt will ich weiter meinen Tee trinken«, und die Angelegenheit war für dieses Mal vergessen.36
Es ist interessant, die beunruhigten, unsicheren Antworten von dieser Mutter zu bemerken, der es kurze Zeit vorher ohne große Schwierigkeiten gelungen war, die Fragen ihrer Tochter nach der Geburt und wo die Babys herkämen zu beantworten. Sie beendete den vorhergehenden Bericht: »Ich war völlig überrascht. Obwohl ich die Fragen über Geburt und so weiter erwartete, hatte ich nicht an jene über den Tod gedacht, und meine eigenen Gedanken waren sehr unklar.« Offensichtlich nimmt ein Kind die Angst und Verwirrung solch eines Elternteils zusammen mit jeder verbalen Beschwichtigung, die der Elternteil anbieten mag, wahr. Andere Berichte über die Gespräche mit Eltern geben uns eine Ahnung von der Furcht und Neugier eines Kindes bezüglich des Todes. Zum Beispiel:
Kürzlich hat Richard (5 Jahre, 1 Monat) über das Sterben zu jammern angefangen und fühlte sich schlecht. Gestern, als er in seiner Badewanne herumschwamm, spielte er mit der Möglichkeit, niemals zu sterben, tausend Jahre zu leben. Heute sagt er: »Ich könnte allein sein, wenn ich sterbe, wirst du bei mir sein?« »Aber ich will niemals tot sein; ich will nicht sterben.« Einige Tage zuvor hatte ihm seine Mutter, als er sich zu fürchten schien, weil er nicht wusste, wie man stirbt, erzählt, er brauche sich keine Sorgen zu machen, weil sie zuerst sterben würde, und so würde er wissen, wie man das macht. Das schien ihn zu beruhigen.37
In einem kontroversen Aufsatz stellt Adah Maurer einige faszinierende Spekulationen über die frühe Bewusstheit des Todes bei Kleinkindern an.38 Die erste Aufgabe des Kleinkindes ist es, so argumentiert Maurer, zwischen Selbst und Umgebung zu differenzieren – das Sein als das Gegenteil des Nicht-Seins zu kennen. Während das Baby zwischen Bewusstsein und Unbewusstheit hin und her pendelt, zwischen Schlaf und Wach-Sein, bekommt es einen Sinn für diese beiden Zustände. Welches ist die geistige Erfahrung eines Kleinkindes während eines nächtlichen Schreckens? Maurer schlägt vor, dass das Kleinkind vielleicht Furcht und die Bewusstheit des Nicht-Seins erfährt. Während es in einem dunklen ruhigen Raum liegt und sowohl des Seh- als auch des Hörvermögens beraubt ist, ist das Kleinkind vielleicht durch eine halbwache körperlose Empfindung in Panik versetzt. (Max Stern, der nächtliches Erschrecken untersuchte, kam zu einer ähnlichen Schlussfolgerung: Das Kind ist erschrocken vor dem Nichts.39)
Warum hat das Kleinkind Spaß an dem Spiel, Spielzeug von einem Kindersitz aus herunterzuwerfen? Das Kind, das einen Partner finden kann, der mitmacht und das Spielzeug zurückgibt, wird im Allgemeinen das Spiel fortführen, bis der Partner ermüdet aufgibt. Vielleicht stammt diese Freude aus einem erotischen Vergnügen an muskulärer Bewegung; vielleicht ist es eine Manifestation dessen, was Robert White den Trieb nach »Effektanz« nennt – das innewohnende Vergnügen, seine Umwelt zu beherrschen.40 Maurer behauptet, dass das Kleinkind von dem Verschwinden und Wiedererscheinen fasziniert ist, welches in den Gedanken und den Verhaltensweisen, die dem Kind zur Verfügung stehen, materielle Symbole des Begriffs von Sein und Nicht-Sein darstellen.41 Tatsächlich kann Whites Effektanztrieb ein Abkömmling des Versuchs des Kindes sein, Nicht-Sein zu besiegen. Diese Spekulationen stimmen mit einer großen Fülle von Literatur über die »Objektbeständigkeit« in der Kindesentwicklung überein, deren gründliche Erörterung mich zu weit weg führen würde. Kurz jedoch heißt das, dass das Kind das Verschwinden eines Objektes nicht schätzt, bis es seine Beständigkeit hergestellt hat. Beständigkeit hat keine Bedeutung ohne die Wertschätzung von Wandel, Zerstörung oder Verschwinden; deshalb entwickelt das Kind das Konzept von Beständigkeit und Wandel zusammen.42 Darüber hinaus gibt es eine enge Beziehung zwischen Objektbeständigkeit und einem Sinn für Selbstbeständigkeit; die gleiche Art von Oszillieren, die Kopplung von Beständigkeit (Belebtheit, Sein) und Verschwinden (Nicht-Sein, Tod) ist wesentlich für die Entwicklung des Kindes.
»Alles weg« ist einer der ersten Sätze im Vokabular des Kindes, und »alles weg« ist ein allgemeines Thema in den Kindheitsängsten. Die Kinder bemerken, wie ein Huhn zur Mittagszeit verschwindet; oder wie das Badewasser wegfließt, wenn der Stöpsel einmal gezogen ist; oder wie die Fäkalien weggespült werden. Es gibt kaum ein Kind, welches nicht fürchtet, verschlungen, weggespült oder durch das Abflussrohr eingesaugt zu werden. Die analytische Literatur bemerkt die unbewusste Gleichsetzung von Fäkalien und Leichnam.43 Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Psychotherapeuten die Dynamik der Sauberkeitserziehung neu überdenken, denn in ihr scheint mehr enthalten zu sein als analer Erotizismus oder trotziger Widerstand: Für das Kind löst die Sauberkeitserziehung die Ängste im Zusammenhang mit physischer Integrität und Überleben aus. Wenn das Kind sich bewusst wird, dass ewige Wiederkehr verschwundener Gegenstände nicht das Übliche ist, dann sucht es nach anderen Strategien, um sich vor der Bedrohung des Nicht-Seins zu schützen. Das Kind wird zum Meister statt zum Opfer des »alles weg«. Das Kind zieht den Badewannenstöpsel heraus, spült Dinge die Toilette hinunter und bläst Streichhölzer freudig aus, es freut sich, wenn es der Mutter helfen kann, indem es auf das Pedal des Mülleimers tritt. Später verbreitet das Kind den Tod entweder symbolisch in Cowboy- und Indianer spielen oder wörtlich, indem es das Leben von Insekten auslöscht. Tatsächlich hielt Karen Horney die Feindseligkeit und Zerstörungswut eines Kindes für direkt proportional zum Ausmaß, in dem dieses Kind das Gefühl hat, dass sein Überleben in Gefahr ist.