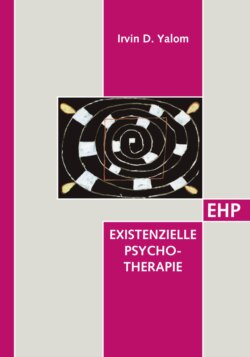Читать книгу Existenzielle Psychotherapie - Irvin D. Yalom - Страница 50
Die Todeserziehung von Kindern
ОглавлениеViele Eltern, vielleicht die meisten in unserer Kultur, versuchen, die Realitätswahrnehmung in der Todeserziehung schrittweise zu erhöhen. Junge Kinder werden vor dem Tod abgeschirmt; sie werden ausdrücklich fehlinformiert; die Verleugnung wird ihnen früh im Leben eingegeben mit Geschichten vom Himmel oder von der Wiederkehr der Toten oder mit der Versicherung, dass Kinder nicht sterben. Später, wenn das Kind »bereit ist, es anzunehmen«, erhöhen die Eltern allmählich die Dosis an Realität. Gelegentlich nehmen aufgeklärte Eltern einen dezidierten Standpunkt gegen Selbsttäuschung ein und weigern sich, ihren Kindern die Verleugnung der Realität beizubringen. Sie finden es jedoch schwierig, auf das Angebot von Trost durch irgendeine realitätsnegierende Versicherung zu verzichten – entweder eine schlichte Verleugnung der Sterblichkeit oder einen Mythos über eine lange Reise nach dem Leben –, wenn ein Kind erschreckt oder gequält ist.
Elisabeth Kübler-Ross missbilligt die traditionelle religiöse Praxis, Kinder mit »Märchen« über den Himmel, Gott und die Engel zu indoktrinieren, scharf. Aber wenn sie ihre Arbeit mit Kindern beschreibt, die über den Tod besorgt sind – ihren eigenen oder den ihrer Eltern –, ist es offensichtlich, dass auch sie Trost anbietet, der auf Verleugnung gründet. Sie informiert die Kinder, dass man im Augenblick des Todes transformiert oder befreit wird »wie ein Schmetterling« für eine tröstliche verheißungsvolle Zukunft.81 Obwohl Kübler-Ross darauf besteht, dass dies nicht Verleugnung, sondern Realität ist, die auf objektiver Forschung über Erfahrungen nach dem Tode basieren, bleibt der empirische Beweis unveröffentlicht. Die gegenwärtige Position dieser bemerkenswerten Therapeutin, die sich dem Tod unerschrocken stellte, weist darauf hin, wie schwierig es ist, sich mit dem Tod ohne Selbsttäuschung auseinanderzusetzen. Soweit ich es beurteilen kann, unterscheiden sich die »objektiven Daten« von Kübler-Ross nicht in bedeutsamer Weise vom traditionellen religiösen »Wissen« durch Glauben.
Es gibt in unserer westlichen Kultur klare Erziehungsrichtlinien für solche Bereiche wie physische Entwicklung, Informationsaneignung, soziale Fähigkeiten und psychologische Entwicklung; aber wenn die Todeserziehung ansteht, sind die Eltern weitgehend auf sich selbst gestellt. Viele andere Kulturen bieten einige kulturell akzeptierte Mythen über den Tod an, die den Kindern ohne Ambivalenz oder Angst übermittelt werden. Unsere Kultur bietet keine erkennbaren Richtlinien an, denen Eltern folgen könnten; trotz der Allgemeingültigkeit des Themas und seiner entscheidenden Bedeutung in der Entwicklung des Kindes, muss jede Familie nolens volens entscheiden, was sie ihren Kindern beibringt. Oft werden den Kindern Informationen gegeben, die obskur sind, vermischt mit elterlicher Angst, und die wahrscheinlich im Widerspruch zu anderen Informationsquellen in der Umgebung stehen.
In den Reihen professioneller Erzieher herrscht extreme Uneinigkeit über die Todeserziehung. Anthony empfiehlt, dass die Eltern die Realität dem Kind gegenüber verleugnen sollten. Sie zitiert Sandor Ferenczi, der sagte, dass »die Verneinung der Realität eine Übergangsphase zwischen dem Ignorieren und dem Akzeptieren der Realität ist«, und er behauptet, dass das Versagen der Eltern bei der Unterstützung der Verleugnung seitens des Kindes zu »einer Neurose führen kann, in der Todesassoziationen eine Rolle spielten.«82 Anthony fährt fort:
Die Argumente für die Unterstützung der Realitätsakzeptanz sind stark. Trotzdem gibt es in diesem Zusammenhang eine Gefahr. Das Wissen, dass die Verleugnung selbst das Akzeptieren erleichtert, kann die Aufgabe der Eltern vielleicht weniger schwer machen. Sie mögen die Anklage der Unzuverlässigkeit, des Lügens vorausahnen, wenn das eigene Bedürfnis des Kindes nach Verleugnung vorbei ist. Wenn sie offen angeschuldigt werden, können sie antworten: »Du konntest es damals nicht annehmen.«83
Andererseits akzeptieren viele professionelle Erzieher die Ansicht Jerome Bruners, dass »jedes Thema auf irgendeine intellektuell ehrliche Weise ei nem Kind in jedem Entwicklungsstadium wirkungsvoll beigebracht werden kann«,84 und versuchen, dem Kind bei einem allmählichen realistischen Verständnis des Todesbegriffs behilflich zu sein. Euphemismen (»schlafen gegangen«, »in den Himmel gegangen«, »bei den Engeln«) sind »hauchdünne Barrikaden gegen Todesängste und verwirren das Kind nur.«85 Die Angelegenheit zu ignorieren, führt zu einem Narrenparadies für die Eltern: Die Kinder kümmern sich dann sehr wohl weiter um das Thema und finden, wie auch beim Sex, andere Informationsquellen, die oft unzuverlässig oder sogar furchterregender oder bizarrer als die Realität sind.
Zusammengefasst gibt es überzeugende Beweise, dass Kinder den Tod in einem frühen Alter entdecken, dass sie befürchten, dass ihr Leben schließlich ausgelöscht wird, dass sie dieses Wissen auf sich selbst anwenden und dass sie als Ergebnis dieser Entdeckung große Angst erleiden. Eine Hauptentwicklungsaufgabe ist es, mit dieser Angst umzugehen, und das Kind tut dies hauptsächlich auf zwei Wegen: indem es die unerträgliche objektive Realität des Todes verändert, und indem es innere subjektive Erfahrungen verändert. Das Kind verleugnet die Unausweichlichkeit und Dauerhaftigkeit des Todes. Es schafft Unsterblichkeitsmythen – oder übernimmt dankbar Mythen, die Ältere ihm anbieten. Das Kind verleugnet auch seine Hilflosigkeit vor der Gegenwart des Todes, indem es die innere Realität verändert: Das Kind glaubt an seine persönliche Besonderheit, Allmacht und Unverletzlichkeit und an die Existenz von irgendeiner äußeren persönlichen Kraft oder einem Wesen, das es vom Schicksal, das alle anderen erwartet, erlösen wird.
»Es ist nicht so bemerkenswert,« wie Rochlin schreibt, »dass Kinder zu den erwachsenen Ansichten über die Beendigung des Lebens gelangen, sondern vielmehr, wie hartnäckig Erwachsene ihr ganzes Leben lang an den Vorstellungen des Kindes festhalten und wie bereitwillig sie zu ihnen zurückkehren.«86 Die Toten sind daher nicht tot; sie ruhen, sie schlummern weiter in Gedenkstätten beim Klang ewiger Musik, sie erfreuen sich eines Lebens nach dem Tod, in welchem sie letztlich mit ihren geliebten Menschen wieder vereinigt werden. Und unabhängig davon, was anderen geschieht, verleugnet man den Tod als Erwachsener vor sich selbst. Die Verleugnungsmechanismen sind in unseren Lebensstil und unsere Charakterstruktur eingebettet. Zur Last des Menschen als Erwachsener genauso wie zu der des Kindes gehört es, mit der persönlichen Endlichkeit umzugehen; und das Studium der Psychopathologie, der ich mich jetzt zuwenden werde, ist das Studium misslungener Todestranszendenz.