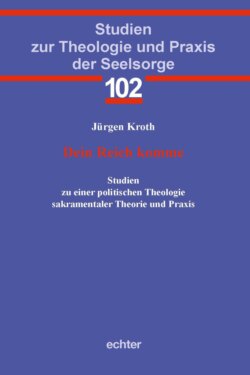Читать книгу Dein Reich komme - Jürgen Kroth - Страница 10
Оглавление1. Innenansichten der pastoralen Praxis im Allgemeinen
In der Praktischen Theologie haben sich in den letzten Jahren vielfältige Entwürfe präsentiert, die pastorale Praxis hilfreich weiterzuentwickeln, zu profilieren, inhaltlich zu qualifizieren und zeitgemäß zu artikulieren. Ob es sich dabei um eine aufsuchende, kooperative1, diakonische2, kommunikationstheoretisch fundierte3, religionskritische4, missionarische5, mystagogische6, milieusensible7, lebensdienliche8, heilende9, befreiende10 Pastoral oder um City- und Passantenpastoral11, eine Pastoral der Zwischenräume12, Sozialpastoral13 etc. handelt14, es gibt eine auffällige Schwierigkeit all dieser Ansätze, mit konkreter Gemeindepastoral sich zu vermitteln. Es scheint geradezu, die kirchliche Praxis verfüge über ein recht hohes Maß an Rezeptionsmüdigkeit oder Resistenz, sich neuen Ansätzen aufzuschließen. Es entsteht der Eindruck, es bedürfe eines hauptamtlichen Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin, die sich einer der Pastoralstrategien verpflichtet weiß und die mit viel Engagement, Begeisterungs- und Überzeugungsfähigkeit in der Lage ist, ein handlungsleitendes Prinzip in der Pastoral zu etablieren. Es scheint zugleich ein gehöriges Druckpotential nötig zu sein – sei es durch eine rapide Abnahme des Gottesdienstbesuches, der Erosion von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, oder aber eher durch Veränderungen des hauptamtlichen Personalschlüssels in Gestalt von Stellenreduzierungen, des Priestermangels, der Zusammenlegung von Pfarreien, grundlegenden Änderungen der diözesanen Richtlinien uvm. –, damit Kirchengemeinden ihre pastorale Ausrichtung prüfen und gegebenenfalls neu justieren.
Nun ist aber auch eine andere Interpretation möglich: Es wäre schließlich auch denkbar, dass hinter den vielfältigen pastoraltheologischen Ansätzen sich das postmodernistische Phänomen radikaler Pluralität verbirgt, dass es also vermeintlich unterschiedliche und durchaus alle auch gleich gültige Möglichkeiten pastoraler Praxis gibt. Dahinter aber bildet sich das größere Problem der inhaltlichen Konturlosigkeit einer Pastoral ab, die nicht mehr kritisch fragt, was ihre Sache sein muss, sondern im Erfinden immer neuer Zugänge Gefahr läuft, ihren Kern zu verlieren. Es bleibt daher auch zu fragen, was denn das theologische Proprium der unterschiedlichen pastoraltheologischen Ansätze darstellt.15 Gerade dem will die theologische Fokussierung auf das Reich Gottes nachgehen und die Sakramentenpastoral theologisch und praxisrelevant fundieren.
Wahrscheinlich bleiben Kirchengemeinden als Trägerinnen der Pastoral lange geltenden, inzwischen kritisch zu beurteilenden Prinzipien treu, weil sie unfähig oder gehindert werden, die veränderten Bedingungen pastoraler Praxis zu erkennen und adäquat zu handeln; am meisten aber, weil sie nicht in der Lage sind, einen Ansatz zu entwickeln, der erkennen ließe, dass und inwiefern kirchliches Handeln relevant ist für die Gestaltung der Welt. Darauf zu verzichten, würde aber einen Verzicht auf das Ganze bedeuten.
1.1 Binnenbezogenheit
Es war schon eine der wenigen Ausnahmen, als das Bistum Basel 1993 ein Arbeitsinstrument mit dem bezeichnenden biblischen Titel „Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit“16 veröffentlichte und damit eine Perspektive eröffnete, das Handeln der Kirche in und mit der Welt zu vermitteln und dabei durchaus (gesellschafts-) kritische Fragen anstieß, die auch heute noch zu fruchtbaren Diskussionen und Handlungsoptionen führen können. Allein, ein solches Arbeitsinstrument findet sich in den Pastoralabteilungen der deutschsprachigen Bistümer selten. Zwar beschritten viele Diözesen den Weg einer Überprüfung und ggf. auch der Veränderung der pastoralen Schwerpunkte. Die Motive dafür waren aber oftmals zugleich das erkenntnis- und handlungsleitende Prinzip selbst, nämlich einerseits die veränderte personale Ausstattung – vornehmlich aufgrund des Schwunds des Priesternachwuchses bei gleichzeitigem Anwachsen der Laientheologen im kirchlichen Dienst und hier vor allem der PastoralreferentInnen –, andererseits aber die Regression der finanziellen Mittel aufgrund einer hohen Dauerarbeitslosigkeit, aber auch die stetige Abnahme des Kirchenbesuchs und der aktiven Mitarbeit von Seiten Ehrenamtlicher oder gar rapide steigende Kirchenaustritte. Es soll hier nicht detailliert verfolgt werden, wie diese Entwicklungen zustande kamen und wie sie zu bewerten sind.17 Aber selbst von den Verantwortlichen für die Neuformulierung der Pastoralpläne, die es in den bundesdeutschen Diözesen gibt, wird zugestanden, es handele sich zwar nicht ausschließlich, aber doch auch um „ein Notprogramm, um den Priestermangel aufzufangen. Dieser mag gewiss den Anstoß zu entsprechenden Überlegungen gegeben haben“18. Dabei wird immerhin zugleich betont, der Horizont, in dem die Pastoral stattfinde, sei nicht mehr der kirchliche Binnenraum, sondern das Reich Gottes19. Das wird aber faktisch gleich wieder zurückgenommen, wenn in der theologischen Grundlegung nicht die Priester alleine, sondern alle Gläubigen am Aufbau der Kirche, nicht also des Reiches Gottes, Anteil haben.20 In ähnlicher Weise argumentiert Bischof Marx in seinem Beitrag zum Studientag der Deutschen Bischofskonferenz, „bei aller lebensweltlichen Einbindung“ müsse sich der Priester der Zukunft „doch auf die ‚sakramentale Nähe’ konzentrieren […]. Das ist es, was die Menschen vom Priester erwarten: dass er Zeichen der Nähe Gottes ist, auch wenn manche Menschen das so nicht aussprechen.“21 Besonders interessant ist die Binnenfixierung bei gleichzeitiger semantischer Außenorientierung. Unter dem Leitgedanken der wachsenden Mobilität in der Gesellschaft versuchen pastorale Erneuerungen nämlich dieser Außenorientierung Rechnung zu tragen und verstehen „Mobilität als pastorale Herausforderung“22. Sie sei, so Franz-Peter Tebartz-van Elst, geradezu ein Zeichen der Zeit, das es heute zu erfassen gelte und angesichts dessen sich Kirche verhalten müsse. Entlarvend aber bleibt auch hier die weitere Argumentation, in der die Gesellschaftsanalyse vermittels der Zeichen der Zeit und die theologische Reflexion wieder entkoppelt werden und erst recht die Perspektive auf das Reich Gottes unterlaufen wird, wenn Tebartz-van Elst davon ausgeht, Kirche sei „zuerst Gabe Gottes in der Wirkkraft und Lebendigkeit des Heiligen Geistes“23. Es stellt sich nämlich hierbei der Verdacht ein, es gebe eine Priorität, nämlich zuerst Kirche sein zu können und dann erst sich den gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen. Das aber widerspräche grundlegend der Einsicht, Kirche sei „Zeichen und Werkzeug“ (LG 1) des Heiles, also das „im Mysterium schon gegenwärtige[n] Reich Christi“ (LG 3).
Von einer ganz anderen Seite verstärkt sich noch der Eindruck, alle pastorale Erneuerung drehe sich letztlich doch immer um sich selbst, was freilich der Pastoral doch gänzlich entgegensteht, muss es dem kirchlichen Handeln doch immer um die Anderen gehen und nie nur um die Kirche selbst. Dass sich dies noch präziser entfalten ließe, versteht sich von selbst, soll aber hier unter Hinweis auf die jeweiligen Konkretionen im Sinne einer pastoraltheologischen Option für die Armen und der besonderen Wahrnehmung des Leids der/des Anderen an einer späteren Stelle der Arbeit unterbleiben.24 So bemerkenswert nämlich der – zumindest angedeutete – Versuch der deutschen Kirche ist, gesellschaftlichen Veränderungen mit einer Veränderung der Pastoral zu begegnen, so sehr hinterlässt er Irritationen, wenn in der konkreten Durcharbeitung stets die Frage im Hintergrund steht, mit welchem priesterlichen Personal dies denn alles geschehen könne. Damit kein Missverständnis entsteht: Selbstverständlich muss diese Frage gestellt werden. Wenn sie aber zum geheimen Mittelpunkt der pastoralen Planung wird und wenn zugleich die inhaltliche Zuordnung innerhalb der pastoralen Praxis auf die Vermittlung der Nähe Gottes konzentriert wird, dann wird getrennt, was nicht getrennt werden darf, nämlich die Sakramente und die Lebenswelt, in die sie einzubinden sind. Sakramente, die jenseits der konkreten Lebenswelt das kirchliche Leben prägen oder diesem voraus liegen, lösen den Spender der Sakramente gleichfalls aus dieser heraus und verlängern damit gleichsam die vermeintlich vor der Auseinandersetzung mit der Welt liegende Aufgabe des Priesters.
Selbstverständlich gibt es durchaus pastorale Tendenzen, die eine weiterführende Perspektive andeuten, etwa wenn im Bistum Mainz gefordert wird, die Reformen evangeliums- und zeitgemäß zu gestalten seien25, oder im Erzbistum Berlin die Erneuerung der Pastoral theologisch so durchdacht wird, dass sie den Zeitumständen Rechnung zu tragen kann. Dies alles wird aber immer wieder konterkariert durch sofortige Relativierungen und auch hier spielt vermittels des Personal-, genauer gesagt des Priestermangels, die binnenkirchliche Perspektive eine besondere Rolle, denn „die quantitative Kürzung der kirchlichen Dienste muss mit einer Konzentration auf Kernaufgaben bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung einher gehen“26.
Es hat sich etwas geändert in der pastoralen Planung der Kirche. Noch vor 20 Jahren konnte Johann Baptist Metz reklamieren: „Ein defensives Sicherheitsdenken, eine betont defensive Form der Rettung von Tradition scheint sich – von Rom aus – in der Gesamtkirche auszubreiten. Dieser defensive Tutiorismus macht sich nicht zuletzt an jenen unübersichtlichen Schwierigkeiten und Widersprüchen fest, die sich in einer solchen Aufbruchsituation zeigen und die auch nicht zu leugnen sind.“27 Nicht mehr defensives Sicherheitsdenken, sondern offensive Neuorientierung scheint der Maßstab zu sein. Der Preis, der dafür gezahlt wird, ist aber hoch: Er besteht in der immer stärker werdenden inhaltlichen Diffusion, in einer pastoralen Pragmatik, die theologische Grundperspektiven kirchlichen Handelns Praktikabilitäts- und mehr noch Finanzierungs- und Personalplanungsgesichtspunkten unterwirft. Angesichts dieser Entwicklung wäre der „defensive Tutiorismus“ fast noch einmal produktiv, er böte wenigstens inhaltliche Streitpunkte. Wie auch immer: Gegen eine binnenkirchliche Reduktion wäre noch einmal Karl Rahner produktiv aufzubieten, der auf eine „offene Kirche“ drängt, „nicht ins Beliebige hinein offen, sondern offen im Widerstand gegen eine aufkeimende Abschließungsmentalität, gegen eine sich abzeichnende Sektenmentalität in der Kirche“28. Es lohnt, die kurzen Überlegungen von Metz zum „Strukturwandel“ noch einmal in Erinnerung zu rufen:
„Doch nicht die Minorität, sondern die Mentalität definiert die Sekte in einem theologischen Sinn. Minorität braucht die Kirche weder zu fürchten noch sich ihrer zu schämen, es sei denn, man hielte sie für die innerweltliche Vollstreckerin der von ihr bezeugten universalen Heilsgeschichte und mißverstehe sie so als eine ihre eigene Hoffnung ersetzende religiöse Geschichtsideologie, in der die eschatologische Differenz zwischen Kirche und Reich Gottes unterschlagen ist. Fürchten aber muß die Kirche die Symptome einer schleichenden Sektenmentalität […]: den Trend zum Fundamentalismus, zum puren Traditionalismus; die wachsende Unfähigkeit bzw. Unwilligkeit, neue Erfahrungen zu machen und sie in schmerzlich-kritischer Assimilation in das Selbstverständnis der Kirche einzubauen; dazu die zelotisch angeschärfte Sprache und eine verständigungsunfähige Militanz bei innerkirchlichen Auseinandersetzungen; die Verwechslung von Kirchlichkeit mit einem freud- und humorlosen Zelotentum; die Ausbreitung eines Loyalitätsüberdrucks bzw. der Anzeichen von Überängstigung im kirchlichen Leben; der Drang, sich nur unter Gleichgesinnten aufzuhalten, die Gefahr einer künstlichen Isolation der Verkündigungssprache, die zur reinen Binnensprache wird mit einer typischen Sektensemantik usw.“29
Bei all dem ist deutlich, dass die pastoralen Erneuerungsprozesse zwar semantisch eine Bewegung nach außen hin versuchen, dies aber weder inhaltlich noch in der pastoralen Konkretion hinreichend vermögen.
1.2 Betreuungsperspektive
Hinsichtlich des nächsten Aspekts scheint die pastorale Entwicklung zwar in ihren konzeptionellen Beschreibungen deutliche Schritte nach vorn gegangen zu sein, ob sich damit allerdings auch wirkliche Veränderungen der pastoralen Grundperspektiven verbinden lassen, darf bezweifelt werden. Immerhin heisst es im Synodenbeschluss „Dienste und Ämter“: „Aus einer Gemeinde, die sich pastoral versorgen läßt, muß eine Gemeinde werden, die ihr Leben im gemeinsamen Dienst aller und in unübertragbarer Eigenverantwortung jedes einzelnen gestaltet.“30 Genau dies scheinen die neuen pastoralen Entwicklungen auch anzuzielen, wenn sie darauf abheben, dass zum einen veränderte personelle Rahmenbedingungen, verbunden mit finanziellen Einsparungsanforderungen, zum anderen aber auch ein anderes Mobilitätskonzept der Menschen Möglichkeiten eröffnen soll, den Versorgungsaspekt der überkommenen Pastoral zu überwinden und neue Partzipationschancen zu gewähren. Nun kann aber schon für den Synodenbeschluss selbst die kritische Rückfrage gestellt werden, ob es denn wirklich um eine Schaffung weitreichender Beteiligungsmöglichkeiten geht, wenn der anschließende Satz dort lautet: „Sie [die Gemeinde] muß selbst mitsorgen, junge Menschen für das Priestertum und für alle Formen des pastoralen Dienst zu gewinnen.“31 Wiederum geht es – nicht ausschließlich, aber doch in besonderer Weise – um Rekrutierungsprozesse ad intra. Offensichtlich sorgt sich doch die Kirche letztlich um die rechte Versorgung der Gemeinden, bei gleichzeitiger Bestreitung dieses Paradigmas.
Wenn aber dies das untergründige Handlungsinteresse sein sollte, dann wäre zum einen zu fragen, wenn doch der Weg von der versorgten zur sorgenden Gemeinde grundlegend ist, warum hier kirchliche Mitarbeiter – zunächst unabhängig davon, ob Priester oder Laie – eine solch zentrale Stelle innehaben; was also dadurch gewonnen werden soll, dass nicht auf die freie Mitarbeit aller Christgläubigen, sondern auf eine Hauptamtlichenstruktur gesetzt wird. Wird damit nicht auch eine wichtige Kontrollmöglichkeit prolongiert? Es ist auch zu fragen, ob nicht das handlungsleitende Prinzip noch immer hierarchisch strukturiert ist, so dass die Erneuerung der Kirche wesentlich von den primär geweihten, oder doch den daran Anteil habenden Hauptamtlichen abhinge. Traut die Kirche dem Geist Gottes wirklich, wenn sie in letzter Instanz den christfideles nicht traut und zentrale Aufgaben in den Gemeinden letztlich doch nur den Geweihten oder den daran Anteil Habenden zuspricht? Überwindet sie damit wirklich das, was schon vor vielen Jahren als Betreuungskirche gekennzeichnet wurde? Gewiss, ein einfacher Übergang von der Betreuungskirche hin zu einer Basiskirche, wie dies schon 1980 gefordert wurde32, ist wohl nicht in dem Maße möglich gewesen wie erhofft. Daran haben Leitungsentscheidungen ihren Anteil, insofern die bundesdeutsche Kirche bis heute den Anliegen einer basisgemeindlichen Erneuerung im Sinne befreiungstheologischer Grundintentionen reserviert bis ablehnend gegenübersteht, wenn und insofern dies auch mit einem theologischen und politischen Standortwechsel verbunden ist; sicherlich ebenso bedeutsam aber ist die Veränderungsunfreudigkeit der „Betreuten“ selbst, die gleichfalls auf vertraute Muster eher setzen, als neue Handlungs- und Sozialformen zu erproben. In vielen Fällen, wo basisgemeindliche Ansätze im Widerspruch zur Betreuungspastoral versucht wurden, endeten diese in der Frustration und der daran anschließenden Abwanderung der Reforminteressierten aufgrund des kirchlichen Festhaltens an den altvertrauten Strukturen und Inhalten. Hermann Steinkamp beschreibt dies triftig, wenn er resümiert: „Selbst wenn die Betreuten sich ändern, entsteht dadurch allein noch nicht Gemeinde! Und: die für das Dilemma der Betreuungs- und Service-Kirche ‚Verantwortlichen’ sind nicht (jedenfalls nicht allein und in erster Linie) die Betreuer (Pfarrer, Hauptamtliche). […] Das Syndrom [der Pfarrei als Ideologie; J.K.] besteht vielmehr aus einem geheimen Einverständnis einer großen Mehrheit der Pfarrei-Mitglieder und ihrer Seelsorger über einen Typus von Religionspraxis, der dem Angebot-Nachfrage-Dogma höhere Bedeutung zumißt als der Bergpredigt.“33
Es zeigt sich, dass dem Betreuungsparadigma eine Service-Mentalität entspricht, wobei letztere eine Weiterführung der ersteren ist. Die Betreuungspastoral stammt streng genommen noch eher aus einer volkskirchlichen Situation, während die Service- und Angebotspastoral eher schon einer bürgerlichen Religion und deren ekklesialen Ausprägungen entspricht. Gleichwohl gibt es Ähnlichkeiten in beiden Varianten, insofern ihr Leitgedanke nach wie vor die traditionelle Form kirchlicher Praxis präferiert, bzw. sich wesentlich an der Sozialform Pfarrei34 orientiert, wenngleich es innerhalb der Angebots- und Servicepastoral Übergänge hin zu einer gemeindlichen Struktur gibt. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob damit – wenn nicht wesentliche theologische Grundperspektiven zugleich geändert werden – sich auch wirklich eine Neuorientierung ergibt. Zwar ist die Weiterentwicklung der Pfarrei hin zu einer Gemeinde35, präziser vielleicht noch hin zu dem, was in Analogie zur lateinamerikanischen Wirklichkeit als Basisgemeinde zu kennzeichnen wäre, eine notwendige und unaufgebbare pastorale Forderung. Dem trägt auch die pastoraltheologische Diskussion um die Entwicklung von der Pfarrei hin zur Gemeinde Rechnung. Bildet sich dies aber in den pastoralen Entwürfen der bundesdeutschen Diözesen hinreichend ab? Wird nicht der Begriff Gemeinde schnell – und in den seltensten Fällen mit jener befreiungstheologischen Konnotation – genutzt, um zwar das Parochialprinzip zu verlassen, keinesfalls aber die Betreuungs- und Serviceperspektive dabei aufzugeben? Immerhin bietet diese Pastoral immer auch noch die Möglichkeit, machtförmige Strukturen unter veränderten Bedingungen am Leben zu erhalten. Diesen Strukturen werden alle pastoralen Neuansätze unter der Leitperspektive der Ämterfrage, über die an späterer Stelle noch Auskunft zu geben ist, unterworfen.
Schließlich gilt es noch zu erwähnen und später in der sakramentenpastoralen Fokussierung zu reflektieren, dass Service- und Betreuungspastoral auch hinsichtlich der Akteure sich gut ergänzen, wenn nämlich der deutlich marktförmigen Attitüde der Kirchenmitglieder eine Versorgungsreaktion der Pfarrer entspricht. Unausgesprochen, aber doch wirksam, ist der Glaube: ‚Für meine Kirchensteuer erwarte ich bestimmte Dienstleistungen.’36 Dies bildet sich insbesondere in den Sakramenten der Taufe und der Ehe ab, viel deutlicher aber vielleicht noch in den Kasualien bei bestimmten wichtigen Lebensabschnitten. In extremen Ausprägungen kann hier sogar von Warenförmigkeit gesprochen werden. Diese Tendenz zeigt sich schon seit einigen Jahren in der Enttäuschung von immer mehr Kirchenmitgliedern die sie zwar nicht offensiv äußern, sich aber dennoch danach verhalten, für ihre monetäre Leistung keine adäquate pastorale Versorgung (mehr) zu erhalten. Dabei ist zunächst unerheblich, ob es sich um eine reale oder um eine subjektiv so wahrgenommene Enttäuschung ihrer Erwartungen handelt.
Die Warenförmigkeit aber gibt es nicht nur von Seiten der Kirchenmitglieder; auch die Kirche verhält sich zunehmend marktkonform, wenn in ihr immer häufiger von „Kundenorientierung“, von „Angebotspalette“ und „Dienstleistungen“ gesprochen wird. Die Spitze dieser schleichenden Ökonomisierung der Pastoral war zuletzt in der vielfach beachteten Sinus-Milieu-Studie37 zu beobachten, die nicht nur für die Wirtschaft interessante Daten liefert, um zu wissen, wie sie ihre Produkte am erfolgreichsten absetzen kann, sondern auch in der Kirche ähnliche Fragen befördert, denn „die Frage steht im Raum, ob nicht auch die Kirche und ihr Agieren ‚marktgerechter’, in diesem Falle ‚milieugerechter’ werden muss“38, unter der durchaus wichtigen Einschränkung, dass das Evangelium eben keine Ware ist.39
1.3 Kirchlichkeit und Verkirchlichung
Es darf wohl als eine der bedeutendsten Leistungen des Zweiten Vatikanischen Konzils angesehen werden, die Kirche grundlegend mit der modernen Gesellschaft und ihren kognitiven Potentialen in Berührung gebracht zu haben. Damit ist auch der Geschichtlichkeit menschlicher Existenz Rechnung zu tragen wie auch ihrer gesellschaftlichen Verfasstheit.40 Das Konzil hat, freilich nicht unangefochten, aber dennoch deutlich, eine Neuorientierung des Kirchenverständnisses formuliert. Kirche ist seitdem immer als Kirche in der Welt zu verstehen, Theologie ist eine „Theologie der Welt“ (Metz); aber auch darum ranken sich seither beinahe endlose Richtungsstreitigkeiten. Es wäre zu erwarten gewesen, dass diese Begegnung der Kirche mit der Welt zu grundlegenden Veränderungen der Kirche selbst geführt hätte, und in vielen Bereichen der Weltkirche ist dies auch durchaus geschehen. Vor allem in den Ortskirchen der sogenannten Dritten Welt lassen sich viele Impulse hierfür finden. Aber auch in der bundesdeutschen Kirche kann die Gemeinsame Synode als Versuch gesehen werden, von der Dynamik des Konzils sich anstecken zu lassen. Gleichwohl lässt sich zugleich eine Tendenz zur Verkirchlichung41 des Christentums erkennen, die geradezu als Gegenbewegung zu einem aufgrund des Modernisierungsschubs zu beobachtenden Plausibilitätsverlusts der Kirche anzusehen ist. Einer Säkularisierung und Entzauberung der Gesellschaft steht eine Verkirchlichung des Christentums gegenüber. Infolgedessen wird das Christentum nunmehr fast ausschließlich als Amtskirche mit einer ganz klaren hierarchischen Ordnung wahrgenommen. Die Hauptakteure der Kirche sind konsequenterweise Hauptamtliche. In diese Tendenz ist auch die Entdeckung neuer pastoraler Berufsgruppen einzuordnen, die zwar in sich diesem Trend kritisch gegenüberstehen, weil sie ein sehr stark laikales Berufsverständnis ausgeprägt haben42. Sie konnten diesem Trend aber kaum eigene Widerstandskraft entgegenstellen und partizipieren inzwischen auch trefflich daran, wie sich jüngst gerade im Bistum Trier ablesen lässt, in dessen Verwaltung zentrale Direktorenstellen nunmehr von Pastoralreferenten besetzt sind. Auch auf der mittleren Ebene hat diese Berufsgruppe wichtige Positionen inne. Hier zeigt sich, dass die ursprüngliche Vermutung der Verkirchlichungsthese von Kaufmann, die Machtverteilung sei eindeutig hierarchisch, auch im Sinne der klerikalen Hierarchie, heute wenigstens auf der Ebene der kirchlichen Verwaltung aufgeweicht wurde, nicht aber, was die lehramtliche Dimension anbelangt.
Obwohl das Zweite Vatikanische Konzil die Kollegialität der Bischöfe deutlich stärkte, zeigt sich in der gegenwärtigen Verfassung der Kirche immer wieder eine andere, häufig gar gegenläufige, zentralistische Tendenz. Zwar wurden wichtige Partizipationsmöglichkeiten in Form von Laien- und Pastoralräten, synodalen Strukturen u.ä. geschaffen; die Letztentscheidung liegt jedoch immer noch in den Händen der Kleriker. Auch die Ortskirchen und die Ortsordinarien werden, wenn dies vermeintlich universalkirchliche Fragen betrifft, dem Jurisdiktionsprimat unterworfen.43
Das Erscheinungsbild der Kirche ist also wesentlich das der Amtskirche mit festen Hierarchien, hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einer klaren Kompetenzverteilung44 und klarer Ressourcengewinnung und –verteilung vermittels der Kirchensteuer. Die Kirche erscheint so als Organisation mit einem bestimmten Leistungsangebot, dessen man sich bedienen kann.
Verhängnisvoll ist nun, dass die Verkirchlichungstendenz zugleich einer Entkirchlichung45 Vorschub leistet, weil die aktiv vorangetriebene Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Sphären zu einer Trennung der Religion gegenüber den Bereichen der Kultur, der Ökonomie und des administrativen Sektors führte. Nicht mehr die Vermittlung in die Welt hinein, sondern die Absetzung von der Welt ist nunmehr die Zielrichtung, weil die Religion nicht mit der feindlichen Welt‘ in Berührung kommen möchte. Möglicherweise ist das auch der Hintergrund der Aufforderung von Benedikt XVI.46, die Kirche habe sich zu entweltlichen. Angesichts der begrifflichen Unschärfe seiner Rede und der Deutungsvielfalt dieses Stichwortes kann dies aber nicht evident belegt werden. Der Einflussbereich der Kirche aber schwindet ganz offenkundig in dem Maße, wie sie sich verkirchlicht, sich auf den Binnenraum reduziert und die kritische Vermittlung zur Welt hin – zentrale Aufgabe des Geistes des Zweiten Vatikanischen Konzils! – aufgibt. Eine Gesellschaft, in der das Christentum sich verkirchlicht, sucht dann nach neuen zivilreligiösen Horizonten, die gerade zur Zeit wieder deutliche Konturen annehmen und sich in den Debatten um Postsäkularität abzeichnen.47
Insgesamt ergibt sich also ein Bild des vorsichtigen, zum Teil aber auch offensiven Rückzugs der Kirche aus gesellschaftlichen Handlungsfeldern. Das ließe sich auch noch verdeutlichen an den vielen Beispielen der Preisgabe diakonischer Aufgaben. Zwar wird immer wieder betont, dies geschehe alleine aufgrund veränderter finanzieller Möglichkeiten; betrachtet man aber die kirchliche Gesamttendenz, so scheinen hierfür nicht nur ökonomische Fragen handlungsleitend zu sein, sondern durchaus auch pastorale Schwerpunktsetzungen und wesentliche Veränderungen in der Verhältnisbestimmung von Kirche und Gesellschaft.
Hier soll zunächst die Analyse der herrschenden kirchlichen Bedingungen unterbrochen werden, um in einem weiteren Schritt eine extraekklesiale Erhellung der Situation vorzunehmen, freilich auch hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit, vielmehr gedacht als Versuch, einige für die Theologie relevante Grundbefindlichkeiten herauszuarbeiten. Wir werden aber im dritten Kapitel die Analyse der kirchlichen Praxis unter besonderer Berücksichtigung der Sakramentenpraxis wieder aufnehmen.
1 Vgl. Belok, M., Kooperative Pastoral. Zauberwort oder pastoraler Paradigmenwechsel?, in: Pastoralblatt 54 (2002), 300-309
2 Vgl., Haslinger, H., Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft. Eine praktisch-theologische Untersuchung der diakonischen Praxis unter dem Kriterium des Subjektseins des Menschen, Würzburg 1996
3 Vgl. Mette, N., Einführung in die katholische Praktische Theologie, Darmstadt 2005
4 Vgl. Schöttler, H. G., Plädoyer für eine religionskritische Pastoraltheologie, in: Theologische Quartalschrift (Tübingen) 182(2002)101-127
5 Vgl., Bünker, A., Missionarisch Kirche sein? Eine missionswissenschaftliche Analyse von Konzepten zur Sendung der Kirche in Deutschland (Theologie und Praxis 23), Münster 2004
6 Vgl. Haslinger, H., Mystagogische Seelsorge. Eine lebensgeschichtlich orientierte Pastoral. Hg. gemeinsam mit Stefan Knobloch, Mainz (Grünewald) 1991
7 Hunstig,H.-G. / Ebertz, M. N. (Hrsg.), Hinaus ins Weite. Gehversuche einer milieusensiblen Kirche, Würzburg 2008
8 Vgl. Schöttler, H.-G., „Als in die Zeit Gebundene suchend finden sie…“ Überlegungen zu einer lebensdienlichen Konzeption der Pastoraltheologie, a.a.O.
9 Vgl. Baumgartner, I., Pastoralpsychologie. Einführung in die Praxis heilender Seelsorge, Düsseldorf 21997
10 Vgl. Nauer, D., Politisch-Befreiende Seelsorge. Zur gesellschaftspolitischen Dimension christlicher Seelsorge, in: Praktische Theologie und Politik. Hg. v. Bucher, Rainer, Rainer Krockauer. Münster 2006, 165-181
11 Vgl. Höhn, H. J., Religion in der modernen Stadt. Soziologische Streiflichter, in: Hirschberg 56 (2003) 100-110
12 Vgl., Ebertz, M. N., Kirche im Gegenwind. Zum Umbruch der religiösen Landschaft, Freiburg 1997
13 Vgl. Steinkamp, H., Solidarität und Parteilichkeit. Für eine neue Praxis in Kirche und Gemeinde, Mainz 1994
14 Vgl. zu all dem umfassend: Nauer, D., Seelsorgekonzepte im Widerstreit. Ein Kompendium, Stuttgart / Berlin / Köln 2001
15 Vgl. dazu die breite Diskussion der vielfältigen Entwürfe in Nauer, D., Seelsorgekonzepte im Widerstreit. Ein Kompendium, Stuttgart / Berlin / Köln 2001
16 Vgl. Pastoralamt des Bistums Basel, „Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit“. Ein Arbeitsinstrument für pastorales Handeln im Bistum Basel, Solothurn 1993
17 Die Pastoralkonzepte selbst können hier nicht zum Gegenstand gemacht werden. Vgl. dazu Pock, J., Gemeinden zwischen Idealisierung und Planungszwang. Biblische Gemeindetheologien in ihrer Bedeutung für gegenwärtige Gemeindeentwicklungen. Eine kritische Analyse von Pastoralplänen und Leitlinien der Diözesen Deutschlands und Österreichs (Tübinger Perspektiven zur Pastoraltheologie und Religionspädagogik 26), Münster 2006
18 Generalvikariat der Diözese Würzburg, Verwirklichung kooperativer Pastoral in der Diözese Würzburg, 2. veränderte und erweiterte Auflage, Würzburg 2003, 7
19 Vgl. ebd., 8
20 Vgl. ebd., 10; die Bemerkungen zum Pastoralplan von Würzburg sollen pars pro toto gelten und dienen einer symptomorientierten Wahrnehmung.
21 Marx, R., Die Vergrößerung des pastoralen Raumes und die Nähe zu den Menschen, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), „Mehr als Strukturen … Entwicklungen und Perspektiven der pastoralen Neuordnung in den Diözesen“. Dokumentation des Studientages der Frühjahrs-Vollversammlung 2007 der Deutschen Bischofskonferenz. Arbeitshilfen, Nr. 213. Herausgegeben vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2007, 62-68; 65
22 Vgl. Tebartz-van-Elst, F.-P, Gemeinden verändern sich. Mobilität als pastorale Herausforderung, Würzburg 2001
23 Ebd., 47
24 Vgl. Haslinger, H., „Um des Menschen willen!“ Worum es in der Jugendarbeit geht, wenn Gott ins Spiel kommt, in: Kruip, G. / Hobelsberger, H. / Gralla, A. (Hg.), Diakonische Jugendarbeit. Option für die Jugend und Option von Jugendlichen, München 1999, 57-82; in der Theologie der Befreiung gibt es ebenfalls eine interessante Erweiterung oder gar Präzisierung der Option für die Armen hin zu einer Option für die Anderen. Vgl. Suess, P., Junger Wein in alte Schläuche. Zum Theologietransfer aus und nach Lateinamerika, in: Schillebeeckx, E., Mystik und Politik. Theologie im Ringen um Geschichte und Gesellschaft. Johann Baptist Metz zu Ehren, Mainz 1988, 44-56
25 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), „Mehr als Strukturen …“ Neuorientierung der Pastoral in den (Erz-)Diözesen. Ein Überblick. Arbeitshilfen 216, Bonn 2007, 78; vgl. auch Pock, J., Gemeinden zwischen Idealisierung und Planungszwang. Biblische Gemeindetheologien in ihrer Bedeutung für gegenwärtige Gemeindeentwicklungen. Eine kritische Analyse von Pastoralplänen und Leitlinien der Diözesen Deutschlands und Österreichs, Münster 2006; Belok, M. (Hrsg.), Zwischen Vision und Planung. Auf dem Weg zu einer kooperativen und lebensweltorientierten Pastoral. Ansätze und Erfahrungen aus 11 Bistümern in Deutschland, Paderborn 2002
26 Ebd., 27
27 Metz, J. B., Fehlt uns Karl Rahner? Oder: Wer retten will muß wagen, in: Rahner, K., Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance. Mit einer Einführung von Johann Baptist Metz, Freiburg 1989, 9-24; 11
28 Ebd., 14
29 Ebd., 15
30 Synodenbeschluss Dienste und Ämter, 1.3.2
31 Ebd.
32 Vgl. Metz, J. B., „Wenn die Betreuten sich ändern“. Unterwegs zu einer Basiskirche, in: ders., Jenseits bürgerlicher Religion. Reden über die Zukunft des Christentums, Mainz 1980, 111-125
33 Steinkamp, H., Selbst „wenn die Betreuten sich ändern“, in: Schillebeeckx, E. (Hrsg.), Mystik und Politik. Theologie im Ringen um Geschichte und Gesellschaft. Johann Baptist Metz zu Ehren, Mainz 1988, 354-363; 358
34 In kirchenrechtlicher Perspektive ist Pfarrei im Anschluss an CIC, can. 515, §1 eine bestimmte, in einer Teilkirche auf Dauer angelegte und unter der Autorität des Diözesanbischofs mit einem Pfarrer als eigenem Hirten versehene Gemeinschaft zu verstehen. Sie ist der Ort, an dem sich alle Gläubigen zur sonntäglichen Eucharistiefeier versammeln können und die das christliche Volk in die christliche Liturgie einführt.
35 Norbert Greinacher hält für die Gemeinde im Unterschied zur Pfarrei fest, die Identität einer Gemeinde ergebe sich aus ihrem Gegründetsein in Jesus Christus, sie sei eine funktionale Größe, die nicht für sich selbst, sondern als Verweis auf Jesus und dessen Basileia da sei, sie betätige sich im praktischen Widerspruch zu allem, was Menschen beschädige oder vernichte als Anwalt der Menschlichkeit, sie zeichne sich durch die grundlegende Gleichheit aller ihrer Glieder aus, trete für die Freiheit aller Menschen ein etc. Vgl. Greinacher, N., Zielvorstellungen einer kirchlichen Gemeinde von morgen, in: ders. u.a. (Hg.), Gemeindepraxis. Analysen und Aufgaben, München / Mainz 126-141; 131
36 Vgl. Schönemann, H., Konkret werden - Pastoraltheologischer Blickwechsel. Vortrag auf der Zweiten Pastoraltagung des Bistums Rottenburg-Stuttgart am 17. Mai 2011, unveröffentlichtes Manuskript
37 Vgl. Wippermann, C. / de Magalhaes, I., Zielgruppen-Handbuch. Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus© 2005. Eine qualitative Studie des Instituts Sinus Sociovision zur Unterstützung der publizistischen und pastoralen Arbeit der Katholischen Kirche in Deutschland im Auftrag der Medien-Dienstleistung GmbH und der Katholischen Sozialethischen Arbeitsstelle, Heidelberg 2006
38 Wanke, J., Was uns die Sinus-Milieu-Studie über die Kirche und ihre Pastoral sagen kann – und was nicht, in: Lebendige Seelsorge 57(2006)242-246; 243
39 Vgl. ebd.
40 Ich werde im sechsten Kapitel näher auf diesen theologischen Topos eingehen und ihn dann eingehender entfalten und kritisch reflektieren.
41 Vgl. Kaufmann, F. X., Kirche begreifen. Analysen und Thesen zur gesellschaftlichen Verfassung des Christentums, Freiburg 1979
42 Vgl. Köhl, G., Der Beruf des Pastoralreferenten. Pastoralgeschichtliche und pastoraltheologische Überlegungen zu einem neuen pastoralen Beruf. Praktische Theologie im Dialog Bd. 1, Freiburg/CH 1987; Karrer, L., Die Stunde der Laien. Von der Würde eines namenlosen Standes, Freiburg 1999; Bausenhart, G., Das Amt in der Kirche. Eine not-wendende Neubestimmung, Freiburg 1999
43 Hier sei nur auf die Reglementierungen der bundesdeutschen Diözesen in der Frage der Schwangerenkonfliktberatung hingewiesen, die sich in der Mehrheit lange Zeit für den Verbleib im Beratunssystem ausgesprochen hatten, weil sie der Auffassung waren, dass dies, vor allem angesichts der positiven Beratungserfolge im Sinne des Embryonenschutzes, die bessere Möglichkeit war, das Leben der Ungeborenen zu schützen, dafür aber in Kauf nahmen, dass sie in diesem Prozess auch Schuld auf sich nehmen müssten.
44 Das gilt auch in pastoraler Hinsicht, denn es gibt eine deutliche Aufgabenspezifizierung zwischen Priestern, die vor allem für Liturgie, Kasualien und Sakramentenspendung zuständig sind und den Laien, deren Dienst in der und an der Welt immer wieder stark in den Mittelpunkt gestellt wird. Übernehmen letzteres die Laien, sind die Priester davon selbstverständlich dispensiert.
45 Vgl. Gabriel, K., Christentum zwischen Tradition und Postmoderne, Freiburg 2000; ders., Entkirchlichung. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Dritte völlig neu bearbeitete Aufl., hrsg. von W. Kasper u.a. Bd. 3, Freiburg 1995, Sp. 681; ders., Säkularisierung und Religiösität im 20. Jahrhundert, in: Bueb, B. u.a., Alte Werte – Neue Werte. Schlaglichter des Wertewandels, Göttingen 2008, 97-106
46 Vgl. die Diskussion von 20 prominenten Menschen aus dem Bereich der Politik, der Theologie und der Kirche zum Verständnis dieser Rede in: Erbacher, J. (Hg.), Entweltlichung der Kirche? Die Freiburger Rede des Papstes, Freiburg 2012
47 Vgl. Habermas, J. / Ratzinger, J., Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, Freiburg 2005; Habermas, J., Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt am Main 2005; Peters, T. R., Mehr als das Ganze. Nachdenken über Gott an den Grenzen der Moderne, Ostfildern 2008; Mate, R., Die Religion in der postsäkularen Gesellschaft. Zur Debatte zwischen Flores d’Arcais und Habermas, in: Polednitschek, T. / Rainer, M. J. (Hg.), Theologisch-politische Vergewisserungen. Ein Arbeitsbuch aus dem Schüler- und Freundeskreis von Johann Baptist Metz, Münster 2009, 197-209; Höhn, H.-J., Postsäkular. Gesellschaft im Umbruch – Religion im Wandel, Paderborn 2007