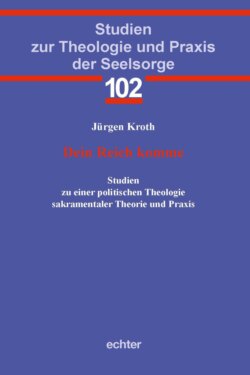Читать книгу Dein Reich komme - Jürgen Kroth - Страница 11
Оглавление2. Soziologische und zeitdiagnostische Außenbetrachtungen
Es kann in den folgenden soziologischen und zeitdiagnostischen Außenbetrachtungen nicht darum gehen, eine umfassende Analytik zu entwickeln. Wiederum soll der Versuch unternommen werden, die für unsere Fragestellung relevanten Entwicklungen und Perspektiven herauszuarbeiten und kritisch zu reflektieren. Dieses Vorgehen mag religionssoziologisch anfragbar sein, erscheint hier dennoch gerechtfertigt, um nicht aus dem Blick zu verlieren, was unsere Aufgabe hier ist.
2.1 Die Deutung der Zeichen der Zeit als Aufgabe für die Theologie
Inzwischen hat sich der Topos „Zeichen der Zeit“ so sehr in den alltagssprachlichen Gebrauch verallgemeinert, dass die Tiefenstruktur dieses Wortes kaum noch wahrgenommen wird. Mit den Zeichen der Zeit ist keineswegs bloß eine tagespolitische Zeitansage, auch nicht einfach eine bloß die Gegenwart erfassende Rede gemeint, vielmehr rühren die Zeichen der Zeit zugleich an Vergangenheit und Zukunft. Zeichen der Zeit sind auch Erinnerungen, Hoffnungen, Sehnsüchte; Signaturen einer Welt, die Veränderungen durchläuft, die in diesen aber zugleich auch Opfer produziert; die Versprechen macht, von denen die Gegenwart zehrt und sie für die Zukunft fruchtbar machen möchte.
Die Suche nach den Zeichen der Zeit, wie sie spätestens seit der bahnbrechenden Enzyklika von Johannes XXIII. Pacem in terris (1963) der Theologie aufgegeben ist, öffnet zugleich wiederum die Türen der Kirche und der Theologie. Eine reine Binnenperspektive reicht zur Erfassung der Zeichen der Zeit nicht mehr hin, ja, sie ist von Johannes geradezu ausgeschlossen. Theologie kann nunmehr auch die Auseinandersetzung mit anderen Wissenschaften nicht mehr ablehnen. Es lohnt, die entscheidende Passage aus Gaudium et spes noch einmal zu zitieren, die die Grundlagen von Pacem in terris aufgreift und zugleich weiterführt.1
„Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort geben. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen. Einige Hauptzüge der Welt von heute lassen sich folgendermaßen umschreiben. Heute steht die Menschheit in einer neuen Epoche ihrer Geschichte, in der tiefgehende und rasche Veränderungen Schritt um Schritt auf die ganze Welt übergreifen. Vom Menschen, seiner Vernunft und schöpferischen Gestaltungskraft gehen sie aus; sie wirken auf ihn wieder zurück, auf seine persönlichen und kollektiven Urteile und Wünsche, auf seine Art und Weise, die Dinge und die Menschen zu sehen und mit ihnen umzugehen. So kann man schon von einer wirklichen sozialen und kulturellen Umgestaltung sprechen, die sich auch auf das religiöse Leben auswirkt. Wie es bei jeder Wachstumskrise geschieht, bringt auch diese Umgestaltung nicht geringe Schwierigkeiten mit sich. So dehnt der Mensch seine Macht so weit aus und kann sie doch nicht immer so steuern, daß sie ihm wirklich dient. Er unternimmt es, in immer tiefere seelische Bereiche einzudringen, und scheint doch oft ratlos über sich selbst. Schritt für Schritt entdeckt er die Gesetze des gesellschaftlichen Lebens und weiß doch nicht, welche Ausrichtung er ihm geben soll. Noch niemals verfügte die Menschheit über soviel Reichtum, Möglichkeiten und wirtschaftliche Macht, und doch leidet noch ein ungeheurer Teil der Bewohner unserer Erde Hunger und Not, gibt es noch unzählige Analphabeten. Niemals hatten die Menschen einen so wachen Sinn für Freiheit wie heute, und gleichzeitig entstehen neue Formen von gesellschaftlicher und psychischer Knechtung. Die Welt spürt lebhaft ihre Einheit und die wechselseitige Abhängigkeit aller von allen in einer notwendigen Solidarität und wird doch zugleich heftig von einander widerstreitenden Kräften auseinandergerissen. Denn harte politische, soziale, wirtschaftliche, rassische und ideologische Spannungen dauern an; selbst die Gefahr eines Krieges besteht weiter, der alles bis zum Letzten zerstören würde. Zwar nimmt der Meinungsaustausch zu; und doch erhalten die gleichen Worte, in denen sich gewichtige Auffassungen ausdrücken, in den verschiedenen Ideologien einen sehr unterschiedlichen Sinn. Man strebt schließlich unverdrossen nach einer vollkommeneren Ordnung im irdischen Bereich, aber das geistliche Wachstum hält damit nicht gleichen Schritt. Betroffen von einer so komplexen Situation, tun sich viele unserer Zeitgenossen schwer, die ewigen Werte recht zu erkennen und mit dem Neuen, das aufkommt, zu einer richtigen Synthese zu bringen; so sind sie, zwischen Hoffnung und Angst hin und her getrieben, durch die Frage nach dem heutigen Lauf der Dinge zutiefst beunruhigt. Dieser verlangt eine Antwort vom Menschen. Ja er zwingt ihn dazu.“ (GS, 4)
Mit den Formulierungen des Konzils ist schon eine deutliche Richtung hin zu einer gesellschafts- und zeitkritischen Wahrnehmung des Bestehenden angedeutet, die aber in der jeweiligen Durcharbeitung konkreter zu fassen ist. So ist wohl auch zu fragen, ob nicht die Zeichen der Zeit gleichsam eine Signatur tragen, die in den unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich sein kann, die aber eine hermeneutische Superstruktur erkennbar werden lässt. Für jede europäische Theologie dürfte die Signatur eine „nach Auschwitz“2 sein, insofern Auschwitz jede positive Explikation von Sinn unter Generalverdacht stellt. „Die kleinste Spur sinnlosen Leidens in der erfahrenen Welt“, so schrieb Adorno, „straft die gesamte Identitätsphilosophie Lügen“.3 Es wäre aber ein Irrtum und ein unerlaubter Eurozentrismus, dies alleine mit dem Namen Auschwitz zu verbinden. Explizit formuliert Adorno in der Ästhetischen Theorie: „Schon vor Auschwitz war es angesichts der geschichtlichen Erfahrungen affirmative Lüge, irgend dem Dasein positiven Sinn zuzuschreiben.“4 Theologisch deutlich hat Gustavo Gutiérrez die Frage gestellt, wie man von Ayacucho aus von Gott sprechen könne5, also von einem Ort aus, der schon seit Jahrhunderten für das lateinamerikanische Volk mit den größten Gräueln verbunden ist. Dom Helder Camara hat schon vor Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils auf die Kontextualität der Erkundung der Zeichen der Zeit hingewiesen. In einem Brief vom 25. Dezember 1960 an Kardinal Marcelo Mimmi schreibt er:
„Verzeihen Sie, Eminenz, mit allem schuldigen Respekt vor den für die Organisation des Konzils Verantwortlichen möchte ich mit Sorge über die Kommission, deren Berater ich bin, feststellen, daß erstens die vorbereitenden Fragelisten auf Antworten zielen, die mehr administrativer Routine als dem Niveau eines Ökumenischen Konzils entsprechen, und daß die Fragebogen nicht die grundlegenden und sehr schwierigen Probleme berühren, die die Menschheit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigen werden. Ich möchte hier nur zwei Probleme nennen, nämlich die demographische Entwicklung (…) und die schreckliche Ungleichheit, die einem Drittel der Menschheit ein hohes Niveau der Entwicklung, des Überflusses und des Luxus gestattet, während zwei Drittel im Zustand der Unterentwicklung und des Hungers leben müssen. Es wäre ein schwerer Irrtum, wenn die Konzilsväter diese Probleme nur von einem politischen und ökonomischen Standpunkt aus sähen und nicht erkennen würden, daß das Schicksal der Welt von der Haltung des einen Drittels abhängig ist, das glücklich und im Wohlstand leben kann.“6
In wiederum anderen Kontexten mag die Signatur der Zeit durchaus wieder eine andere sein. Für alle aber gilt es, sie aus der Perspektive der Opfer aus zu betrachten und zu formulieren.
Den Zeichen der Zeit eignet nicht alleine eine anamnetische Grundstruktur, die auch die Gegenwart umfasst, sie implizieren zugleich einen Zukunftsaspekt, dem Gegenwart und Vergangenheit sich verpflichtet wissen, der aber auch die Möglichkeit offenhält, dass es bei dem Bestehenden nicht bleiben, dass es anders werden möge. Insofern zeigen die Zeichen der Zeit nicht nur das an, was ist, sondern sie zeigen auch – vielleicht auch nur ex negativo –, was werden soll. Dies entspricht exakt dem, was in der Formulierung von Gaudium et spes gefordert war, nämlich die Zeichen der Zeit im Lichte des Evangeliums zu deuten, da auch das Evangelium in der eigenartigen Spannung von Anamnese und Prolepse sich situiert, oder stärker biblisch formuliert, zwischen Exodus und Apokalyptik.
Mit der Erkundung der Zeichen der Zeit wagt sich das Konzil gänzlich in einen Bereich, der ihm – und auch weitgehend der Theologie – fremd und bedrohlich erschien: in den Bereich der Geschichte. Theologie, die gewohnt war und ist, sich mit ewigen Wahrheiten auseinanderzusetzen, ist auf das Leben hin zurückgeworfen, auf die Kontingenz des Lebens, auf die Diskontinuität der Geschichte, auf das Nichtidentische, das eben nicht im Begriff sich aufheben lässt. Sie ist darauf verpflichtet, die Realität möglichst umfassend zu erfassen, ihre Methodologie hin zum induktiven Denken zu verändern, sich dem Schema „sehen – urteilen – handeln“ zu verpflichten.
Wir werden in den folgenden Schritten dies versuchen, in dem Bewusstsein allerdings, dass es sich bei den hier zum Gegenstand gemachten Zeichen der Zeit nur um Ausschnitte aus diesen Zeichen handelt, keineswegs um eine umfassende Analytik.
2.2 Kolonialisierung der Lebenswelt, Individualisierung und Atomisierung
1
Weit über alle Grenzen – auch ideologischer Art – zeigt sich eine Signatur der Spät- oder Nachmoderne: Menschen werden immer weniger als Personen, denn als Individuen betrachtet. Worin aber, so ließe sich fragen, liegt dabei das Problem? Nun, „eine Person ist ein Mensch, der mitten unter anderen Menschen und durch sie seine unverwechselbare Eigenheit hören läßt (per-sonat). Ein Individuum ist ein Mensch, sofern er sich von anderen Menschen unterscheidet, gemäß der alten scholastischen Definition: indivisum in se, divisum ab omne alio, ungetrennt in sich, getrennt von jedem anderen. Deswegen setzen Person und Gesellschaft einander voraus, Individuum schließt Gesellschaft aus.“7 Gesellschaft ist dann nicht die Einheit von Personen, die in unterschiedlichen Interaktionen sich befinden, sondern die Summe der Individuen. Ein gemeinsames Handeln oder gar gemeinsame Interessen sind auf der Basis des Individualisierungsdrangs nicht vorauszusetzen. Norbert Elias hat diese Entwicklung als das „Wir-lose Ich“8 bezeichnet. Ausgehend von der Prämisse, dass IchIdentität einen konstitutiven Wir-Bezug voraussetzt, dass also IchWerdung immer Ich-Werdung am anderen und von anderen ist, weist Elias nach, dass es eine deutliche Verschiebung von der Wir-Identität hin zur monadischen Ich-Identität gibt. Von den Stammesgesellschaften bis ins europäische Mittelalter lässt sich dies darlegen. Erstmals in der Renaissance ist solch eine Verlagerung zu beobachten. Ökonomisch findet eine Ablösung der Familienbindung statt; die Sippe wird immer weniger zum Hintergrund des materiellen Überlebens. Immer stärker wird jeder zum ‚Schmied seines eigenen Glücks’. Es kommt folglich auf jeden einzelnen an, der stets in Absetzung und Konkurrenz zum anderen sein Glück findet.
Gerade von den Protagonisten des Liberalismus, genauer gesagt: des neoklassischen Liberalismus wird diese Entwicklung gewiss goutiert. Allerdings gibt es auch gewichtige Kritiker. Der konservative Kulturkritiker Daniel Bell sieht den Individualismus eher als Ausdruck eines egoistischen Hedonismus. Individualismus ist für ihn „Synonym für Egoismus als Ausdruck mangelnder Pflichterfüllung und Moral“9. Unverkennbar trifft sich diese Kritik mit vielen Kritiken aus theologisch-kirchlichen Kreisen. Der Individualist ist in dieser Beschreibung weniger Opfer denn Täter. Er ist der konsumorientierte Freizeitmensch oder, in der Beschreibung von Gerhard Schulze, tendenziell im Unterhaltungsmilieu angesiedelt.10 Doch kann man den individualisierten Menschen im tiefsten Sinne vorwerfen, dass sie ihre hedonistischen Anteile ausleben? Sind sie sich immer bewusst, wie sie ihr Leben gestalten? Kennen sie ihre Handlungsmotive hinreichend und entscheiden sich dann reflektiert dafür?
Eher scheint die Diagnose Erich Fromms zutreffend, der im individualisierten Menschen ein Opfer gesellschaftlicher Entwicklungen (Massenkonsum, Warenästhetik u.ä.) entdeckt. In seiner Typologie der Sozialcharaktere ordnet Fromm den bürgerlichen Sozialcharakter11 in der Früh- und Hochphase des Kapitalismus dem (analen) Typus des Besitz hortenden Menschen zu, der zugleich autoritäre Züge im Sinne eines rigiden, kontrollierenden Über-Ichs trägt. In der Überflussgesellschaft des Spätkapitalismus wandelt sich die autoritär geprägte Persönlichkeitsstruktur nur scheinbar, denn an die Stelle der Abhängigkeit von den patriarchalen Vätergestalten (Vorgesetzte, Chefs, Pfarrer u.ä.) treten mit zunehmender Bürokratisierung die sog. Sachzwänge, die ihrerseits Abhängigkeitswünsche und Ohnmachtsgefühle nähren.
In dieser Sicht werden Individualisierung und die damit verbundenen Wahrnehmungen der Menschen in engem Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Entwicklungen gesehen. Individualisierung zeigt dabei nicht nur eine Fortschritt begründende Dimension, wenn wir z.B. an die Autonomiefrage denken, sondern entfaltet sich auch als Zerstörung der Subjekte durch eine atomisierende Isolation des Individuums von anderen Individuen. Dieses Phänomen wird in der Sozialpsychologie auch als narzisstischer Sozialcharakter beschrieben und hat für die heutige pastorale Situation durchaus große Bedeutung, insofern hier wiederum Individualisierung in Absehung von einer tieferen Beziehung zum anderen formuliert wird. In einem größeren historischen Kontext wird dies von Kuzmics folgendermaßen beschrieben:
„Am Anfang des Bürgertums stand das ‚heroische Subjekt’, am (vorläufigen) Ende ist es weitgehend verschwunden und macht einem ziemlich jämmerlichen Vertreter der bürgerlichen Spezies Platz. Der Narzißt betritt die Bühne, ängstlich, aber ohne tiefere Schamgefühle, von Phantasien der Grandiosität getragen, aber innerlich leer; abhängig von anderen, unfähig, seine Bedürfnisse aufzuschieben, ist er auch nicht imstande, zu anderen tiefere Beziehungen einzugehen.“12
Selbstverständlich kann den hier dargestellten Subjekten ihr Narzissmus nicht vorgeworfen worden, da es sich dabei um eine Pathologie der modernen Gesellschaft und ihrer Individualisierungstendenz handelt. Insofern aber die kirchliche Praxis es freilich mit genau jenen Subjekten auch zu tun hat, muss sie sich mit diesen Phänomenen auseinandersetzen, will sie wissen, wie denn die Menschen geprägt sind.
2
Hinter dem etwas undurchsichtigen Begriff der Kolonialisierung der Lebenswelt verbirgt sich ein komplexes Theoriegefüge, das wesentlich von Jürgen Habermas in vielen unterschiedlichen Arbeiten entfaltet wurde. Leider kann ich hier nur gleichsam summarisch und daher auch sehr verkürzt einige Grundzüge dieser komplexen Theorie darlegen und sie anhand weniger Beobachtungen prüfen. Grundlegend ist eine zentrale Unterscheidung: die nämlich von System und Lebenswelt. Unter System versteht Habermas dabei den gesamten Bereich der Ökonomie, der Politik und der gesellschaftlichen Makrostruktur. Lebenswelt hingegen ist der Sektor der menschlichen Interaktion, seiner unmittelbaren Lebensvollzüge, der Interpretation eigener Verhältnisse und Situierung innerhalb der systemischen Überlagerung. Dabei möchte Habermas mit dieser Unterscheidung nicht die Unterwerfung unter das System, sondern im Rahmen der systemischen Überlagerung lebensweltliche Residuen schaffen. Im Gegensatz zu Adornos Diktum, es gebe „kein richtiges Leben im falschen“13, scheint Habermas davon auszugehen, dass es im bestehenden Falschen doch auch richtiges Leben gebe, wenn dies auch möglicherweise, so wäre hinzufügen, gerade dadurch auch beschädigt wird.14 Was Jürgen Habermas damit meint, ist wiederum gar nicht so schwer und soll an Alltagsbeispielen erläutert werden:
Angesicht der erfahrenen oder zumindest so wahrgenommenen Übermacht des ökonomischen oder auch administrativen Systems fühlen sich immer mehr Menschen diesem System bloß noch ausgeliefert, sie fühlen sich ohnmächtig und klein, die Komplexität des Systems scheint immer unübersichtlicher wenn nicht gar undurchschaubar. Viele Menschen reagieren darauf mit Apathie, manchmal aber auch mit diffuser Wut auf irgendetwas, jedenfalls nicht mit einem bestimmter Zorn auf etwas Konkretes.
Wenn wir unsere Briefkästen leeren, finden wir zumeist – sofern wir nicht entsprechende Bitten darauf geklebt haben – eine Fülle von Werbebroschüren und Reklamebeilagen. Die Informationsflut nimmt ständig zu. Unser Leben wird angefüllt mit Gegenständen, die wir nie brauchen werden. Es gelingt immer besser, uns zum Kauf völlig überflüssiger Produkte zu animieren – meist mit dem Hinweis auf einen großartigen Rabatt. Wegwerfartikel haben – allen kritischen Hinweisen auf drohende ökologische Katastrophen zum Trotz – weiterhin Konjunktur usf.
Dies alles sind Invasionen unseres Alltags, derer wir uns fast nur noch durch ausdrückliche Aufklärung bewusst werden. Die Normalität dieser Invasion macht eine kritische Wahrnehmung aber immer schwerer. Auch angesichts der täglichen Katastrophen gibt es einen Gewöhnungseffekt. Man kann sich trefflich wundern, „wie wenig man ihrer [der Philosophie; J.K.] Geschichte die Leiden der Menschheit anmerkt“15. Wie schnell vergaßen wir Tschernobyl? Wie lange ist die Halbwertzeit einer Angst vor Krieg, z.B. beim ersten Irak-Krieg? Wer spricht heute noch von den Opfern der Tsunami-Welle? Wer erinnert noch ernsthaft die Opfer des 11. September? Wer vor allem thematisiert den systemischen Massenmord an den Kindern, die heute an Unterernährung sterben? Auch das Vergessen und das Verdrängen scheint System zu haben. Das System-Lebenswelt-Theorem versucht, diese Erfahrungen soziologisch und sozialpsychologisch zu erklären, indem es die Auswirkungen „systemischer“ Komplexitätssteigerung auf die Lebenswelt beschreibt.
Folgt man Jürgen Habermas, haben sich die staatliche Bürokratie und der kapitalistische Markt zu einem „monetär-administrativen Komplex verdichtet, haben sich gegenüber der kommunikativ strukturierten Lebenswelt verselbständigt und sind offenbar überkomplex geworden“16. Gerade wenn das System aber übermächtig und überkomplex zu werden droht und – jedenfalls in der Diagnose von Habermas – dagegen kaum Alternativen zu entwickeln sind, wäre eine Reaktionsmöglichkeit, die von der Kolonialisierung bedrohte Lebenswelt um so mehr zu schützen.
Mit „Lebenswelt“ ist in diesem theoretischen Zusammenhang – natürlich hier verkürzt – gemeint einerseits die alltagsweltlichen Plausibilitäten, an denen wir unser Handeln orientieren, andererseits der Rückhalt durch bestimmte Kollektive oder Milieus u.ä., die Orte darstellen, an denen Menschen sich die Kategorien ihres Weltverständnisses aneignen.
Beide Bereiche sind von der Kolonialisierung durch das System bedroht: Wirtschaft und Bürokratie dehnen – teils gezielt, teils inneren Gesetzmäßigkeiten folgend – ihre Einflussbereiche immer mehr hin zur Lebenswelt aus. Dieser Prozess ist aber nicht einfach wertneutral, sondern führt in Bedrohungslagen, wenn gesellschaftliche Prozesse, wie Habermas dies nun nennt, vom „verständigungsorientierten Handeln“17 abgekoppelt werden.
So wichtig die Analysen und Diagnosen von Jürgen Habermas für das Verständnis heutiger gesellschaftlicher Verhältnisse auch sind; sie dürfen freilich auch nicht einfach unhinterfragt bleiben. Norbert Mette fasst seine Kritik in großer Nähe zu diesem Konzept folgendermaßen zusammen:
„Ein häufig gesuchter Ausweg aus diesen verschärften Krisenerfahrungen besteht in dem Versuch, sich in überschaubare Lebenswelten hinein zurückzuziehen. Daß damit vielfach – nämlich im Fall eines unkritischen Sich-zurück-Ziehens – eine Realitätsverweigerung eingehandelt wird, macht die eine problematische Seite dieses Auswegs aus. Gravierender ist die andere Seite, nämlich daß sich die Ansicht, auf solchen gesellschaftlichen Inseln könne man sich des destruktiven systemischen Gesamtzusammenhangs entziehen, als Illusion erweist. Im Gegenteil, die aufgeführten Formen der ökonomischen und administrativen Rationalität mit ihren abstrakten Steuerungsmechanismen nehmen immer stärker Einfluß auf die lebensweltlich strukturierten Gesellschaftsbereiche und deformieren sie, weil ihnen damit ihre für sie charakteristische kommunikative Struktur, die Möglichkeiten eines verständigungsorientierten Handelns eröffnet und gewährleistet, auf Dauer entzogen wird.“18
3
Folgt man Hegel in seinen „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ hinsichtlich des grundlegenden Merkmals der modernen Gesellschaft, dann kann ein Prinzip nicht übersehen werden, nämlich das Prinzip der „persönlichen Selbstzwecklichkeit des einzelnen in seinen Bedürfnissen“19. Hier wird das Bedürfnis noch an die Selbstzwecklichkeit des Menschen zurückgebunden. Eine Rückbindung, die freilich nicht lange Bestand hatte. Denn schon in den Analysen von Karl Marx zeigt sich, dass eine ökonomisch strukturierte Eigengesetzlichkeit im Gange war, die die Bedürfnishaftigkeit gleichsam instrumentalisierte und damit freilich auch den Menschen instrumentalisierte als Adressaten einer Bedürfnisproduktion. Die Moderne bildet daher idealtypisch ein „System von Bedürfnissen, in dem tendenziell jeder sich selbst bestimmen und verwirklichen können soll, in dem aber faktisch doch jeder gegen jeden sich behaupten muß“20. Ein jeder hat die Möglichkeiten, seine Bedürfnisse frei zu artikulieren und für deren Befriedigung zu sorgen. Der Ort, an dem das stattfindet, ist der Markt.
Nun sind aber schon von sich aus menschliche Bedürfnisse offensichtlich expansiv und neigen nur selten dazu, sich mit Bestehendem oder Vorhandenem zufrieden zu geben. Selbstverständlich gibt es hier Ausnahmen, aber sie bestätigen doch wohl immer wieder nur die Regel. Wenn dies aber stimmt und wenn weiterhin richtig ist, dass nicht jedes Bedürfnis gleichermaßen befriedigt werden kann, wenn daher unterschiedliche, in freier Subjektivität artikulierte Bedürfnisse anderen frei artikulierten Bedürfnissen gegenübertreten, dann ergibt sich daraus zum einen ein der Bedürfniswelt immanentes Aggressions- und Konfliktpotential, dann stellt sich aber auch eine gesellschaftliche Tendenz ein, die progressiven Bedürfnisse in möglichst großer Anzahl zu befriedigen; kurz gesprochen: ein expandierender Markt sucht danach, dies zu regulieren, was freilich auf Erschließung immer neuer Ressourcen hinausläuft.
Wird dabei aber eine bestimmte Schwelle überschritten, indem die Kontrolle der Bedürfnisbefriedigung an die Bedürfnisartikulation gebunden bliebe, beginnt sich der Prozess zu verselbständigen. Das bedeutet, dass ab dann ständig neu die Bedürfnisse selbst produziert werden müssen und das Bedürfnissubjekt seinerseits mehr und mehr durch die Bedürfnisproduktion zu einem Bedürfnisobjekt wird. Diese Entwicklung ist unschwer von den meisten Menschen nachzuvollziehen. Dass diese Logik der Expansion nicht beliebig fortsetzbar ist, ist ebenso evident wie offensichtlich folgenlos, obwohl doch die Folgen inzwischen nicht nur in den Ländern der sog. Dritten Welt sichtbar sind, sondern zunehmend auch hier bei uns.21 Jenseits aber der ökonomischen und ökologischen Auswirkungen zeigen sich in den westeuropäischen Ländern auch noch andere Folgen, die für eine pastoraltheologische und religionspädagogische Theorie und Praxis ebenfalls bedeutsam sind: nämlich die psychosozialen Folgen der Zerstörung eigenständiger Subjekte, Adorno spricht gar von der „Liquidation des Ichs“. Anhand eines kleinen Beispiels soll die Verkehrung der Verhältnisse in einem ganz anderen Bereich verdeutlicht werden:
„Statt, daß eine zur Vernunft gekommene Menschheit die gigantischen materiellen und intellektuellen Kräfte, die sich im Schoße der kapitalistischen Produktionsweise entwickelt haben, zur Einrichtung einer freien Gesellschaft einsetzt, wird sie mehr und mehr zum Anhängsel des kapitalfixierten technischen Fortschritts, der sich vollständig von seinen Erzeugern losgerissen hat und diese wie bloße Anhängsel mitschleift. Eine symbolische Darstellung dieses Sachverhalts hat kürzlich ein englisches Busunternehmen geliefert, dessen Busfahrer die Wartenden an den Haltestellen nur selten mitnahmen. Als sich die verschmähten Fahrgäste eines Tages beschwerten, bekamen sie vom Unternehmer die verblüffende Erklärung, anders könne der strikte Fahrplan nicht eingehalten werden.“22
2.3 Die Herausforderung unbegrenzter Pluralität
Die zweifellos gestiegenen Möglichkeiten, aus allen denkbaren Angeboten zu wählen, haben für das Subjekt auf den ersten Blick eine Freiheit eröffnende Funktion. Beim zweiten Blick sieht die Sache aber schon etwas anders aus: Die Möglichkeit, aus allem wählen zu können, führt zu einer „neuen Unübersichtlichkeit“23. Das spätmoderne Subjekt weiß, dass es alles wählen kann, und steht angesichts dieser Möglichkeit völlig überfordert da. Ohne übergeordnetes Bezugssystem – sei es religiös, sei es philosophisch, politisch oder ästhetisch – bleibt dem Einzelnen nichts anderes übrig, als eigenständig Sinn zu produzieren oder auf eigene Sinnressourcen zu rekurrieren. Angesichts radikaler Pluralität fällt nun aber eine wie auch immer geartete soziale Kommunikation immer schwieriger. Dass sie nicht unmöglich ist, ist gleichwohl evident und damit zugleich auch Möglichkeit von Hoffnung; doch dies ginge dann selbstverständlich über den Postmodernismus hinaus. Ein Blick in unsere Wirklichkeit zeigt aber deutlich, dass es mit einer sozialen Kommunikationsstruktur immer schwieriger wird. Immer mehr wird das Subjekt auf sich selbst zurückgeworfen, immer stärker werden die Vereinzelungs-, Atomisierungs- und Vereinsamungstendenzen. Das Individuum muss demgemäß „lernen, sich selbst als Handlungszentrum, als Planungsbüro in Bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkeiten, Orientierungen, Partnerschaften usw. zu begreifen“24; jeder ist also seine eigene Ich-AG.
Mit der letzten Bemerkung wird schon angedeutet, dass der früher kritisch verwendete Begriff der Atomisierung und sozialer Entfremdung inzwischen affirmativ verwendet wird, denn in der Gesellschaft möglichst vieler Ich-AGs ist jeder sein eigener Unternehmer, sein eigener Chef, sein eigener Planer und sein eigener Angestellter. Es entsteht damit eine doppelte Pluralität: eine interpersonale und eine intrapersonale. Wie die Subjekte untereinander in unverbundener Konkurrenz stehen, so muss auch das Subjekt in sich selbst sehr plural aufgestellt sein und unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen.
Für die praktisch-theologische Perspektive stellt sich die Frage, ob sie diesen Trend prolongieren und theologisch verdoppeln darf, oder ob sie nicht bewusst an der Problematisierung und Überwindung der gesellschaftlichen Atomisierung mitarbeiten muss.
Schwierig ist das aber nicht nur deswegen, weil sich die kirchliche Praxis schon seit langer Zeit als Spielart bürgerlicher Religion erwiesen hat, sondern auch weil sich dies in der religiösen Sozialisation konsequent in Richtung einer religiösen Individualisierung und individualisierten Religiosität entfaltet hat. Dabei führt erstere tendenziell zur Auflösung der letzteren, zumindest in dem Sinne, dass unter dem Zeichen der Individualisierung es zu einer Auflösung des transindividuellen Religiösen kommen kann. Nun kann die Reaktion darauf nur schwer sein, den individualisierten und atomisierten Subjekten ein geschlossenes System vorgeprägter Religiosität vorzulegen, das freilich ohnehin kaum noch gelebt, sondern nur noch gelehrt wird. Triftiger scheint es vielmehr, mithilfe der großen Erzählung der jüdischchristlichen Tradition ein Deutungsmuster vorzulegen, das sich einerseits in Geschichte und Gesellschaft selbst entfaltete und darin schließlich auch ihr fundamentum in re besitzt, das zugleich aber auch für Gegenwart und Zukunft die Kraft produktiver Ungleichzeitigkeit besitzt, die in der radikalen Pluralität und den damit verbundenen Atomisierungstendenzen auf ein Einheitsmoment setzt, das nunmehr Menschen nicht mehr isoliert, sondern in ihrer Andersartigkeit verbindet und so auch die Möglichkeit von Sozialität und Solidarität auch weit über den Horizont des Eigenen hinaus eröffnet.
Wie wenig eine wirkliche Durchdringung der Pluralitätsproblematik vorgenommen wird, kann in einem ganz anderen Bereich verdeutlicht werden: Schaut man sich etwa Lehrpläne für den Religionsunterricht an, dann trifft man mit großer Wahrscheinlichkeit auf Themen, die mit den Weltreligionen verbunden sind, selten aber auf das, was heute unter dem Stichwort ‚interkulturelles Lernen’ verstanden wird. Wer sich dagegen in der religionspädagogischen Fachliteratur seit den 90er Jahren umschaut, erhält einen völlig anderen Eindruck: Interkulturelles Lernen scheint ein breit rezipierter Ansatz religionspädagogischer Theorie und Praxis zu sein. In Fachzeitschriften werden Themenhefte dazu aufgelegt, es werden entsprechende Sammelbände verfasst und auch Monographien vorgelegt.25 Nun könnte es sich dabei selbstverständlich um ein Modethema handeln oder aber es spiegelt sich darin eine Erfahrung wider, die auf die Notwendigkeit einer Beschäftigung damit hinweist.
Dass in allen gesellschaftlichen Bereichen und damit auch in Kirche, Gemeinde, Schule und Theologie die Pluralität zugenommen hat, ist inzwischen ein Allgemeinplatz. Es stellt sich aber die Frage nach den Beziehungen der unterschiedlichen pluralen Erscheinungen. Gibt es mithin Beziehungen zwischen den einzelnen Konfessionen, zwischen den monotheistischen Religionen und den übrigen Weltreligionen? Selbstverständlich haben wir schon eine gewisse Erfahrung mit interkonfessionellen Strukturen, was uns aber noch immer fehlt, sind interreligiöse Ansätze. Dabei stellt sich sogleich das Problem, wie denn eine Auseinandersetzung zwischen den Religionen möglich ist, ohne den jeweiligen Wahrheitsanspruch zu relativieren, ohne ihn freilich auch zu verabsolutieren.
Eine Möglichkeit ist das weitläufig bekannte Modell des von Hans Küng vorgelegten „Projekt Weltethos“, demgemäß in allen Religionen ein Kernbestand an ethischen Überzeugungen zu finden sei, der alle Religionen eine und der das tragfähige Fundament darstelle, die anstehenden Fragen der Welt produktiv zu lösen. Bei diesem Projekt handelt es sich streng genommen zwar um eine Konsensustheorie, allerdings um eine auf einem vergleichweise niedrigen Niveau, in der die elementaren Differenzen zwischen den Religionen zugunsten eines Minimalkonsenses unbeachtet bleiben, wohingegen es doch eigentlich darum gehen müsste, die Differenzen deutlich herauszuarbeiten und die Religionen in ihrer Andersheit anzuerkennen, also zu einer Anerkennungskultur zu kommen, statt zu einer Angleichungskultur, dies freilich mit einem universalen Anspruch. Denn nur dann hat ja ein interreligiöser Diskurs wirklich substantielle Bedeutung, wenn es hier um Wahrheit im emphatischen Sinne geht. Dass damit freilich schon von Anbeginn die Perspektiven des Postmodernismus unterlaufen werden, der ja bekanntlich keine Wahrheit, sondern nur viele kleine Wahrheiten zulässt, ist evident.
Der Universalismus der jüdisch-christlichen Tradition liegt dem gegenüber selbstverständlich ganz unmittelbar in der Gotteshoffnung selbst, denn Gott ist entweder ein Menschheitsthema oder überhaupt kein Thema mehr. In einer polytheistisch oder auch – wie man mit Odo Marquard sagen könnte – polymythischen Welt sind plurale Gottheiten denkbar, die dann mit bestimmten Aufgaben, Gegenstandsbereichen, aber auch mit bestimmten Sektoren betraut werden können; sie sind gleichsam spezielle Götter für jeweils unterschiedliche Fragen, Regionen, Menschen, Gesellschaften etc. Gott aber ist anders – zumindest wenn man die jüdisch-christlichen Traditionen an diesem Punkt ernst nimmt. Es ist nämlich eine unglaubliche Unbescheidenheit, die sich in den jüdisch-christlichen Traditionen ermitteln lässt: Er ist nur unser Gott, wenn er zugleich auch euer Gott, er ist nur mein Gott, wenn er zugleich auch dein Gott sein kann.26
Nun soll weder verschwiegen noch übersehen werden, wie sehr der universale Anspruch des Christentums auch Leid in der Welt produzierte; doch scheint hier wiederum ein falscher Universalismus am Werke gewesen zu sein und eine Gottesvorstellung, die mit der hier vorausgesetzten in keiner Weise kompatibel ist, denn hinter dem machtförmigen Erscheinungsbild von Christentum und Kirche steckt ein gewissermaßen ‚starker‘ Monotheismus, der – das ist ja gerade angesichts der von Jan Assman27 angestoßenen Diskussion immer wieder thematisiert worden – demokratiefeindlich und gewaltförmig ist.28 Dabei kann uns soll nicht geleugnet werden, dass es gravierende Dimensionen von Gott zugelassener oder selbst initiierten Gewalt in der Erzählstruktur des Ersten Testaments gibt.29 Besonders problematisch sind hierbei natürlich die im Erzählzusammenhang Gott selbst zugesprochenen Gewalttaten, von der vernichtenden Flut bis hin zu Hiob. Assmann hat besonders die legitimatorische Gewalt hervorgehoben, in der sich Gewalttäter auf Gott als deren Rechtsgrund beziehen. Immerhin kann der Einwand geltend gemacht werden, die Frage nach der Gewalt und eine gewaltförmige Praxis befände sich auch im Ersten Testament in einem Entwicklungs- und Reflexionsstadium und es müsse auch der polytheistische Hintergrund vor allem der vor-monotheistischen Schichten der Hebräischen Bibel geltend gemacht werden.30 Dennoch: Sich diesen kritischen Anfragen dann durch die Behauptung zu entziehen, wir verträten schließlich keinen reinen Monotheismus, sondern eher einen, der trinitarisch sich entfalte, scheint dabei kein hinreichender Ausweg zu sein, da damit nicht nur die eigenen Wurzeln indirekt negiert würden und wir Gefahr liefen, uns im Gegensatz zum Judentum zu definieren, sondern auch weil ein rein trinitätstheologischer Entwurf ganz andere Schwierigkeiten aufwirft, über die aber zu verhandeln hier nicht der Ort ist.31
Viel eher wäre noch einmal an den jüdischen Monotheismus – auch und gerade als Christ – anzuknüpfen, der eben kein ‚starker‘, sondern ein „schwacher“ und verletzbarer, ein pathischer Monotheismus ist.
„Das will zweierlei besagen: Zum einen ist dieser Monotheismus von einer Figur der ‚biblischen Aufklärung’ begleitet, d.h. er enthält zwar Elemente eines archaischen Monotheismus mit seinen Gewaltmythen und seinen Freund-Feind-Bildern, gleichzeitig kennt er aber ein ‚Bilderverbot’, eine radikale Mythenkritik und die negative Theologie der Propheten; zum andern ist die Gottesrede der biblischen Traditionen ein[e] Rede, die durch die ebenso unbeantwortbare wie unvergessliche Theodizeefrage – also durch die Frage nach dem Leid in Gottes guter Schöpfung – konstitutionell ‚gebrochen’ ist, eine Rede, die nicht eine Antwort, sondern eine Frage zu viel hat. Sie ist deshalb eine Gottesrede, die sich nur über die Leidensfrage, über die memoria passionis, über das Eingedenken des Leids, des Leids der anderen – bis hin zum Leid der Feinde – universalisieren kann. Universal, also für alle Menschen bedeutsam, kann die Gottesrede nur sein, wenn sie in ihrem Kern eine für fremdes Leid empfindliche Gottesrede ist.“32
Die in diesem schwachen Monotheismus sich zeigende Empfindlichkeit für fremdes Leid könnte mithin das einende Band wenigstens zwischen den monotheistischen Religionen sein, wenn und insofern sie alle auf diesen biblisch tradierten Gott rekurrieren. Ob damit freilich eine Vermittlung zu den nichtmonotheistischen Religionen möglich sein könnte, wäre im Einzelfall jeweils noch zu prüfen. Aber auch für den Fall, dass es hier keine Gemeinsamkeiten geben sollte, wäre doch mit der leidempfindlichen Gottesrede ein Maßstab angegeben, der ein produktives Gespräch mit den anderen Religion eröffnen könnte. Es wäre auch nicht weiter tragisch, wenn an dieser Stelle Differenzen deutlich würden. So schön eine konsensuale Annäherung zwischen den Religionen auch sein mag; gerade die Erfahrungen in den Auseinandersetzungen zwischen Katholizismus und den lutherischen Kirchen um die Rechtfertigungslehre zeigen, dass auch eine Dissensformulierung durchaus produktiv sein kann. Davon wäre in unserer Frage möglicherweise auch zu lernen.
Die leidsensible Gottesrede auf der Basis des biblischen Monotheismus böte zugleich einen Maßstab, der auch politisch wirksam werden könnte, so dass der alte Verdacht, ein jeder Monotheismus sei demokratiefeindlich, obsolet wäre und vielmehr deutlich würde, dass in diesem Monotheismus selbst Demokratie schon angelegt ist, nämlich in seinem letzten biblischen Imperativ, eine jede gesellschaftliche Formation habe sich an der Wahrnehmung fremden Leids als entscheidende Kategorie allen öffentlichen Handelns zu orientieren.
Für die praktische Theologie gewendet bedeutet dies, multireligiöse Erfahrungen so zu fokussieren, dass in ihnen eine Wahrnehmung fremden Leids gelehrt und eine Kultur der Anerkennung entwickelt wird.
Es stellt sich aber noch die Frage, wie denn mit dem Phänomen einer Multireligiosität ad intra umzugehen sei. Denn nicht länger ist von einem homogenen Glauben innerhalb des Christentums, noch nicht einmal innerhalb des Katholizismus, auszugehen. Gab es immer schon Differenzen im Gottesverständnis auf der Ebene der theologischen Reflexion, die schließlich zu den großen theologischen Debatten und dogmatischen Definitionen führten, so gibt es heute deutliche Differenzen im religiösen Alltagsbewusstsein, die freilich nicht mehr kontrovers diskutiert werden, sondern – wiederum der postmodernistischen Mentalität folgend – gleich gültig nebeneinander stehen bleiben. In der kirchlichen Praxis führt dies dann natürlich dazu, dass – wenn denn überhaupt noch ein Gottesbezug supponiert werden kann – dieser äußerst heterogen ist. Eine Verständigung über die Differenz setzt aber eine Diskursbereitschaft und eine Diskursfähigkeit voraus, die angesichts diffuser Religiosität nur schwer vorausgesetzt werden kann. Es ergeben sich somit zwei Problemkreise: zum einen, die Multireligiosität innerhalb eines Spektrums unterschiedlicher kultureller Herkünftigkeit zu berücksichtigen, zum anderen aber, jene christliche Multireligiosität erstmals zu thematisieren, die Differenzen herauszuarbeiten und in einen Vermittlungsprozess zu überführen.
Dabei ist auch ohne große Reflexion evident, dass der zweite Problemkreis wesentlich schwieriger zu bearbeiten ist als der erste. Es mag paradox erscheinen, aber gerade hinsichtlich der Multireligiosität ad intra sind wiederum Anfragen von jenseits des Christentums ein erster wichtiger Schritt, da in der Tat nicht mehr auf vorfindbares Wissen oder gar Erfahrungen bei einem großen Teil der betroffenen Subjekte zurückgegriffen werden kann. Wenn aber hier die Sprachlosigkeit herrscht, muss der Versuch gemacht werden, durch externe Anfragen an das Christentum so etwas wie einen apologetischen Impuls zu geben. Mag hier auch die Kirchenkritik naheliegen und die Sprachbarrieren ansatzweise zu überwinden helfen, so ist doch gleichwohl tiefer anzusetzen, um mithilfe der genuinen Religionskritik an wesentliche Anfragen an die jüdisch-christliche Tradition heranzukommen. Für viele ergibt sich dadurch die Möglichkeit, mit gleichsam bloß geborgten Argumenten eine erste Versprachlichung ihrer eigenen Fragen zu erreichen. Freilich gilt es hier eine Einschränkung zu machen: Die Zeit der großen Atheismen ist nämlich vorbei. Es waren z.B. für die Religionspädagogik geradezu noch paradiesische Zustände, als vor allem kritische Schülerinnen und Schüler auf der Basis der großen Atheismen in den Diskurs mit dem Christentum einstiegen. Davon kann heute keine Rede mehr sein.
Hinsichtlich der ersten Problemstellung, der Multireligiosität ad extra werden beispielsweise in der Religionspädagogik immer mehr Stimmen laut, der konfessionell gebundene Religionsunterricht sei zugunsten einer multireligiösen Orientierung im Sinne des religionskundlichen Unterrichtes aufzugeben und allen Religionen der gleiche Stellenwert einzuräumen.33 Ohne hier nun den strikt konfessionellen Religionsunterricht einfachhin zu verteidigen, sei jedoch wenigstens auf das Problem der Auflösung dieser Bindung – oder sagen wir hier: der Auflösung der christlichen Bindung – hingewiesen. Studien aus den Jahren 1998 und 1999 bezogen auf die britische Situation, in der diese Bindung schon längst nicht mehr vorhanden ist, zeichnen ein differenziertes Bild religionskundlichen Unterrichts. Es wird darin erstens gefragt, ob die säkulare Weltanschauung, die hinter diesem Modell sich verbirgt, die die Möglichkeit eines ideologiefreien Erkennens vorgebe, nicht selbst eine Ideologie sei, die darin bestehe, die Wahrheitsansprüche der Religionen faktisch zu relativieren; zweitens, ob hinter einer solchen Didaktik ein instrumentelles Verständnis von Bildung stecke, wonach die Schüler mit ihren eigenen Fragen gar nicht mehr vorkämen und insofern für die Vermittlung abstrakter Inhalte instrumentalisiert würden, drittens aber wird gefragt, ob eine Negierung der eigenen Traditionsvorgaben nicht einen hermeneutischen Rückschritt darstelle, so dass die Lehrenden selbst ihre Tradition vergessen müssten, damit ein adäquater religionskundlicher Unterricht möglich sei.
Die letzten Bemerkungen leiteten schon über zu der Frage, wie denn das Christentum selbst noch tradiert werden könne in einer Situation offensichtlicher Krise. Nun ist diese Krise keinesfalls neu. Sie hat zunächst ihre Basis und ihren Ausgangspunkt in der Aufklärung, die ja gründlich mit Tradition überhaupt aufgeräumt hat. Tradition verliert in der Aufklärung ihre Handlung bestimmende und Leben orientierende Kraft und wird Objekt historischer Erkenntnis und damit auch Arsenal für das Informations- und Nachrichtenbedürfnis der aufgeklärten Vernunft. Letztlich führt jedoch auch schon der Prozess der Historisierung von Tradition zu ihrer Entwichtigung.
Tradition – das sei hier auch nur angedeutet – lässt sich mit den Kategorien der Tauschgesellschaft nicht mehr vermitteln. Es ist die Gefahr des aufgeklärten Bürgertums, „alles, was nicht dem Kalkül der rechnenden Vernunft pariert und sich nicht den Gesetzen des Marktes, d.h. des Profits und des Erfolgs unterwirft, der privaten Beliebigkeit und Unverbindlichkeit des einzelnen zu überlassen. Wie er die Religion zur Service-Religion macht, an die er sich privat wendet, so macht der Bürger auch die Tradition zum Wert, dessen er sich privat bedient. – Kulturindustrie ist ein später Ausdruck für diesen Vorgang, der in der Aufklärung angelegt ist“34.
Wenn wir heute in einem praktisch-theologischen Kontext von Tradition und deren Krise sprechen, dann stecken die grundlegenden Veränderungen der Aufklärung noch darin, wenngleich in veränderter Form. War nämlich die Aufklärung noch um die Kritik an Tradition bemüht, so wäre heute diese Kritik – analog der Kritik der Religion – eine wichtige Basis der Auseinandersetzung. Die Krise der Tradition ist heute vielmehr begrifflich kaum noch fassbar. In ihr steckt zum einen der generelle Verlust an Bezugssystemen, in ihr steckt vor allem aber auch ein Grundzug postmoderner Mentalität, nämlich der Hang zum Vergessen, der allerdings noch einmal gleichsam schleichend sich zeigt, keinesfalls eine bewusste Entscheidung oder gar Strategie darstellt, sondern vielmehr den gesellschaftlichen und kulturellen Trends geschuldet ist. Erinnerung gibt es nämlich beinahe schon gar nicht mehr; ‚ich muss auch gar nicht mehr erinnern, ich habe doch einen Computer, der für mich nichts vergisst. Ich muss nur daran denken, rechtzeitig zu speichern.’
Zunächst aber soll der Befund der Enttraditionalisierung eingebunden werden in den postmodernistischen Individualisierungstrend.
„Die Individuen müssen“, so meint Ulrich Beck, „um nicht zu scheitern, langfristig planen und den Umständen sich anpassen können, müssen organisieren und improvisieren, Ziele entwerfen, Hindernisse erkennen, Niederlagen einstecken und neue Anfänge versuchen. Sie brauchen Initiative, Zähigkeit, Flexibilität und Frustrationstoleranz. Chancen, Gefahren, Unsicherheiten der Biographie, die früher im Familienverbund, in der dörflichen Gemeinschaft, im Rückgriff auf ständische Regeln oder soziale Klassen definiert waren, müssen nun von den einzelnen selbst wahrgenommen, interpretiert, entschieden und bearbeitet werden. Die Folgen – Chancen wie Lasten – verlagern sich auf die Individuen, wobei diese freilich angesichts der hohen Komplexität der gesellschaftlichen Zusammenhänge, vielfach kaum in der Lage sind, die notwendig werdenden Entscheidungen fundiert zu treffen, in Abwägung von Interesse, Moral und Folgen.“35
Unter postmodernen Bedingungen hat also nunmehr die Biographie zu ersetzen, was einst die kollektiven Bindungen gewährleisteten. Diese aber waren noch einmal fundiert in mehr oder weniger stabilen Traditionen, die freilich nicht per se gut, hilfreich und unproblematisch waren, erst recht, wenn Tradition gleichsam traditionalistisch verstanden wird. Was aber neu ist an unserer Situation, das ist, dass die kulturellen Traditionen, die es zwar noch immer gibt, ihre unhinterfragten normativen Gehalte verlieren. Viele andere Wert- und Sinnsysteme erhalten nun die gleiche Dignität und das Individuum steht vor der schwierigen Aufgabe, aus der Vielfalt der Möglichkeiten entweder eine sich auszusuchen oder aber selbst einen neuen Mix herzustellen in Gestalt individueller Synkretismen, die gleichwohl ohne besondere Stringenz, vielmehr durch Lust gekennzeichnet sind.
Dass von dieser Entwicklung, also der Erosion der normativ-kulturellen Überlieferung, die traditionellen Religionen und Konfessionen in besonderer Weise getroffen sind, versteht sich von selbst. In weiten Teilen gelten sie schließlich als Wahrer der Tradition schlechthin. Dabei stimmt es natürlich, dass gerade die jungen Menschen dies nicht mehr so sehen und in der Tradition eher einen schlichten Traditionalismus vermuten, den sie freilich nicht so nennen würden und könnten. Auch greift es zu kurz, dies einfachhin der Säkularisierung anzulasten, in der die Religion sich nach und nach ihrer Plausibilitäten entledigt und damit überflüssig wird. Das Individualisierungstheorem hat hier zu einer differenzierteren Betrachtungsweise geführt, indem natürlich gesehen wird, dass die institutionalisierte Religion – also in unserem Kontext das Christentum – eine gravierende Depotenzierung erfahren hat, dass aber andererseits damit nicht ein Verlust von Religion an sich zu verzeichnen ist, dass vielmehr auch hier eine individualisierte Religion entstanden ist. Schon Ende der 60er Jahre hat der amerikanische Religionssoziologe Thomas Luckmann hier eine „unsichtbare Religion“36 zu entdecken geglaubt. In einer empirischen Studie aus der Schweiz Anfang der 90er Jahre lassen sich diese Tendenzen nunmehr verifizieren. Alfred Dubach und Roland Campiche haben vier typische Ausprägungen zeitgenössischer Religiosität herausgestellt:
1. Individuell-autonome Religiosität: Der Ort von Religion „verschiebt sich aus dem Bereich der kirchlich institutionalisierten Religion in denjenigen des Individuums“. Das Individuum ist die Instanz, die seine Religiosität selbst zu wählen und zu verantworten hat. Eine „quasi-automatische Übernahme vorgeformter, kirchlich bereitstehender Lebensdeutungen und Frömmigkeitsformen“ geschieht in der Regel nicht mehr. Die erfolgte Pluralisierung auch im religiösen Bereich kommt dem Anspruch der Autonomie entgegen.
2. Bedarf nach religiöser Selbstthematisierung: „Mit der Autonomie und der Option für Pluralität ist implizit ein weiteres Element moderner Religiosität gegeben: Religion ist unter den Bedingungen der Moderne zunehmend nur mehr im Medium von Subjektivität oder gar nur als Subjektivität darstellbar.“ Das, wie bereits herausgestellt, starke Zurückgeworfensein der einzelnen auf ihr eigenes Selbst bedingt, dass die Frage nach der persönlichen Identität zunehmend zum zentralen Thema wird und dabei stark religiöse Züge annimmt.
3. Selbstbestimmt-pragmatisches Verhältnis zu den Kirchen: Die kirchliche Mitgliedschaft wird immer noch relativ selten ausdrücklich aufgekündigt (auch wenn die Zahl derer, die es tut, sich beträchtlich erhöht hat); sie wird als ein Element der persönlichen Lebensgeschichte gelten gelassen, das von Fall zu Fall auch aktiviert wird. Diese „Fälle“ werden allerdings von den Betroffenen bestimmt und nicht durch institutionelle Vorgaben gesteuert. Diese werden – wenn überhaupt – als fakultatives Angebot wahrgenommen.
4. Vielfalt religiöser Orientierungen und Attraktivität neureligiöser, esoterischer Ausformungen: Die Schweizerische Bevölkerung bezeichnet sich mehrheitlich als christlich. Faktisch geht damit eine Vielfalt religiöser Ausdrucksformen einher, nicht nur außerhalb der Kirchen, sondern auch innerhalb. Hierbei spielen die herkömmlichen konfessionellen Grenzziehungen so gut wie keine Rolle mehr. Das Spektrum reicht von religiöser Indifferenz über eine weit verbreitete und synkretistisch durchsetzte „diffuse Religiosität“ bis hin zu auf bewußter Entscheidung beruhenden Minderheitsreligiositäten sowohl fundamentalistischer als auch „aufgeklärter“ Spielart. Neureligiöse Orientierungen und Praktiken sind für manche Zeitgenossen deswegen attraktiv, weil sie – anders als in den traditionellen Kirchen – dort ihre Lebenssehnsüchte, Ängste und Nöte aufgenommen sehen.37
Was für die Schweiz galt, ist sicherlich auf bundesdeutsche Verhältnisse übertragbar. Die Erkenntnisse dürften uns – nach allem was wir bisher reflektierten – kaum besonders irritieren. Dennoch stellen sie uns vor enorme Herausforderungen; zumindest wenn wir noch einmal das Projekt der Individualisierung im Rahmen von Moderne und Postmoderne in den Blick nehmen:
Es ist nachvollziehbar, wenn man in dem Individualisierungsschub der Postmoderne eine gewisse Radikalisierung des Freiheitpathos’ der Moderne sieht. Die Bedingung für die Individualisierung war die weitgehende Dezentrierung der traditionsorientierten Milieus und die ungeheure Ausweitung der individuellen Handlungsspielräume. Insofern kann man tatsächlich einen enormen Freiheitszuwachs verzeichnen. Allerdings ist mit Habermas und Peukert zu fragen: Welcher Freiheit? Denn selbstverständlich sind verschiedene Freiheitskonzeptionen denkbar. Das Projekt der Moderne kennt zwei grundverschiedene Freiheitskonzeptionen: Zum einen gibt es jene der totalen Selbstbestimmung, der radikalen Autonomie des von allen äußeren Zwängen losgelösten Subjektes; zum anderen aber wird mit großem Recht betont, Freiheit sei nur zureichend erfasst und praktiziert, wenn die je eigene Freiheit ihren Maßstab und ihre tiefste Begründung in der freien Anerkennung des Anderen in seiner Andersheit finde und dass daher Freiheit nur als Akt der Intersubjektivität begriffen und praktiziert werden könne.
Der ersten Variante folgt eine Logik der Selbstbehauptung und Machtsteigerung, die man auch als instrumentell kennzeichnen könnte, der zweiten folgt eine Logik kommunikativer Praxis der wechselseitigen Anerkennung. Diese Unterscheidung ist insofern folgenreich, da für die pädagogische Praxis mit dem Ziel eines angemessenen Verständnisses sozialisatorisch-pädagogischer Interaktion nur das zweite Modell infrage kommt, als ein intersubjektives Handeln nämlich, „das dem anderen Freiheit als seine ursprüngliche Möglichkeit nie abspricht, sondern schon immer vorgreifend voraussetzt und darin seine unantastbare Würde sieht“38. Nun ist allerdings davon auszugehen, dass der gesellschaftlich relevante Freiheitsbegriff und das praktizierte Freiheitskonzept gerade ein solches Verständnis permanent unterläuft und dadurch fundamental erschwert.
Spätestens hier – so kann man mit Axel Honneth folgern – wirkt sich der Verlust von Traditionen verhängnisvoll aus, denn es „droht mit der Erosion der kulturell-normativen Überlieferungen, wie sie die geschichtsphilosophischen Konstruktionen etwa der sozialistischen oder religiösen Traditionen bereitstellten, […] die Gefahr einer Austrocknung des kulturell-normativen Interaktionsmediums der Lebenswelt“39, denn solch narrativ verfasste Überlieferungen waren es, „in denen sich die Mitglieder eines Gemeinwesens in ihrer Gegenwart noch kommunikativ auf eine gemeinsame Vergangenheit und eine entsprechend konstruierte Zukunft hin verständigen konnten“40.
Ich möchte dies mit dem schon angedeuteten Erinnerungsverlust noch einmal von einer anderen Seite vertiefen, denn der Verlust von Tradition hat seine Grundlage nicht nur in den Individualisierungs- und Freiheitstendenzen, sondern auch im Verlust von Erinnerung, die uns Christinnen und Christen besonders stark betrifft: immerhin ist unsere Glaubensgemeinschaft wesentlich auch Erinnerungsgemeinschaft, die sich jeden Sonntag um einen Tisch versammelt und dies „in seinem Gedächtnis“ tut. Sie erinnert dabei sowohl Freiheits- wie auch Leidensgeschichte und eröffnet gerade erinnernd eine Zukunft für alle Menschen – nicht nur für die versammelte Gemeinde. Wenn nun Erinnerung und damit Tradition immer mehr verloren zu gehen droht, bedroht das das Christentum im Ganzen – wenn auch auf eine zunächst subtile Art und Weise. Es ist eine schleichende Bedrohung, wie auch der Erinnerungsverlust ja kein spektakulärer, sondern ein schleichender Prozess ist. Schon Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts41 hat das Magazin „Time“, das jedes Jahr den Menschen des Jahres kürt, eine bahnbrechende Neuorientierung vorgenommen, indem es auf der Titelseite den Menschen des Jahres vorstellte, der aber gar kein Mensch war, sondern ein Roboter; der aber gespickt mit Elektronik das grundlegende Defizit des Menschen nicht mehr besitzt, der nämlich nichts erinnern kann, weil er gar nichts vergessen kann. Es ist eine Intelligenz ohne Geschichte, ohne Leidensfähigkeit – und ohne Moral.
Gegen diese kulturelle Amnesie setzt die jüdisch-christliche Tradition das Erinnern. Dabei ist natürlich wenigstens ganz grob eine Unterscheidung angezeigt. Es gibt wenigstens drei große Erinnerungskonzeptionen: die platonische Anamnesislehre, die eschatologische memoria des Christentums und die Synthese beider in der Hegelschen Philosophie.
Anamnesis ist im Grunde der Schlüsselbegriff der platonischen Philosophie: Sie wird für Platon dadurch fundamental, dass er sie als ermöglichenden Grund formeller „vernünftiger“ Erkenntnis überhaupt versteht, sie also als Konstitutionsproblem der Vernunft thematisiert. Erkenntnis ist eine Erkenntnis vorgewusster und insofern erinnerungsgeleiteter Wahrheit. Diese Position zieht sich durch die gesamte Philosophiegeschichte: über Anselm von Canterbury bis zu Descartes und der bei ihnen formulierten eingeborenen Idee Gottes, bis hin zu Heideggers Erinnerung als Eintauchen in die vorgängige Wahrheit. Mit Kant gab es die erste grundlegende Irritation dieses Konzepts, indem er darauf hinwies, dass die Vernunft nie etwas anderes erkennen könne, als das der Vernunft Zugängliche, dass mithin ein Block zwischen der Möglichkeit immanenter und transzendenter Erkenntnis liege, was indes nicht bedeutet, dass damit Transzendenz geleugnet wäre.
Als Erinnerungs- und Erzählgemeinschaft verortet sich das Christentum nun in einer Welt des griechischen Logos und der Metaphysik. Anders als diese beansprucht das Christentum nicht einen abstrakten Erinnerungsbegriff, vielmehr weiß es seine Erinnerungen auf geschichtliche Ereignisse, ja letztlich auf ein geschichtliches Ereignis hin bezogen: nämlich die eschatologische Erlösung und Befreiung des Menschen durch Gott, die es als unwiderruflich angebrochen glaubt. Erinnerung nimmt hier einen neuen Status an, nämlich als eine Erinnerung nach vorn, nachdem in der Geistesgeschichte Erinnerung immer nur eine nach hinten war.
In der Hegelschen Philosophie kommt nun die Synthese insofern zustande, als nunmehr die Philosophie gezwungen ist, Wahrheit auf dem geschichtlichen Stand ihrer Vermittlung zu denken, ihre Allgemeinheit gewissermaßen aus geschichtlicher Apriorität zu begreifen. So wird sie auch zur kritischen Erinnerung, zumindest als „Empfindlichkeit gegen jede Form von Unterbietung des erreichten Stands“42 und in eins damit als Protest gegen jede begriffslose Unterwerfung unter vorgegebene Zustände. Dass natürlich hier weitergehende Differenzierungen nötig wären, versteht sich von selbst. Ich möchte aber nur eine Weiterführung der Hegelschen Position, die dann auch theologisch wichtig wurde, noch kurz ansprechen: nämlich die „gefährliche Erinnerung“ in der sog. Frankfurter Schule. Zwei Namen sind hier zunächst wichtig: Walter Benjamin und Herbert Marcuse.
In den geschichtsphilosophischen Thesen43 entfaltet Benjamin die Erinnerung der Leidensgeschichte der Welt als Vermittlung einer Verwirklichung von Vernunft und Freiheit, die sich gegen ein undialektisches Verständnis von Fortschritt wendet. Gerade im Angesichte ungeheueren Fortschritts verschafft der Blick in die Vergangenheit wichtige und kritische Erkenntnisse. Eher psychologisch ansetzend kommt Herbert Marcuse zu ähnlichen Ergebnissen, wenn er betont, die „wiederentdeckte Vergangenheit“ liefere „kritische Maßstäbe“ und werde zum „Vehikel der Befreiung“44. Gesellschaftskritisch gewendet heißt dies dann bei Marcuse:
„Die Erinnerung an die Vergangenheit kann gefährliche Einsichten aufkommen lassen, und die etablierte Gesellschaft scheint die subversiven Inhalte des Gedächtnisses zu fürchten. Das Erinnern ist eine Weise, sich von den gegebenen Tatsachen abzulösen, eine Weise der ‚Vermittlung’, die für kurze Augenblicke die allgegenwärtige Macht der gegebenen Tatsachen durchbricht. Das Gedächtnis ruft vergangene Schrecken wie vergangene Hoffnung in die Erinnerung zurück. Beide werden wieder lebendig, aber während jener in der Wirklichkeit in stets neuen Formen wiederkehrt, bleibt diese in Hoffnung. Und in den persönlichen Begebenheiten, die im individuellen Gedächtnis neu erstehen, setzen sich die Ängste und Sehnsüchte der Menschheit durch – das Allgemeine im Besonderen. Die Geschichte ist es, die die Erinnerung bewahrt, aber auch sie unterliegt der totalitären Gewalt des verhaltensmäßigen Universums.“45
Adorno, der dritte wichtige Name in diesem Zusammenhang, betont in erkenntniskritischer Absicht:
„Was im Denken geschichtlich ist, anstatt der Zeitlosigkeit der objektivierten Logik zu parieren, wird dem Aberglauben gleichgesetzt, der in der Berufung auf kirchlich institutionelle Tradition wider den prüfenden Gedanken tatsächlich war. Die Kritik an Autorität hatte allen Grund. Aber sie verkennt, daß Tradition der Erkenntnis selbst immanent ist als das vermittelnde Moment ihrer Gegenstände. Erkenntnis verformt diese, sobald sie kraft stillstellender Objektivierung damit tabula rasa macht. Sie hat an sich noch in ihrer dem Gehalt gegenüber verselbständigten Form, teil an Tradition als unbewußte Erinnerung; keine Frage könnte nur gefragt werden, in der Wissen vom Vergangenen nicht aufbewahrt wäre und weiterdrängte.“46
Adorno aber weiß schon von der Fragilität der Tradition und der damit einhergehenden Erinnerungsschwäche. Er selbst gibt die Aporie von Tradition an:
„Wie die in sich verbissene Tradition ist das absolut Traditionslose naiv: ohne Ahnung von dem, was an Vergangenem in der vermeintlich reinen, vom Staub des Zerfallenen ungetrübten Beziehung zu den Sachen steckt. Inhuman aber ist das Vergessen, weil das akkumulierte Leiden vergessen wird; denn die geschichtliche Spur an den Dingen, Worten, Farben und Tönen ist immer die vergangenen Leidens. Darum stellt Tradition heute vor einen unauflöslichen Widerspruch. Keine ist gegenwärtig und zu beschwören; ist aber eine jegliche ausgelöscht, so beginnt der Einmarsch in die Unmenschlichkeit.“47
2.4 Ortlosigkeit als theologisches Problem
Schon in der berühmten Rede des Dominikaners Melchior Cano über die loci theologici, mit der im katholischen Raum des 16. Jahrhunderts die Grundlage für die Fundamentaltheologie als universitäre Disziplin gelegt wurde, wird zwar von Orten gehandelt, die aber gleichsam ortlos bleiben, insofern sie bloß formalen Gesichtspunkten folgten und unter Absehung jeglichen Subjektbezugs formuliert waren.48 Er führt zehn spezifische Orte auf, nämlich: die Heilige Schrift, die Tradition, die katholische Kirche, die Konzilien, die römische Kirche, die Kirchenväter, die scholastischen Theologen, die menschliche Vernunft, die Philosophie und die menschliche Geschichte. Es geht also gerade nicht um den spezifischen Ort der Theologie, sondern um erkenntnistheoretische Fragen hinsichtlich der Quellen der Theologie.49
Früh also ist die Ortlosigkeit schon in die Theologie hineingekommen, obwohl doch Theologie von Anbeginn nie ortlos gedacht werden darf. Waren nicht biblische Reflexionen immer an bestimmte Subjekte, mit bestimmten Fragestellungen an bestimmten Orten orientiert? War nicht die älteste Jesustradition immer mit spezifischen Ortsbezügen verbunden? Lag es nicht wesentlich im paulinischen Interesse, Orte zu gestalten und damit Nachfolgepraxis zu sichern? War nicht in all diesen Traditionen immer auch eine Orientierung an bestimmten Subjekten als Trägerinnen der Botschaft konstitutiv? Es brauchte schon eine gehörige Portion an philosophischer Überfrachtung der theologischen Traditionen, diese Bezüge zu tilgen oder wenigstens weit in den Hintergrund zu drängen.
Die formalisierte und subjektlose Ortlosigkeit eines Melchior Cano wurde erst im 20. Jahrhundert wieder revidiert, indem in Auseinandersetzung mit den Traditionen der Aufklärung das Subjekt wieder stärker in den Blickpunkt theologischer Fragen gestellt wurde, wobei hier konzediert werden muss, dass unter dem semantischen Deckmantel der Subjektorientierung gleichsam eine Verobjektivierung des Subjekts stattgefunden hat. Wenn in der Folge der anthropologischen Wende der Theologie etwa von dem Menschen gesprochen wird, stellt sich die Frage, wer denn dieser Mensch oder diese Menschen in concreto sind. Es ließe sich gegen diese Abstraktheit mit Marx einwenden, der Mensch sei gerade nicht ein außerhalb der Geschichte hockendes Wesen.50 Sinnfällig findet sich dies ausgedrückt in der praktisch-theologischen Orientierung der Kirche als Kirche für das Volk, statt einer Kirche des Volkes. Spätestens aber mit dem II. Vatikanischen Konzil und erst recht mit den daran anschließenden regionalen Synoden bzw. Bischofsversammlungen wurde dies von der lehramtlichen Seite korrigiert. Aber auch die Spezifizierung „des Volkes“ bleibt noch eigentümlich unpräzise, wenn nicht die allumfassende Bestimmung des Volkes Gottes angenommen werden soll, wie dies in LG grundgelegt ist, was zwar ekklesiologisch eine ungeheuere Bedeutung hat, aber in der konkreten Fragestellung nach den Orten der Theologie noch präzisiert werden muss. Dann wäre zu fragen: Wer sind die konkreten Subjekte? In welchen konkreten Situationen leben sie? Wie reagiert die kirchliche Praxis mithilfe der theologischen Reflexion darauf? Hilfreich ist an dieser Stelle der Rekurs auf jene theologischen Ansätze, die am deutlichsten die Subjektfrage zu konkretisieren versuchten, wohl wissend, dass es bei diesen Präzisierungen nicht um Ausschließlichkeitsfragen geht, also in politischen Theologien der Befreiung, die von dem Impuls beseelt sind, den Stimmlosen eine Stimme zu geben. Selbstverständlich sind diese nicht allein auf dem lateinamerikanischen Kontinent zu finden. Tiemo Rainer Peters weist mit großem Recht auf die neuen Orte hin: „Die neuen Orte waren Basisbewegungen, soziale Konfliktfelder, Elendszonen am Rand der Gesellschaft und an den Peripherien der Welt: Orte der Bewährung, nicht des abstrakten Wahrheitsanspruchs.“51 Und er betont: „Wäre nicht die einzige Form, die Theologie darzustellen, die, ihre Praxisfelder und Kontexte zu erläutern, ihre Autoren dort, wo sie engagiert sind, zu Wort zu bringen und den theologischen Begriff erst dann zu entfalten, wenn er ausgewiesen wäre durch ein Tun, ein Leiden, einen Kampf?“52
Für den lateinamerikanischen Kontinent lässt sich dies folgendermaßen beschreiben: „Befreiungstheologie und –praxis sind die zwei Seiten einer Münze, die die Härte ihrer Währung […] nachweist im gläubig-praktischen Erinnerungsvorgang, im Sprech- und Verständigungsprozeß und in der Organisation von solidarischer Hoffnung mit und unter den Armen und den Anderen. Sie wird ohnmächtig am Ort der Schwachen und marginal an der Peripherie der Menschheit. An den dunklen Rändern der Geschichte versucht sie Licht zu sein, notwendiges Instrument im Dienst und in der Hand derer, die in der gesamtwirtschaftlichen Rechnung der jeweiligen Verhältnisse stumm, überflüssig und hinderlich geworden sind. Befreiungstheologie führt ihr Gespräch nicht aus dem Fenster des theologischen Oberbaus auf die Straße hinaus mit den Armen und Anderen. Sie kann nicht Theologie guter Zurufe und Tröstungen, kann nicht Schreibtischtheologie sein.“53
Sind diese Verortungen der Theologie anachronistisch? Sind sie gar romantisch? Haben zeit-, ideologie- und gesellschaftskritische Theologien ausgedient? Fehlen die Orte der Bewährung? Doch gewiss nicht! Der pastoralen Herausforderungen sind nicht wenige, vielleicht sogar mehr, als je zuvor. Aber hat die Theologie, hat die Pastoral die Kraft, sich ihnen zuzuwenden? Besitzt sie das notwendige Potential, neue Orte zu besetzen und in ihnen produktiv und kreativ sich zu bewähren? Vielmehr allerdings scheint es, als reduziere sich das kirchliche Handeln auf die Orte, die immer schon kirchliche waren und es doch auch tunlichst bleiben sollen.
Gleichwohl gibt es hier auch praktisch-theologisch wichtige Veränderungen. Am deutlichsten hat Michael N. Ebertz auf die notwendige Veränderung der kirchlichen Orte hingewiesen, da aufgrund der verschiedenen gesellschaftlichen Veränderungen – Schwund in der kirchlich verfassten Religionsausübung, Pluralisierung von Religion und Kultur, Prozesse der Individualisierung, etc. – die Ortsgemeinde nicht mehr der Ort sei, der darauf adäquat zu reagieren in der Lage sei.54 Schließlich lebten Menschen nicht mehr in solch überschaubaren und homogenen Räumen, wie dies noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall war, Arbeits- und Sozialräume seien deutlich topologisch deutlich ausgedehnt, Beziehungen infolgedessen auch weit über den unmittelbaren Wohnraum verstreut uvm. Die Pastoral müsse diesen Veränderungen Rechnung tragen und das Prinzip der Ortsgebundenheit, wie es sich in der Pastoral der Ortsgemeinde abbilde, aufgeben und auf die veränderten Bedürfnisse der Menschen mit veränderten Angeboten reagieren.55 Zudem komme noch ein weiteres Problem hinzu, da durch die gesellschaftlichen Ausdifferenzierungen sehr verschiedene Milieus entstanden seien, die in der traditionellen Pastoral nicht hinreichend Beachtung fänden. Vielmehr finde durch das Prinzip der Ortsgemeinde ein Ausgrenzungsprozess statt, demgemäß nur solche Menschen in der Gemeinde sich beheimatet fühlten, die den gleichen – oder wenigstens ähnlichen – Milieus angehörten. In der Konsequenz seiner Überlegungen fordert Ebertz daher, es müsse fortan über die Ortsgemeinde hinaus gedacht werden, es seien tatsächlich neue Räume zu entdecken, neue Orte zu gestalten, es seien neue Angebote zu generieren, um mit Menschen in Kontakt zu kommen.
Es kann hier nicht darum gehen, die Diagnosen und Vorschläge von Ebertz56 umfassend zu reflektieren. Es bleiben jedoch jenseits der schon weiter oben angesprochenen Angebotsorientierung Fragen, ob nicht in dem richtigen Anliegen, neue Orte der Pastoral zu entdecken und sie entsprechend zu gestalten, das Prinzip der Ortsgemeinde zu schnell und zu leichtfertig verabschiedet wird.57 Dabei kann nicht übersehen werden, dass veränderte gesellschaftliche Verhältnisse Veränderungen in der Pastoral nach sich ziehen müssen. Aber läuft die Preisgabe des Ortsbezugs nicht auch Gefahr, die konkrete Pastoral, die konkrete Arbeit, mithin die Sichtbarkeit der Kirche zunehmend zu virtualisieren? Muss nicht eine alte Erkenntnis berücksichtigt werden, die Ottmar Fuchs so formuliert:
„Auch jede Sachbezogenheit braucht die Ortsgebundenheit, sonst ist die gesamte Situationsbezogenheit des Evangeliums nicht ernst genommen. Gerade die sich in die Lebens- und Notbereiche der Menschen strukturell entfaltende Pastoral darf sich eben nicht in die kategorialen Formen hinein auflösen, in denen die Eucharistie wegen der diversen Adressat/innen-Orientierung seltener präsent ist als in den Gemeindeformen. Die Wohnbezogenheit ist nicht die ausschließliche Ortsbezogenheit, aber immer noch eine ganz wichtige, die zu den verschiedenen Erlebnismilieus in der Gesellschaft quer verläuft. Bei aller Mobilität und passagefähigen Notwendigkeit der Pastoral zwischen Pfarrgemeinden und anderen Sozialformen der Kirche darf sie diesen Bezug nicht vorschnell aufgeben, gerade um die durchaus auch destruktive Mobilität im eigenen Bereich zu bremsen und um dadurch den sonntäglichen Eucharistiebezug zu bewahren.“58
Will also Pastoral dem durchaus berechtigten Anliegen von Ebertz: einer „Kommunikationspastoral“59 folgen, dann muss sie – das weiß auch Ebertz – Orte benennen können, an denen solche Kommunikation möglich ist, an denen aber auch alle wichtigen Fragen des Lebens ihren Ausdruck finden können. Recht verstanden geht es ihm also um „die Weiterentwicklung alter, aber auch den Aufbau neuer pastoraler Orte bzw. Gelegenheitsstrukturen mit mehr oder weniger niederschwelligen und passageren Angeboten in den unterschiedlichen Milieus“60. Möglicherweise aber wird die Ortsgemeinde auch unterschätzt in ihren Fähigkeiten, diesen Herausforderungen sich zu stellen61, auf jeden Fall muss von ihr verlangt werden dürfen, neue Lebensräume erkennt und sie unterstützt, der Vielfalt menschlichen Lebens Rechnung trägt, in ihren Strukturen durchlässiger und in ihren Arbeitsweisen partizipationsgerechter wird, Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet statt sich abzuschließen, gegenüber der eigenen Milieubedingtheit Offenheit für andere zu entwickeln uvm. In seinem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium versteht sich Papst Franziskus als „Hirte einer Kirche ohne Grenzen“ (EG, 210). Was dort unter der Perspektive der Migration geschrieben steht könnte doch auch geltend gemacht werden für andere pastorale Herausforderungen.
Bei all dem gilt schließlich aber auch zu berücksichtigen, dass die Ortsgebundenheit der kirchlichen Praxis nicht Selbstzweck ist, sondern auf die Konkretion der christlichen Optionen hin verwiesen bleibt, von denen her die pastorale Praxis ihr Maß und Ziel erhält. Insofern wäre es auch verkürzt, die Orte der Theologie rein topologisch zu verstehen. Zum einen wären unter solchen u-topischen Orten inhaltliche Verortungen in großer Kontinuität mit den biblischen Traditionen zu verstehen, allerdings aktualisiert und auf der Höhe des Problembewusstseins und den gesellschaftlichen Anforderungen adäquat. Es geht also um einen Vermittlungsprozess zwischen Tradition und Zukunft in der Jetztzeit. Dazu braucht es Theologen oder Intellektuelle, die diesen Prozess steuern, dabei aber nicht jenseits der gesellschaftlichen Verhältnisse stehen, sondern aus ihnen heraus in sie zurück wirken und so zu „organischen Intellektuellen“62 werden, allerdings mit der notwendigen Präzisierung, dass unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen eine politische Unmittelbarkeit nicht mehr zu haben ist. Vielmehr besteht nun eine Dialektik zwischen unmittelbar politischer Abstinenz und politischer Unmittelbarkeit, in die sich ein „organischer Intellektueller“ gestellt sieht.63 Zum anderen aber könnte Theologie selbst zu einem Ort, nämlich zum Ort der Auseinandersetzung werden und so die gesellschaftlichen Widersprüche weder ignorieren, noch vermittels heute besonders beliebter Erst- und Letztbegründungsstrategien sich diesen zu entziehen oder – noch schlimmer – sich zu immunisieren, sondern sich ihnen zu stellen und dann aber auch Stellung zu beziehen. Es war die Politische Theologie, die sich dieser Aufgabe stellte. Sie wird als Grundlage unserer Untersuchung später noch weiter entfaltet.
1 Das ist auch insofern noch einmal wichtig, weil die Pastoralkonstitution nicht nur material von der Welt handelt, sondern das Weltverhältnis der Kirche ekklesiologisch in das Wesen der Kirche einträgt und somit diesem Weltverhältnis einen Rang zuspricht, der der dogmatischen Kirchenkonstitution in Verbindlichkeit nichts nachsteht. Vgl. dazu exemplarisch zu den vielfältigen Kommentaren: Rahner, K., Zur theologischen Problematik einer „Pastoralkonstitution“, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd VIII, Zürich / Einsiedeln / Köln 1967, 613-636
2 Vgl. Metz, J. B., Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft, Freiburg i. Br. 2006
3 Adorno, Th. W., Negative Dialektik – Jargon der Eigentlichkeit, Zur deutschen Ideologie. Gesammelte Schriften Bd. 6, Frankfurt am Main 41990, 203
4 Adorno, Th. W., Ästhetische Theorie, Gesammelte Schriften Bd. 7, Frankfurt am Main 1972, 229
5 Vgl. Gutiérrez, G., Wie kann man von Ayacucho aus von Gott sprechen? In: Conc 26(1990)68-74
6 de Broucker, Les nuits d’un Prophète. Dom Helder Camara à Vatican II, Paris 2005, 24 ff; zit. n. Klein, N., Nächtliche Korrespondenz aus Rom. Zu den „Konzils-Rundbriefen“ von Helder Camara, in: Orientierung 73(2009)185-188; 185
7 Veerkamp, T., Der Gott der Liberalen. Eine Kritik des Liberalismus, Hamburg 2005, 20 f.
8 Elias, N., Die Gesellschaft der Individuen, Frankfurt 1987, 273
9 Steinkamp, H., Solidarität und Parteilichkeit. Für eine neue Praxis in Kirche und Gemeinde, Mainz 1994, 64
10 Vgl. Schulze, G., Die Erlebnisgesellschaft, Frankfurt 1992, 277 ff.
11 Sozialcharakter ist der „Kern der Charakterstruktur“, der von den meisten Angehörigen einer Gesellschaft geteilt wird.
12 Kuzmics, H., Der Preis der Zivilisation, Frankfurt / New York 1989, 173
13 Adorno, Th. W., Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt am Main 1985, 42
14 Zu dieser Fragestellung vgl. über die Werke von Habermas hinaus darstellend: Wellmer, A. Kommunikation und Emanzipation. Überlegungen zur „sprachanalytischen Wende“ der Kritischen Theorie, in: Jaeggi, U. / Honneth, A. (Hrsg.), Theorien des Historischen Materialismus, Frankfurt am Main 1977, 465-500; ders., Reason, Utopia, and the Dialectic of Enlightenment, in: ebd. 35-66; Honneth, A., Von Adorno zu Habermas. Zum Gestaltwandel kritischer Gesellschaftstheorie, in: Bonß, W. / Honneth, A. (Hrsg.), Sozialforschung als Kritik. Zum sozialwissenschaftlichen Potential der Kritischen Theorie, Frankfurt am Main 1982, 87-126; Schnädelbach, H., Transformation der Kritischen Theorie. Zu Jürgen Habermas’ ›Theorie des kommunikativen Handelns‹, in: ders., Vernunft und Geschichte. Vorträge und Abhandlungen, Frankfurt am Main1987, 238-259; Roderick, R., Habermas und das Problem der Rationalität, Hamburg 1989; und kritisierend: Rademacher, C., Versöhnung oder Verständigung? Kritik der Habermasschen Adorno-Revision, Lüneburg 1993; Lövenich, F., Paradigmenwechsel. Über die Dialektik der Aufklärung in der revidierten Kritischen Theorie, Würzburg 1990; Moritz, P., Kritik des Paradigmenwechsels. Mit Horkheimer gegen Habermas, Lüneburg 1992; die verschiedene Aufsätze in: Bolte, G. (Hg.), Unkritische Theorie. Gegen Habermas, Lüneburg 1989
15 Adorno, T. W., Negative Dialektik, a.a.O., 156
16 Habermas, J., Die Neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V, Frankfurt am Main 1985, 182
17 Ebd., 189
18 Mette, N., Religionspädagogik, Düsseldorf 1994, 40
19 Hegel, G. W. F.., Grundlinien der Philosophie des Rechts, Theorie Werkausgabe, Frankfurt 1970, 3. Teil, 2. Abschnitt, § 182
20 Fuchs, G., Neue Gnosis – alte Kirche, in: Biesinger, A. / Braun, P. (Hg.), Jugend verändert Kirche, München 1989, 49-79; 62 f.
21 Vgl. zu all dem grundlegend: Brückner, P., Zur Sozialpsychologie des Kapitalismus. Sozialpsychologie der antiautoritären Bewegung I, Frankfurt am Main 41973
22 Eisenberg, G., Amok – Kinder der Kälte. Über die Wurzeln von Wut und Haß, Reinbek bei Hamburg 2000, 217
23 Vgl. Habermas, J., Die neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt am Main 1985
24 Beck, U., Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main 1986, 217
25 Vgl. Lähnemann, J., Unterrichtsprojekte Weltethos, Bd. 1: Grundschule – Hauptschule – Sekundarstufe I; Bd. 2: Realschule – Gymnasium – Berufsschule, Hamburg 2000; Leimgruber, S., Interreligiöses Lernen, München 1995; Richers, F., Alltagserfahrungen im interreligiösen Kontext, Neukirchen-Vluyn 2000; Ziebertz, H.-G., Mono-, multi- oder interreligiös? Religionen im Religionsunterricht. In: Ders., Religionspädagogik als empirische Wissenschaft, Weinheim 1994, 141-194; Gaitanides, S., Vgl. Interkulturelles Lernen in einer multikulturellen Gesellschaft. In: Sozialmagazin 2/1994, 26-33
26 Vgl. zum folgenden Metz, J.B., Compassion. Zu einem Weltprogramm des Christentums im Zeitalter des Pluralismus der Religionen und Kulturen, in: ders. / Kuld, L. / Weisbrod, A. (Hrsg.), Compassion. Weltprogramm des Christentums. Soziale Verantwortung lernen, Freiburg 2000, 9-18
27 Vgl. Assman, J., Monotheismus und die Sprache der Gewalt, Wien 2006
28 Zenger, E., Gewalt als Preis der Wahrheit? Alttestamentliche Beobachtungen zur sogenannten Mosaischen Unterscheidung, in: Schweitzer, F. (Hg.), Religion, Politik und Gewalt. Kongressband des XII. Europäischen Kongresses für Theologie 18.-22. September 2005 in Berlin (Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 29) Gütersloh 2006, 35-57, hier: 37-39
29 Vgl. nur Ausschnitthaft die Fälle von sexualisierter Gewalt (Gen 37), der machtasymmetrischen Gewalt (1 Kön 21), militärischer Auseinandersetzungen (Gen 14) uvm.
30 Vgl. Zenger, E., Der Mosaische Monotheismus im Spannungsfeld von Gewalttätigkeit und Gewaltverzicht. Eine Replik auf J. Assmann, in: Walter, P. (Hg.), Das Gewaltpotential des Monotheismus und der dreieine Gott, QD 216, Freiburg 2005, 39-73
31 Vgl. Walter, P., Das Gewaltpotential des Monotheismus und der dreieine Gott, a.a.O.
32 Metz, J. B., Compassion, a.a.O., 11
33 So zuletzt während des Arbeitsforums für Religionspädagogik in Donauwörth vom 25.-27. März 2015. Es handelt sich bei dieser Fachtagung um eine Veranstaltung der Konferenz der Leiter der Schulabteilungen in den deutschen Diözesen gemeinsam mit Vertreterinnen, dem Deutschen Katecheten Verein und Vertreter der Religionspädagogik an den theologischen Hochschulen in Kooperation mit der Pädagogischen Stiftung Cassianeum.
34 Metz, J. B., Glaube in Geschichte und Gesellschaft. Studien zu einer praktischen Fundamentaltheologie, Mainz 51992, 50
35 Beck, U. / Beck-Gernsheim, E., Individualisierung in modernen Gesellschaften – Perspektiven und Kontroversen einer subjektorientierten Soziologie, in: dies. (Hg.), Riskante Freiheiten, Frankfurt am Main 1994, 10-39; 14 f.; vgl. auch Keupp, H., Riskante Chancen. Das Subjekt zwischen Psychokultur und Selbstorganisation. Sozialpsychologische Studien, Heidelberg 1988; Berger, P. L. / Berger, B. / Kellner, H., Das Unbehagen an der Modernität, Frankfurt / New York 1987
36 Luckmann, T., Die unsichtbare Religion, Frankfurt am Main 1991 (amerik. Ausgabe 1967)
37 Vgl. Dubach, A., Was glauben die Schweizerinnen und Schweizer, in: Christliches Zeugnis heute 2(1992)4-7; 4 ff.
38 Peukert, H., Praxis universaler Solidarität, in: Schillebeecks, E. (Hg.), Mystik und Politik, FS J.B. Metz, Mainz 1988, 172-185; 176
39 Honneth, A., Pluralisierung und Anerkennung. Zum Selbstmißverständnis postmoderner Sozialtheorien, in: Merkur 45(1991)624-629; 625
40 Ebd., 624 f.
41 vgl. Metz, J. B., Wohin ist Gott, wohin denn der Mensch? In: Kaufmann, F. X. / Metz, J. B., Zukunftsfähigkeit. Suchbewegungen im Christentum, Freiburg im Breisgau 1987, 124-147; 131 f.
42 Marquard, O., Hegel und das Sollen, in: Philosophisches Jahrbuch 72(1964)118
43 Vgl. Benjamin, W., Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze. Mit einem Nachwort von Herbert Marcuse, Frankfurt am Main 1965
44 Marcuse, H., Triebstruktur und Gesellschaft, Frankfurt am Main 1968, 24 f.
45 Marcuse, H., Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, Darmstadt / Neuwied 181982, 117 f.
46 Adorno, Th. W., Negative Dialektik, a.a.O., 63
47 Ders., Thesen über Tradition, in: Ohne Leitbild – parva aesthetica, Frankfurt 1967, 34 f.
48 Vgl. Lang, A., Art. Loci theologici, in: Höfer, J. / Rahner, K., (Hrsg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1986, 1110-1111
49 Vgl. Klinger, E., Ekklesiologie der Neuzeit. Grundlegung bei Melchior Cano und Entwicklung bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Freiburg 1978
50 Vgl. Marx, K., Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in: MEW 1, Berlin 1975, 378-391; 378
51 Peters, T. R., Mehr als das Ganze, a.a.O., 26
52 Ders. (Hg.), Theologisch-politische Protokolle, München / Mainz 1981, 9
53 Suess, P., Junger Wein in alte Schläuche. Zum Theologietransfer aus und nach Lateinamerika, in: Schillebeeckx, E., Mystik und Politik. Theologie im Ringen um Geschichte und Gesellschaft. Johann Baptist Metz zu Ehren, Mainz 1988, 44-56; 45 f.
54 Vgl. Ebertz, M. N., Aufbruch in der Kirche. Anstöße für ein zukunftsfähiges Christentum, Freiburg 2003, 79-119
55 Vgl. Ebertz, M. N., Wider den Wohn-Territorialismus, in: Lebendige Seelsorge 55(2004)52-55
56 Notwendig wäre dann wohl auch Vorschläge zu reflektieren, die zwar ähnlich ansetzen aber durchaus unterschiedliche theologische Grundlagen beanspruchen wie auch sehr verschiedene Perspektiven entwickeln. Um nur zwei sehr unterschiedliche Überlegungen anzudeuten vgl. Tebartz-van Elst, F.-P., Gemeinde in mobiler Gesellschaft, Würzburg 2001; Bucher, R., Jenseits der Idylle. Wie weiter mit den Gemeinden?, in: ders., (Hg.), Die Provokation der Krise, Würzburg 2004, 106-130
57 Vgl. Mette, N., Vom pfarrlichen Territorialprinzip zur Option für ortsbezogene Gemeinden, in: Pastoraltheologische Informationen 26(2006)8-21
58 Fuchs, O., Theologischer Kommentar zum Dekret über den Dienst und das Leben der Presbyter Presbyterorum ordinis, in: Hünermann, P. / Hilberath, B. J. (Hg.), Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil Bd. 4, Freiburg 2005, 561-567; 564 f.
59 Vgl. Ebertz, N. M., Kirche im Gegenwind. Zum Umbruch der religiösen Landschaft, 141 ff.
60 Ebd., 141
61 Vgl. Gabriel, K. / Geller, H., Ausblick: Entwicklungstrends in Kirchengemeinden, in: Geller, H. u.a., Ökumene und Gemeinde. Untersuchungen zum Alltag in Kirchengemeinden, Poladen 2002, 361-389
62 Gramsci, A., Gefängnishefte Bd. 7, hg. v. W. F. Haug, Hamburg 1992, 1500
63 Adorno weist darauf in den Minima Moralia in der fünften Reflexion hin: „Für den Intellektuellen ist unverbrüchliche Einsamkeit die einzige Gestalt, in der er Solidarität etwa noch zu bewähren vermag. Alles mitmachen, alle Menschlichkeit von Umgang und Teilhabe ist bloße Maske fürs stillschweigende Akzeptieren des Unmenschlichen. Einig sein soll man mit dem Leiden der Menschen: der kleinste Schritt zu ihren Freuden hin ist einer zur Verhärtung des Leidens.“ In der sechsten Reflexion allerdings hebt er hervor: „Für den, der nicht mitmacht, besteht die Gefahr, daß er sich für besser hält als die anderen und seine Kritik der Gesellschaft mißbraucht als Ideologie für sein privates Interesse. […] Der Distanzierte bleibt so verstrickt wie der Betriebsame; vor diesem hat er nichts voraus als die Einsicht in seine Verstricktheit und das Glück der winzigen Freiheit, die im Erkennen als solchem liegt. Die eigene Distanz vom Betrieb ist ein Luxus, den einzig der Betrieb abwirft.“ Adorno, T. W., Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt am Main 1985, 22 f.