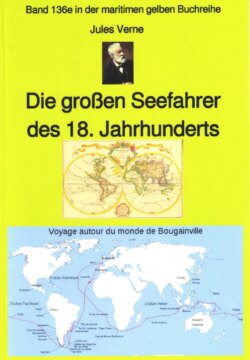Читать книгу Jules Verne: Die großen Seefahrer des 18. Jahrhunderts - Teil 1 - Jules Verne, Jules Verne - Страница 8
Die Vorläufer des Kapitän Cook
ОглавлениеDie Vorläufer des Kapitän Cook
Roggeween. – Dürftige Nachrichten über ihn. –
Unbestimmtheit seiner Entdeckungen. – Die Oster-Insel. –
Die Verderblichen Inseln. – Die Baumans-Gruppe. –
Neu-Britannien. – Ankunft in Batavia. – Byron. –
Aufenthalt in Rio de Janeiro und im Hafen Désiré. –
Eintritt in die Magellan-Straße. –
Die Falklands-Inseln und der Egmont-Hafen. – Die Fuegiens. –
Mas-a-Fuero. – Die Trostlosen Inseln. – Die Inseln der Gefahr. –
Tinian. – Rückkehr nach Europa.
Schon im Jahre 1669 hatte Pater Roggeween der holländisch-westindischen Handelsgesellschaft eine Denkschrift eingereicht, in der er die Ausrüstung dreier Schiffe befürwortete, um damit nach dem Stillen Ozean auf Entdeckung auszuziehen. Sein Plan fand zwar günstige Aufnahme, der Eintritt einer Erkaltung der Beziehungen zwischen Spanien und Holland zwang jedoch die batavische Statthalterschaft, vorläufig von einer solchen Expedition abzusehen. Noch auf dem Sterbebette nahm Roggeween seinem Sohne Jakob das Versprechen ab, den von ihm aufgestellten Plan auszuführen.
Jakob Roggeween
Mannigfache und von seinem Willen völlig unabhängige Umstände hinderten Letzteren lange Zeit an der Erfüllung seines Versprechens. Erst nachdem er wiederholt die Meere Indiens durchsegelt und eine Stelle als Rat bei dem Justizhofe von Batavia bekleidet, sehen wir Jakob Roggeween bei der holländisch-westindischen Compagnie neue Schritte tun. Wie alt er im Jahre 1721 wohl sein mochte und mit welchem Rechte er Ansprüche auf Übernahme der Oberleitung einer Entdeckungs-Expedition erhob, ist nicht bekannt geworden. Die biographischen Lexika widmen ihm meist nur wenige Zeilen, und Fleurieu, der in einem schönen und gelehrten Schriftchen die Entdeckungen des holländischen Seefahrers sicherer zu bestimmen suchen wollte, gelangte in dieser Beziehung zu keinem nennenswerten Resultat. Auch den Bericht über seine Reise hat er nicht einmal selbst abgefasst, sondern ein Deutscher, Namens Behrens. Vielleicht ist für die mancherlei dunklen Stellen, die Widersprüche und den Mangel an Genauigkeit der Erzähler mehr verantwortlich zu machen als der Seemann. Wiederholt scheint es, so wenig das doch vorauszusetzen ist, dass Roggeween von den Reisen und Entdeckungen seiner Vorgänger und Zeitgenossen kaum hinlängliche Kenntnis gehabt habe.
Am 21. August liefen unter seinem Kommando von Texel drei Schiffe aus: die „AIGLE“ mit 36 Kanonen und 111 Mann Besatzung, die „TIENHOVEN“, 28 Kanonen und 100 Mann, Kapitän Jakob Bauman, und die Galeere „DIE AFRIKANERIN“, 14 Kanonen und 60 Mann, Kapitän Heinrich Rosental. Die Fahrt über den Atlantischen Ozean bot kein besonderes Interesse. Nachdem er Rio kurz berührt, suchte Roggeween eine Insel aufzufinden, welche er Auke's Magdeland nennt, das wäre das heutige Maidenland, die Falklands-Inseln oder Malouinen, wenn darunter nicht Georgia australis zu verstehen ist. Obwohl diese Inseln damals genügend bekannt waren, drängt sich doch die Annahme auf, dass die Holländer über deren Lage nicht sicher unterrichtet waren, da sie nach Aufgabe der Untersuchung Falklands sich nach den Inseln St. Louis des Franpais wenden wollten, ohne zu wissen, dass diese zu dem nämlichen Archipel gehörten.
Übrigens gibt es wenige Länder, welche mehr Namen geführt haben als diese, wie z. B. auch den der Pepys- oder Conti-Inseln, nebst noch manchen anderen. Es wäre leicht, ein ganzes Dutzend Bezeichnungen zusammenzustellen.
Nachdem er unter der Breite der Magellan-Straße und etwa achtzig Meilen von der Küste Amerikas eine Insel von zweihundert Meilen Umfang entdeckt oder doch erblickt hatte, die er „Ost-Belgien“ taufte, drang Roggeween in die Lemaire-Straße ein, wo ihn heftige Strömungen bis 62° 30' südlicher Breite hinabführten; dann erreichte er wieder im Norden das Gestade von Chile, warf an der Insel Moha, die er unbewohnt fand, Anker und kam hierauf nach Juan Fernandez, wo er sich mit der „TIENHOVEN“, von der er seit dem 21. Dezember getrennt war, wieder vereinigte.
Die drei Schiffe verließen ihren Ankerplatz noch vor Ende März und steuerten nach Westnordwesten in der Richtung, wo sich zwischen dem 27. und 28. Grade das von Davis entdeckte Land befinden sollte. Nach mehrtägiger Kreuzfahrt kam Roggeween am 6. April 1722 in Sicht einer Insel, welche er Oster-Insel nannte.
Wir erwähnen hier nicht der übertriebenen Größenangaben, welche der holländische Seefahrer bezüglich dieses Landes macht, noch seiner Beobachtungen über Sitten und Gebräuche der Eingeborenen, da uns Gelegenheit geboten wird, das aus den weit verlässlicheren und eingehenderen Berichten Cook's und La Pérouse's besser kennen zu lernen. “Was man in diesen Berichten aber vermissen wird“, sagt Fleurieu, „ist jener Beweis gründlicher Bildung eines Roggeween'schen Sergeantmajors, der uns, nach Beschreibung des Bananenblattes, welches sechs bis acht Fuß lang und zwei bis drei breit sein soll, belehrt, dass die Stammeltern des Menschengeschlechtes nach dem Sündenfalle damit ihre Blöße bedeckt haben sollen“; und er fügt zur weiteren Erläuterung hinzu, dass „diejenigen, welche diese Behauptung aufstellen, sich darauf stützen, das genannte Blatt für das größte aller Pflanzen des Morgen- und Abendlandes halten“.
Diese Bemerkung zeugt für die hohe Vorstellung, welche Behrens sich von der Körpergröße unserer Urahnen machte.
Furchtlos kam ein Eingeborener an Bord der „AIGLE“. Er ergötzte Alle durch seinen guten Mut, seine frohe Laune und durch seine nicht misszudeutenden Freundschaftsbezeugungen.
Am folgenden Tage bemerkte Roggeween auf dem mit einer Art Bildsäulen übersäten Strande eine Menge Eingeborne, welche die Ankunft der Fremdlinge mit neugieriger Ungeduld zu erwarten schien. Da fiel, man weiß nicht wie das zuging, ein Schuss, einer der Insulaner bricht zusammen und die entsetzte Menge stäubt nach allen Richtungen auseinander. Bald kehrt sie in gedrängten Gliedern wieder. Jetzt lässt Roggeween an der Spitze von etwa 100 Mann eine allgemeine Salve auf jene abgeben, welche eine große Zahl von Opfern zu Boden streckt. Erschreckt beeilen sich die Eingeborenen, um die fürchterlichen Gäste zu besänftigen, diesen all' ihr Hab und Gut zu Füßen zu legen.
Fleurieu glaubt nicht, dass die Oster-Insel mit Davis-Land identisch sei; trotz der von ihm für diese Behauptung aufgeführten Gründe muss man, mangels durchgreifender Unterschiede seiner Beschreibung und in der Lage beider Länder, die Entdeckung Davis' und die Roggeween's schon deshalb für identisch halten, weil in jenen Meeresteilen bis auf den heutigen Tag keine weitere Insel bekannt geworden ist.
Durch einen heftigen Sturm von seinem Ankerplatze an der Ostküste der Oster-Insel vertrieben, steuerte Roggeween weiter nach Westnordwesten, durchsegelte Schouten's „Böses Meer“ und entdeckte in einer Entfernung von 100 Meilen von der Oster-Insel ein anderes Eiland, das er für Schouten's Insel der Hunde hielt und auf den ihm später verbliebenen Namen Carlshoff taufte.
Das Geschwader passierte diese Insel, ohne sie zu besuchen, und wurde während der folgenden Nacht durch Winde und Strömungen mitten in eine Gruppe niedriger Inseln verschlagen, deren Vorhandensein man nicht erwartete. Die Galeere „Die AFRIKANERIN“ stieß dabei gegen eine Klippe, und die beiden anderen Schiffe hätte beinahe derselbe Unfall ereilt. Erst nach fünftägiger Anstrengung, Unruhe und Gefahr gelang es ihnen, sich wieder herauszufinden und klares Fahrwasser zu gewinnen.
Die Bewohner jenes Archipels waren groß, ihre Haare schlicht und lang und ihr Körper mit bunten Farben bemalt. Heut' ist man ganz einig darüber, in der von Roggeween hinterlassenen Beschreibung der „Verderblichen Inseln“ den Archipel zu erkennen, den Cook später die Palliser-Inseln nannte.
Frühmorgens an dem Tage, nachdem Roggeween den Gefahren der Verderblichen Inseln entschlüpft war, entdeckte er eine Insel, der er den Namen „Aurora“ gab. Sie erhob sich kaum über die Wasserfläche, und wenn die Sonne nicht eben aufging, wäre die “TIENHOVEN“ in Gefahr gekommen, an derselben zu Grunde zu gehen.
Bei einbrechender Nacht bemerkte man noch eine Insel, die den Namen „Vesper“ erhielt und welche heute schwer zu bestimmen ist, wenn sie nicht der Palliser-Gruppe selbst angehört.
Roggeween eilte zwischen dem 15. und 16. Breitengrade mit vollen Segeln weiter nach Westen und befand sich „plötzlich“ inmitten vieler halb überfluteter Inseln.
„Bei unserer Annäherung, sagt Behrens, sahen wir eine Menge Kanus längs der Küste hingleiten und kamen zu der Überzeugung, dass das Land hier dicht bevölkert sein müsse. Bei noch geringerem Abstande erkannten wir eine Anhäufung einzelner, aber dicht bei einander gelegener Eilande; endlich gelangten wir unbemerkt so zwischen dieselben, dass wir für einen Aus- oder Rückweg besorgt wurden, und der Admiral einen Steuermann nach dem Top des Mastes beorderte, um sich über den einzuschlagenden Kurs zu unterrichten. Unsere Rettung verdankten wir damals nur der eben herrschenden Windstille; die geringste Luftbewegung hätte unsere Schiffe auf die Riffe treiben müssen, ohne dass eine Hilfe möglich gewesen wäre. Zum Glück kamen wir ohne Unfall heraus. Diese Inseln, sechs an der Zahl, bieten einen lachenden Anblick und mögen zusammen eine Ausdehnung von dreißig Meilen haben. Sie liegen fünfundzwanzig Meilen westlich von den Verderblichen Inseln. Wir gaben ihnen den Namen ‚das Labyrinth‘, weil es vieler Umwege bedurfte, um aus denselben herauszukommen.“
Mehrere Schriftsteller erklären diese Gruppe für übereinstimmend mit Byron's Prince de Galles-Inseln. Fleurieu teilte diese Ansicht nicht. Dumont d'Arville glaubt, es handle sich hier um die schon von Schouten und Lemaire gesehene Vliegen-Gruppe.
Nach dreitägiger Fahrt gen Westen erblickten die Holländer eine Insel von schönem Aussehen. Kokos und andere Palmen neben üppigem Grün bezeugten ihre Fruchtbarkeit. Da man in der Nähe des Ufers keinen Ankergrund fand, musste man sich begnügen, dieselbe nur durch wohlbewaffnete Abteilungen untersuchen zu lassen.
Noch einmal vergossen die Holländer das Blut einer keineswegs feindselig auftretenden Bevölkerung, die sie am Ufer erwartete und nur den einen Fehler beging, in zu großer Anzahl herzu gelaufen zu sein. Nach einer solchen, eher von Barbaren als von zivilisierten Menschen zu erwartenden Handlungsweise versuchte man die Eingeborenen durch Geschenke an deren Häuptlinge und ziemlich trügerische Freundschaftszeichen zwar wieder anzulocken, aber diese legten darauf offenbar keinen Wert. Als die Matrosen dagegen weiter ins Innere vordrangen, fielen sie mit einem Hagel von Steinen über dieselben her. Obgleich das Gewehrfeuer der Letzteren viele derselben zu Boden streckte, widerstanden sie den Fremdlingen doch mit Tapferkeit und zwangen diese, sich unter Mitnahme ihrer Verwundeten und Toten bald wieder einzuschiffen.
Natürlich schrien die Holländer nun über Verrat und wussten kaum, mit welchen Schmähungen sie die Hinterlist ihrer Gegner brandmarken sollten. Wer tat aber zuerst Unrecht? Wer war der angreifende Teil? Selbst zugegeben, dass einige Diebstähle vorgekommen wären, was ja wohl möglich ist, musste man den Fehler einiger Individuen, welche von der Heiligkeit des Eigentumsrechtes gewiss keine rechte Vorstellung hatten, in so strenger Weise und an einer ganzen Bevölkerung bestrafen? Trotz der hier erlittenen Verluste gaben die Holländer dem Lande, eingedenk der Erfrischungen, die sie ebenda gefunden, den Namen „Rekreations-Insel“. Roggeween verlegte sie unter den 16. Breitengrad; ihre geographische Länge ist aber so mangelhaft bezeichnet, dass die Wiedererkennung noch nicht gelang.
Sollte Roggeween nun weiter im Westen die Insel Espiritu Santo de Quiros aufsuchen? Oder sollte er nach Norden segeln, um mit Hilfe des eben günstig wehenden Monsuns Ostindien zu erreichen? Der Kriegsrat, dem er hierüber die Entscheidung überließ, entschloss sich für das letztere.
Am dritten Reisetage wurden gleichzeitig drei Inseln entdeckt, welche den Namen Baumann's, des Kapitäns der „TIENHOVEN“, erhielten, weil dieser sie zuerst gesehen hatte. Die Insulaner ruderten zwischen den Schiffen umher, um Tauschhandel zu treiben, während den Strand eine große Menge mit Bogen und Lanzen bewaffneter Eingeborener bedeckte. Sie waren von weißer Hautfarbe und unterschieden sich von Europäern höchstens dadurch, dass sie von der Sonne etwas intensiver gebräunt erschienen. Ihr Körper war auch durch keine Malereien entstellt. Ein Stück kunstreich gewebter und mit Fransen besetzter Stoff verhüllte sie von der Hüfte bis zu den Fersen. Auf dem Kopfe trugen sie einen Hut von gleichem Material und um den Hals eine Art von Kränzen von wohlriechenden Blumen.
„Ich muss gestehen“, sagt Behrens, „dass das die gesittetste und rechtschaffenste Völkerschaft war, die wir auf den Inseln der Südsee kennen lernten; erfreut über unsere Ankunft, empfingen sie uns mit göttlichen Ehren, und als wir Anstalt trafen, wieder abzureisen, zeigten sie ihr lebhaftes Bedauern auf jede mögliche Weise.“ Aller Wahrscheinlichkeit nach ist hier die Rede von den Bewohnern der Schiffer-Inseln.
Nachdem es einige Inseln angelaufen, die Roggeween für die schon von Schouten und Lemaire besuchten Kokos- und Verräter-Inseln ansah, während Fleurieu gerade diese als eine neue holländische Entdeckung betrachtet und sie Roggeween-Archipel benennt, nachdem es ferner die Inseln Tienhoven und Gröningen, welche Pingré für Santa-Cruz de Mendana hält, zu Gesicht bekommen, erreichte das Geschwader endlich die Küsten von Neu-Irland, wo es sich durch wiederholte Blutbäder bemerklich machte. Von da ging es nach Neu-Guinea ab und warf zuletzt – nach dem Passieren der Molukken – vor Batavia Anker.
Hier nahmen die eigenen Landsleute – weniger menschlich gesinnt als irgend eine wilde Völkerschaft, die Roggeween je besucht hatte – die beiden noch übrigen Schiffe – „DIE AFRIKANERIN“ war in Folge des bei den Verderblichen Inseln erlittenen Stoßes zu Grunde gegangen – in Beschlag, Matrosen und Offiziere ohne Ansehen des Ranges gefangen und schickten sie zur Aburteilung nach Europa. Ihr unverzeihliches Verbrechen bestand nämlich darin, dass sie den Fuß auf ein Gebiet gesetzt hatten, welches der holländisch-ostindischen Handelsgesellschaft gehörte, während sie unter der Oberhoheit der westindischen Gesellschaft standen! Daraus entspann sich ein Prozess, durch dessen Endurteil der ostindischen Kompagnie auferlegt wurde, alles Beschlagnahmte herauszugeben und sehr beträchtlichen Schadenersatz zu leisten.
Von der Zeit seiner Rückkehr nach Texel, am 11. Juli 1723, verlieren wir Roggeween völlig aus den Augen und besitzen von den letzten Jahren seines Lebens keinerlei Kenntnis. Immerhin gebührt Fleurieu der wärmste Dank für seine Bemühung, die chaotischen Nachrichten dieser langen Seefahrt, welche in weiteren Kreisen bekannt zu werden verdiente, nach Möglichkeit entwirrt zu haben. –
* * *
John Byron – 1723 – 1786
Am 17. Juni 1764 erhielt Commodore Byron eine vom Lord der Admiralität unterzeichnete Ordre zugestellt, deren Eingang also lautete:
„Da nichts im Stande ist, den Ruhm dieser Nation als Seemacht, den Glanz der Krone Großbritanniens und die Ausbreitung ihres Handels- und Schiffsverkehres mehr zu befördern, als Entdeckungen in bisher unbekannten Gegenden zu machen, und da man Grund hat zu glauben, dass sich im Atlantischen Ozean zwischen dem Cap der Guten Hoffnung und der Magellan-Straße noch weitere, den europäischen Mächten bisher unbekannt gebliebene Länder oder beträchtliche Inseln vorfinden dürften, welche ebenso in einer für die Schifffahrt bequemen Breite liegen, wie sie durch ihr Klima die Erzeugung handelswichtiger Rohprodukte begünstigen müssten; endlich da die unter dem Namen Pepys- oder Falklands-Inseln bekannten Territorien Sr. Majestät, welche ebenfalls unter der bezeichneten Breite liegen, noch nicht so eingehend erforscht sind, um eine genaue Vorstellung von ihren Küsten und Bodenerzeugnissen zu gestatten, obwohl sie von englischen Seefahrern entdeckt und besucht wurden – hat Se. Majestät in Erwägung dieser Umstände und unter Berücksichtigung, dass keine Konjunktur einem derartigen Unternehmen günstiger sein kann als der tiefe Friede, dessen sich alle seine Reiche eben erfreuen, geruht, dasselbe jetzt zur Ausführung zu bringen ...“
Wer war aber der erprobte Seemann, auf den sich die Wahl der englischen Regierung lenkte? Das war der am 8. November 1723 geborene Kommodore Byron. Seit seiner Kindheit hatte er die lebhafteste Neigung zur Seemannslaufbahn zu erkennen gegeben und sich mit siebzehn Jahren auf dem Geschwader des Admiral Anson mit eingeschifft, das damals, wie wir wissen, mit dem Auftrag der Zerstörung der spanischen Niederlassungen an der Küste des Pazifischen Ozeans ausgeschickt wurde.
Wir haben im vorhergehenden Kapitel die zahlreichen Unfälle dieser Expedition und die unerwartete Glückswendung während des letzten Teiles derselben geschildert.
Das Schiff, auf welchem sich Byron damals befand, der „WAGER“, litt beim Eingange zur Magellan-Straße Schiffbruch, und die von den Spaniern gefangen genommene Mannschaft desselben wurde nach Chiloë (das Südende von Chile) abgeführt. Nach einer Gefangenschaft von nicht weniger als drei Jahren gelang es Byron zu entkommen und auf ein Schiff aus St. Malo zu gelangen, das ihn nach Europa zurückbeförderte. Er trat hier sofort wieder in Dienst, zeichnete sich bei mehreren Treffen im Kriege gegen Frankreich aus, und unzweifelhaft war es die Erinnerung an seine so unglücklich unterbrochene erste Reise um die Erde, welche ihm die Aufmerksamkeit der Admiralität zuwandte.
Die ihm anzuvertrauenden Fahrzeuge erhielten die sorgsamste Ausrüstung. Die „DAUPHIN“ war ein Kriegsschiff 6. Ranges, mit 24 Kanonen, 150 Matrosen, 3 Lieutenants und 37 Unteroffizieren. Die „TAMAR“ war eine Yacht mit 16 Kanonen, auf der sich unter dem Kommando des Kapitäns Muat 99 Matrosen, 3 Lieutenants und 27 Unteroffiziere einschifften.
Der Anfang gestaltete sich nicht glücklich. Am 21. Juni verließ die Expedition die Londoner Werft; beim Hinabsegeln auf der Themse stieß die „DAUPHIN“ aber auf Grund und musste in Plymout einlaufen, um daselbst gekielholt zu werden.
Am 3. Juli ward hierauf der Anker wiederum gelichtet, und zehn Tage später lief Byron Funchal auf Madeira an, um noch einigen Proviant einzunehmen. Ebenso sah er sich genötigt, an den Inseln des Grünen Vorgebirges beizulegen, um Wasser zu fassen, da das mitgenommene sehr schnell verdorben war.
Bis zum Cap Frio hemmte nichts die Fahrt der beiden Schiffe. Nur machte Byron die später wiederholt bestätigte Beobachtung, dass der Kupferbeschlag seiner Schiffe die Fische zu vertreiben schien, die er in diesen Meeresteilen sonst in Überfluss hätte antreffen müssen. Drückende Hitze und unaufhörliche Regengüsse hatten einen großen Teil der Besatzungen aufs Lager geworfen, und das Verlangen nach einem Hafen und nach frischen Nahrungsmitteln trat sehr fühlbar zu Tage.
Beides sollte Rio de Janeiro bieten, wo man am 12. Dezember eintraf. Byron erhielt hier eine dringende Einladung seitens des Vizekönigs und schildert seine erste Zusammenkunft mit diesem folgendermaßen:
„Als ich meinen Besuch abstattete, wurde ich mit größter Feierlichkeit empfangen; gegen sechzig Offiziere hatten allein vor dem Palaste Aufstellung genommen. Die Leibgarde stand unter Waffen. Das waren sehr schöne Leute von straffer Haltung. Seine Exzellenz empfing mich, umgeben von allen hohen Würdenträgern, schon an der Treppe, wobei ich von einem benachbarten Fort mit fünfzehn Kanonenschüssen begrüßt wurde. Wir betraten sodann den Audienzsaal, von wo ich mich nach einer viertelstündigen Unterhaltung wieder empfahl und mit dem nämlichen Zeremoniell zurückbegleitet wurde ...“ Wir werden bald Gelegenheit haben, den Unterschied bezüglich des Empfanges hervorzuheben, den Cook nur wenige Jahre nach Byron erfahren sollte.
Der Kommodore erhielt ohne Mühe die Erlaubnis, seine Kranken ans Land zu bringen, und man gewährte ihm jede Erleichterung bei der Anschaffung von Nahrungs- und Stärkungsmitteln. Er hatte sich überhaupt über nichts zu beklagen als über die wiederholten Versuche der Portugiesen, seine Matrosen zur Desertion zu verleiten. Die in Rio herrschende unerträgliche Hitze verkürzte die Dauer des Aufenthaltes Am 16. Oktober wurden die Anker gelichtet, die Schiffe mussten am Eingang der Bay aber noch vier oder fünf Tage lang still halten, bevor ein Landwind es ihnen ermöglichte, die hohe See zu gewinnen.
Bis jetzt war die eigentliche Bestimmung des kleinen Geschwaders geheim gehalten worden. Nun berief Byron aber den Kommandanten der „TAMAR“ zu sich an Bord und las in – Gegenwart der versammelten Matrosen – seine Instruktionen vor, welche ihm vorschrieben, nicht wie man bisher allgemein angenommen, nach Ostindien zu segeln, sondern im südlichen Ozean zu kreuzen und daselbst auf Entdeckungen auszugehen, welche für England von hohem Werte sein könnten. Mit Rücksicht hierauf bewilligten die Lords der Admiralität den Mannschaften doppelten Sold, ohne von der Aussicht auf Avancement und besondere Gratifikationen zu sprechen, wenn man mit ihnen zufrieden sei. Von dieser kurzen Ansprache gefiel den Matrosen vorzüglich der zweite Teil, den sie mit freudigem Hurra begrüßten.
Bis zum 29. Oktober steuerte man ohne Unfall nach Süden zu. Da stellten sich häufige Schlossenwetter und heftige Windstöße ein, die zu einem wahren Sturme ausarteten und den Kommodore veranlassten, vier Geschütze über Bord zu werfen, um nicht im vollen Segeln zu kentern. Am nächsten Tage gestaltete sich die Witterung etwas erträglicher, es herrschte aber eine Kälte wie zu jener Jahreszeit in England, obwohl der November hier dem Mai der nördlichen Halbkugel entspricht. Da der steife Wind die Schiffe immer nach Osten hin ablenkte, fing Byron an zu fürchten, dass es sehr schwer halten würde, längs der Küste Patagoniens hinab zu segeln.
Am 12. Dezember erscholl da plötzlich, ohne dass auf den Karten eine Küste verzeichnet stand, der Ruf: „Land! Land nach vorn!“ Dicke Wolken verdunkelten eben den ganzen Horizont, und der Donner folgte den Blitzen fast ohne Unterbrechung.
„Ich glaubte zu bemerken“, schreibt Byron, „dass das Land, was uns auf den ersten Anblick als eine Insel erschien, nur zwei große schroffe Berge zeigte; beim Auslugen auf der Windseite schien es mir dagegen, als ob das jene Bergspitzen verbindende Land sich weit nach Südosten hin erstreckte; wir steuerten in Folge dessen Südwest. Ich ließ einige Offiziere auf die Masten steigen, um sich von der Richtigkeit dieser Wahrnehmung zu überzeugen; alle versicherten, eine große Strecke Land zu sehen ... Wir liefen von nun ab nach Ostsüdost. Das Land bot scheinbar immer denselben Anblick. Die Berge erschienen bläulich, wie das bei trübem und regnerischem Wetter immer der Fall ist, wenn man sie aus geringerer Entfernung beobachtet. ... Bald darauf glaubten einige, das Meer sich an einem sandigen Ufer brechen zu hören und zu sehen; nachdem wir aber noch ungefähr eine Stunde mit möglichster Vorsicht dahin gesegelt waren, verschwand plötzlich alles, was wir für ein Land gehalten hatten, vor unseren Augen, und wir überzeugten uns, dass es nur ein Dunstgebilde gewesen sei ... Ich bin siebenundzwanzig Jahre hindurch“, fährt Byron fort, „fast unausgesetzt auf dem Meere gewesen, aber ich hatte keine Ahnung von der Möglichkeit einer so vollkommenen Gesichtstäuschung. ... Es unterliegt keinem Zweifel, dass, wenn die Witterung sich nicht so schnell geklärt hätte, um die Erscheinung vor unseren erstaunten Blicken zerfließen zu lassen, jeder Mann an Bord einen Eid darauf abgelegt hätte, an dieser Stelle Land gesehen zu haben. Wir befanden uns zur der Zeit übrigens unter 43° 46' südl. Breite und 60° 5' östl. Länge.“
Am folgenden Tage erhob sich wieder, von dem Geschrei Tausender fliehender Vögel angekündigt, ein ganz entsetzlicher Wind, der nicht länger als zwanzig Minuten anhielt. Er reichte aber hin, das Schiff auf die Seite zu legen, bevor man die Taue der großen Halsen kappen konnte, welche dabei in Stücke gingen. Gleichzeitig schlug die Schote des Großsegels den ersten Lieutenant zu Boden, der besinnungslos weit wegrollte, und der nicht genügend gehaltene Fockmast brach entzwei.
Die folgenden Tage waren nicht viel günstiger. Außerdem erlitt das Fahrzeug in Folge seines geringen Tiefgangs eine bedeutende Abweichung, sobald der Wind etwas frischer wehte.
Nach ziemlich stürmischer Reise erreichte Byron am 24. November – mit welcher Befriedigung wird man leicht begreifen – die Pinguin-Inseln und den Hafen Désiré. Leider sollten die Annehmlichkeiten dieser Station die Ungeduld, mit der die Mannschaft sie herbeigesehnt hatte, keineswegs rechtfertigen.
Als sie das Land betraten, fanden die englischen Seeleute auf dem Wege nach dem Innern nur eine wüste Gegend mit sandigen und völlig baumlosen Hügeln.
Von Jagdwild gewahrte man einige Guanakos, aber in zu weiter Entfernung, um auf dieselben schießen zu können. Dagegen gelang es ohne besondere Mühe, einige Exemplare großer Hasen einzufangen. Die Jagd auf Seekälber und Wasservögel endlich lieferte einen so reichen Ertrag, dass man damit hätte „eine ganze Flotte traktieren“ können.
Der schlecht in Stand gehaltene und wenig geschützte Hafen Désiré hatte auch den großen Fehler, dass man hier nur sogenanntes Brackwasser (eine Mischung aus Süß- und Salzwasser) vorfand. Von Einwohnern bemerkte man keine Spur. Ein längerer Aufenthalt schien nicht nur unnütz, sondern auch gefährlich. Byron ging also schon am 25. zur Aufsuchung der Pepysinsel ab.
Über die geographische Lage der letzteren herrschte noch ziemliche Ungewissheit. Halley verlegte sie 80 Grade östlich vom Festlande. Cowley, der Einzige, der sie selbst gesehen zu haben versichert, behauptet, sie liege unter 47° südlicher Breite, gibt aber deren geographische Länge nicht an. Hier war also ein interessantes Rätsel zu lösen.
Nachdem Byron im Norden, Süden und Osten umhergekreuzt, kam er zu der Überzeugung, dass jene gar nicht existiere, und steuerte nun nach den Sebaldinen, um sobald als möglich einen Hafen anzutreffen, in dem er Holz und Wasser, dessen er dringend bedurfte, finden könnte. Unterwegs überfiel ihn ein Sturm mit so gewaltigem Wogengange, dass sich Byron eines gleichen nicht entsinnen konnte, selbst nicht von seiner Umsegelung des Cap Horn mit Admiral Anson her. Als die Luft sich beruhigt, befand er sich in Sicht des Caps der Jungfrauen am nördlichen Eingang der Magellan-Straße. Sobald das Schiff sich der Küste hinlänglich genähert hatte, erkannten die Matrosen am Strande eine Gruppe Berittener, welche eine weiße Fahne schwenkten und durch Zeichen zu verstehen gaben, dass jene ans Land kommen sollten. Neugierig, diese Patagonier, welche von früheren Reisenden so abweichend beschrieben waren, näher zu betrachten, ging Byron mit einer starken Abteilung wohlbewaffneter Soldaten ans Ufer.
Hier fand er gegen fünfhundert Männer, fast alle zu Pferde, von riesigem Wuchse, aber wahrhafte Ungeheuer in Menschengestalt. Ihr Körper war ganz abscheulich bemalt, das Gesicht durch Linien in verschiedenen Farben gestreift, und die Augen von blauen, schwarzen und roten Ringen umgeben, so dass es aussah, als trügen sie gewaltige Brillen. Fast Alle gingen nackt, bis auf ein über die Schultern geworfenes, mit der Haarseite nach außen getragenes Fell, wozu Einige noch Halbstiefeln trugen. Wahrlich, ein sehr primitives und billiges Kostüm!
In der Gesellschaft dieser Leute schwärmte eine Menge Hunde umher und, scheinbar recht hässliche, aber doch sehr flüchtige Pferde. Die Frauen ritten übrigens so wie die Männer ohne Steigbügel und galoppierten pfeilschnell am Meeresstrande hin, obgleich dieser mit großen, sehr schlüpfrigen Steinen bedeckt war.
Das Zusammentreffen verlief ganz friedlich. Byron beschenkte das Riesengeschlecht mit einer Menge Kleinigkeiten, Bändern, Glaswaren und Tabak.
Sobald er die „DAUPHIN“ wieder betreten, lief Byron mit der Flut in die Magellan-Straße ein, nicht in der Absicht diese zu durchsegeln, sondern nur um einen sicheren und bequemen Hafen aufzusuchen, wo er Holz und Wasser finden könnte, bevor er nach den Falklands-Inseln steuerte. Nachdem er die zweite enge Wasserstraße passiert, bekam Byron die Inseln St. Elisabet, St. Bartelemy, St. Georges und die Sandy-Spitze in Sicht.
Neben der letzteren breitete sich ein herrliches Stück Erde aus, mit vielen Bächen, Gehölzen und blumenübersäten Wiesen, die einen köstlichen Wohlgeruch ausströmten. Hunderte von Vögeln, deren eine Art wegen ihres mit leuchtenden Farben geschmückten Gefieders den Namen „Maler-Gänse“ erhielt, belebten die Landschaft. Nirgends fand sich aber eine Stelle, wo ein Boot gefahrlos hätte landen können. Überall war nur seichtes Wasser mit schäumender Brandung. Fische, darunter vorzüglich ausgezeichnete Seebarben, Gänse, Becassinen und andere schmackhafte Vögel wurden von der Mannschaft dagegen in großer Menge gefangen oder erlegt.
Byron sah sich also gezwungen, bis nach Port Famine vorzudringen, wo er am 27. Dezember anlangte.
„Hier lagen wir§, sagt er, „geschützt gegen alle Winde, mit Ausnahme des nur selten wehenden Südost, doch selbst, wenn ein Schiff durch diesen nach dem Grunde der Bay an das Land getrieben würde, dürfte es bei dem klaren, weichen Meeresboden kaum viel Schaden leiden. Längs der Küste treibt übrigens stets so viel Holz hin, dass man tausend Schiffe damit versorgen könnte und wir der Mühe überhoben blieben, unseren Bedarf in den Wäldern zu fällen.“
Im Grunde der Bay mündet ein Fluss mit sehr gutem Wasser, die „Sedger“. Seine Ufer sind mit großen, prächtigen Bäumen besetzt, welche sich zu Schiffsmasten vorzüglich eignen würden. Auf den Zweigen wiegten sich unzählige Papageien und andere Vögel mit glänzendem Gefieder. Während Byron's Aufenthalt in Port Famine herrschte stets Überfluss an allem. Am 5. Januar, als sich die Besatzung vollkommen erholt und man die Schiffe mit allem Notwendigen reichlich versehen hatte, segelte der Kommodore zur Aufsuchung der Falklands-Inseln wieder ab. Sieben Tage darauf entdeckte er ein Land, in dem er die Insel Sebald de Wret's zu erkennen glaubte; bei weiterer Annäherung dagegen überzeugte er sich, dass das, was er für drei Inseln gehalten hatte, nur eine einzige mit weiter Verlängerung nach Süden bildete. Er zweifelte nun nicht länger daran, hier den, auf den damaligen Karten als New-Island bezeichneten, unter 51° südlicher Breite und 63° 32' westlicher Länge gelegenen Archipel vor sich zu haben.
Zunächst hielt sich Byron auf offener See, um nicht von der Strömung nach einer unbekannten Küste geführt zu werden. Nach dieser summarischen Besichtigung wurde ein Boot abgeschickt, das so nahe als möglich längs des Landes hinsegeln sollte, um einen sicheren und bequemen Hafen zu suchen, den dasselbe auch bald auffand. Er erhielt, zu Ehren des damaligen ersten Lords der Admiralität, den Namen Port Egmont.
„Ich glaube kaum“, sagt Byron, dass man einen schöneren Hafen finden kann; der Ankergrund ist daselbst vorzüglich, Trinkwasser leicht zu beschaffen, und alle Schiffe ganz Englands könnten hier vor allen Winden sicher liegen. Gänse, Enten und anderes Geflügel gab es in so großer Menge, dass die Matrosen dieser Speisen ganz überdrüssig wurden. Leider herrschte nur etwas Mangel an Holz, bis auf einige Stämme, welche am Strande hinschwammen und wahrscheinlich durch die Magellan-Straße hierher gelangt waren.“
Wilde Orseille und Sellerie, diese wirksamsten Antiskorbutica, wuchsen hier allerorten. Seewölfe und Seelöwen, ebenso wie Pinguine traf man in so großer Menge an, dass man keinen Schritt am Strande tun konnte, ohne jene in zahlreichen Herden entfliehen zu sehen. Andere, bis auf die Größe und den Schweif Füchsen ähnliche, sonst aber unseren Wölfen gleichende Tiere griffen wiederholt die Matrosen an, welche jene nur mit Mühe abzuwehren vermochten. Es wäre schwer zu sagen, wie jene in diese vom Festlande wenigstens hundert Meilen entfernte Gegend gekommen sind, noch wo sie hier Zuflucht finden, denn an Pflanzen erzeugen diese Inseln nur Binsen und Schwertlilien, doch keinen einzigen Baum.
Der Bericht über diesen Teil der Reise Byron's bildet in Didot's Biographie nur ein Gewebe unlösbarer Irrtümer. „Die Flottille“, sagt Alfred de Lacaze, drang am 17. Februar in die Magellan-Straße ein, sah sich aber gezwungen, nahe bei Port Famine in einer Bucht vor Anker zu gehen, welche den Namen Port Egmont erhielt.“ ... Wahrlich eine merkwürdige Entstellung der Tatsachen, welche den Leichtsinn beweist, mit dem einzelne Teile dieser umfassenden Sammlung bearbeitet sind.
Byron nahm im Namen des Königs von England von Port Egmont und den benachbarten Inseln, dem Falklands-Archipel, feierlich Besitz. Coley hatte dieselben Pepys-Inseln benannt; der erste, der jene entdeckte, dürfte wohl der Kapitän Davis im Jahre 1592 gewesen sein. Zwei Jahre später sah Sir Richard Hawkins ein Land, welches man für identisch mit jenem hält, und dem er zu Ehren seiner Souveränin, der Königin Elisabet den Namen Virginien gab. Endlich besuchten den Archipel ja auch Fahrzeuge aus St. Malo, zweifelsohne für Frezier die Ursache, die Inseln als „Malouinen“ zu bezeichnen.
Nachdem er eine Anzahl Felsenberge, Eilande und Caps getauft, verließ Byron Port Egmont am 27 Januar und segelte nach dem Hafen Désiré, den er neun Tage später erreichte. Hier fand er die „FLORIDA“, ein Transportschiff, das ihm von England Lebensmittel und den bei einer so weiten Reise allemal nötig werdenden Ersatz an Ausrüstungs-Gegenständen zuführte. Der Ankerplatz erwies sich aber zu gefährlich, und die „FLORIDA“ wie die „TAMAR“ waren in zu schlechtem Zustande, um hier eine so langwierige Arbeit, wie die Umfrachtung der Ladung, vorzunehmen. Byron beorderte auf die „FLORIDA“ also einen seiner niederen Offiziere, der mit der Magellan-Straße hinlänglich bekannt war, und ging mit den beiden Begleitschiffen nach Port Famine unter Segel.
In der Meerenge begegnete er wiederholt einem französischen Fahrzeuge, das mit ihm gleichen Kurs einzuhalten schien. Nach seiner Ankunft in England hörte er, dass jenes die von Bougainville befehligte „AIGLE“ gewesen war, der auf der patagonischen Küste für die neue französische Kolonie auf den Falklands-Inseln Holz einnahm.
Bei ihren wiederholten Landungen in der Meerenge erhielt die englische Expedition auch den Besuch mehrerer Horden von Feuerländern. „Niemals habe ich“, äußert sich Byron, „so elende Geschöpfe gesehen. Sie gingen nackt bis auf eine über die Schultern geworfene stinkende Haut von Meerwölfen, und trugen als Waffen Bogen und Pfeile, die sie mir für einige Halsperlen und andere Kleinigkeiten zum Tausch anboten.
Die über zwei Fuß langen Pfeile waren aus Schilfrohr hergestellt und an der Spitze mit einem grünlichen Steine versehen; die Bogen, deren Sehne aus zusammengedrehten Tierdärmen bestand, gegen drei Fuß lang. Einige Früchte, Muscheln und vom Sturm auf den Strand geworfene halbverfaulte Fische bildeten ihre Nahrung. Ihre gewöhnliche Speise hätte wohl kaum ein Schwein berührt; diese bestand nämlich aus einem schon ganz fauligen, die Luft entsetzlich verpestenden Stücke Walfischfleisch. Einer der Leute zerriss das Aas mit den Zähnen und verteilte es an die Übrigen, die es mit der Gier wilder Tiere verschlangen. Einige dieser elenden Wilden entschlossen sich, an Bord zu kommen. Um ihnen eine Belustigung zu bereiten, spielte einer meiner niederen Offiziere Violine und mehrere Matrosen tanzten dazu. Jene schienen von dem Anblick ganz entzückt. Ungeduldig, ihre Dankbarkeit zu beweisen, eilte einer wieder in seine Pirogge hinunter und holte von da einen kleinen Sack aus Meerwolfshaut, gefüllt mit rötlichem Fette, mit dem er das Gesicht des Violinspielers einsalbte. Er hatte nicht üble Lust, mir dieselbe Ehre zu erweisen, gegen die ich mich natürlich verwahrte; dafür bemühte sich jener desto mehr, meine Bescheidenheit zu besiegen, und ich hatte die größte Mühe, mich gegen das mir zugedachte Ehrenzeichen zu verteidigen.“
Es dürfte hier nicht unnütz erscheinen, die Ansicht Byron's, eines gründlich erfahrenen Seemannes, über die Vorteile und Nachteile der Schifffahrt durch die Magellan-Enge mitzuteilen, vorzüglich, da er mit den meisten anderen Seeleuten, welche diese Meeresteile besuchten, nicht übereinstimmt.
„Die Gefahren und Schwierigkeiten, welche wir zu überwinden hatten“, sagt er, „könnten zu dem Glauben verleiten, dass es unklug sei, den in Rede stehenden Weg einzuschlagen, und dass die von Europa nach der Südsee steuernden Schiffe besser täten, das Cap Horn zu umschiffen. Diese Anschauung teile ich, obwohl ich das Cap Horn selbst zweimal doublierte, jedoch keineswegs. Es gibt nämlich eine Zeit im Jahre, wo nicht nur ein einzelnes Schiff, sondern auch eine ganze Flotte die Meerenge binnen drei Wochen bequem passieren kann, und muss man, um die günstigste Zeit zu benützen, im Monat Dezember in dieselbe einfahren. Ein unschätzbarer Vorzug dieses Weges, der für die Seeleute schon allein entscheidend sein müsste, liegt darin, dass man längs desselben viel Sellerie, Löffelkraut, Früchte und andere antiskorbutische Pflanzen antrifft.
Die Hindernisse, welche wir zu überwältigen hatten und die uns vom 17. Februar bis zum 8. April in der Meerenge aufhielten, sind nur auf Rechnung der Äquinoktien zu setzen, einer gewöhnlich stürmischen Jahreszeit, welche unsere Geduld allerdings mehr als einmal hart auf die Probe stellte.“
Bis zum 26. April, wo er in Sicht von Mas-a-fuero, eine der Inseln der Juan Fernandez-Gruppe, kam, hatte Byron einen nordwestlichen Kurs eingehalten. Hier setzte er sofort einige Matrosen ans Land, welche, nachdem sie Holz und Wasser besorgt, wilde Ziegen jagten, deren Geschmack sie vortrefflicher fanden, als den des besten Wildes in England.
Während des Aufenthaltes an dieser Küste ereignete sich noch ein merkwürdiger Fall. Am Ufer brach sich nämlich plötzlich eine so schwere Brandung, dass die Boote den Strand unmöglich erreichen konnten. Einer der ausgeschifften Matrosen, der freilich des Schwimmens unkundig war, wollte sich trotz des Rettungsgürtels, den er um den Leib trug, nicht ins Wasser wagen, um nach der nächsten Schaluppe zu gelangen. Selbst als man drohte, ihn allein zurückzulassen, konnte er sich nicht zu dem Wagnis entschließen. Da warf ihm einer seiner Kameraden ein Seil mit laufender Schlinge so geschickt über den Körper, dass man jenen nun mit Gewalt heranziehen konnte. „Als er in das Boot gehoben wurde“, heißt es in einem Berichte Hawkeswort's, „hatte der arme Teufel so viel Wasser geschluckt, dass man ihn wohl für tot halten konnte. Er wurde nun an den Füßen aufgehängt, kam bald wieder zu sich und war am nächsten Tage frisch und wohlauf.“ Trotz dieser wahrhaft wunderbaren Kur möchten wir dieselbe den Rettungsgesellschaften doch nicht anempfehlen.
Von Mas-a-fuero aus wechselte Byron die bisher eingehaltene Richtung, um Davis-Land, die heutige Oster-Insel, aufzusuchen, welche die Geographen unter 27° 30' und etwa hundert Meilen westlich von der amerikanischen Küste verlegten. Acht Tage wurden auf die Nachsuchung verwendet.
Byron schlug nun, da er bei dieser Kreuzfahrt nichts entdecken und sie, wegen seiner Absicht den Salomons-Archipel zu besuchen, nicht länger fortsetzen konnte, einen nordwestlichen Kurs ein. Am 22. Mai trat der Skorbut auf den Schiffen auf und machte bald beunruhigende Fortschritte. Glücklicherweise entdeckte man am 7. Juni von den Top der Masten Land unter 14° 58' westlicher Länge.
Am anderen Tage lag die kleine Flottille vor zwei Inseln, welche einen recht lachenden Anblick boten. Da standen große, dichtbelaubte Bäume zwischen Sträuchern und Gebüschen, unter denen sich einige Eingeborne umhertummelten, welche eiligst nach dem Strand herabliefen und dort Feuer anzündeten.
Byron schickte sofort ein Boot ab, um einen Ankerplatz zu suchen. Dasselbe kehrte zurück, ohne bis auf eine Kabellänge vom Ufer geeigneten Grund gefunden zu haben. Mit schmerzlichem Verlangen blickten die armen Skorbut-Kranken, die sich bis an die Schanzkleidung geschleppt hatten, nach der fruchtbaren Insel, auf der die Heilmittel für ihr Leiden wucherten und die zu betreten die Natur ihnen doch verwehrte.
„Sie sahen“, so meldet der Bericht, „Kokosbäume in Menge und mit Früchten beladen, deren Milchsaft vielleicht das mächtigste Antiskorbutikum der Welt darstellt; sie nahmen mit Recht an, dass sich hier auch Bananen, Limonen und andere Tropenfrüchte finden würden, und um ihrem Missvergnügen die Krone aufzusetzen, bemerkten sie gar noch Schildkröten am Strande. Alle diese Labungsmittel aber konnten sie jetzt ebenso wenig erlangen, als wären sie durch die halbe Erde davon getrennt gewesen, nur ließ der verlockende Anblick derselben sie ihre Leiden umso schmerzlicher empfinden.“
Byron wollte die Tantalusqualen, denen seine armen Matrosen ausgesetzt waren, nicht unnötig verlängern, er ging vielmehr, nachdem er der Inselgruppe den Namen der „Inseln der Enttäuschung“ beigelegt, schon am 8. Juni wieder unter Segel. Am folgenden Tage erblickte er ein anderes langes, niedriges, mit Kokosbäumen bedecktes Land, in dessen Mitte eine Lagune mit einer kleinen Insel lag. Schon diese Erscheinung bewies den madreporischen Ursprung des Landes und kennzeichnete es als einfaches „Atoll“, das zwar noch keine Insel ist, doch eine solche werden soll. Ein zur Sondierung ausgesendetes Boot fand überall eine steile, mehr einer gekrönten Mauer ähnliche Küste.
Die Urbewohner des Landes ergingen sich inzwischen in zweifellos feindseligen Kundgebungen. Zwei derselben kletterten sogar in das Boot. Der Eine stahl einem Matrosen die Weste, der Andere griff nach der Hutspitze des Hochbootsmannes; da er aber nicht wusste, wie er den Hut erlangen sollte, zog er dessen Besitzer mit zu sich heran, so dass der Hochbootsmann Gelegenheit fand, sich gegen die Diebesgelüste des Wilden zu wehren. Zwei große, mit je dreißig Ruderern bemannte Piroggen machten Miene, die Schaluppen anzugreifen. Diese kamen ihnen indes zuvor, doch entspann sich, als sie ans Land stießen, noch ein Scharmützel, bei dem die, durch die große Übermacht bedrängten Engländer selbst von ihren Feuerwaffen Gebrauch machen mussten. Drei oder vier der Insulaner blieben auf dem Platze.
Am nächsten Tage gingen einige Matrosen und von den Skorbut-Kranken die, welche die Hängematten zu verlassen vermochten, ans Land. Erschreckt durch die am Tage vorher erhaltene Lektion, hielten sich die Eingeborenen verborgen, während die Engländer Kokosnüsse pflückten und andere antiskorbutische Pflanzen einsammelten. Diese Stärkungsmittel gewährten der erschöpften Mannschaft eine so prompte Hilfe, dass nach wenig Tagen kein einziger Kranker mehr an Bord war. Papageien, sehr schöne und äußerst zahme Tauben bildeten nebst wenig anderen Vogelarten die ganze Fauna der Insel, die den Namen „König Georg's-Land“ erhielt. Eine bald darauf entdeckte Insel taufte man „Prince de Gallas“. Alle diese Eilande gehörten zu dem Pomotu-Archipel und werden auch „die niedrigen Inseln“ genannt, ein Name, den sie mit Recht verdienen.
Am 21. zeigte sich eine neue Inselkette, mit einem Gürtel von schäumender Brandung. Byron verzichtete darauf, von derselben eingehendere Kenntnis zu nehmen, da die Landung mehr Gefahr bot, als sie Vorteil versprach. Er nannte sie „die Inseln der Gefahr“.
Sechs Tage später wurde die Herzog-Yorks-Insel entdeckt. Die Engländer fanden hier keine Bewohner, sammelten aber zweihundert Kokosnüsse, die ihnen von unschätzbarem Werte schienen. Weiterhin unter 1° 18' südlicher Breite und 173° 46' westlicher Länge erhielt eine isolierte, östlich vom Gilbert-Archipel gelegene Insel den Namen Byron's. Die Hitze wurde hier wahrhaft unausstehlich, und fast alle, von der weiten Fahrt erschöpften Matrosen, welche nur unzureichende, ungesunde Nahrung hatten und halbverdorbenes Wasser trinken mussten, erlagen bald einer leichten Dysenterie.
Am 28. Juli endlich hatte Byron die Freude, die Inseln Saypan und Tinian aufzufinden, welche zu dem Archipel der Mariannen oder Ladronen gehören, und er warf an derselben Stelle Anker, wo vor ihm Lord Anson mit der „CENTURION“ gelegen hatte.
Sofort wurden Zelte für die Skorbut-Kranken errichtet. Fast alle Matrosen waren von dieser schrecklichen Krankheit befallen und einige nahe dem Ende ihrer Kräfte. Der Befehlshaber unternahm es gleich anfangs, in die dichten, bis zum Strande herabreichenden Wälder einzudringen, um die herrlichen Gefilde aufzusuchen, von denen man im Berichte von Lord Anson's Capellan so entzückende Schilderungen liest. Wie weit entfernt aber blieben sie von der Wirklichkeit, diese enthusiastischen Beschreibungen! Nach allen Seiten erstreckten sich nur undurchdringliche Gehölze, verworrene Pflanzendickichte oder Brombeer- und andere stacheliche Sträucher, welche man nicht durchdringen konnte, ohne sich bei jedem Schritte die Kleider zu zerreißen. Gleichzeitig fielen ganze Wolken von Moskitos über die Leute her und zerstachen sie jämmerlich. Essbares Wild war selten, schwer zu erlangen, das Wasser abscheulich und die Reede endlich in dieser Jahreszeit so gefährlich, wie nur eine sein kann.
Der beabsichtigte Aufenthalt begann also unter schlechten Aussichten. Doch entdeckte man zuletzt noch Limonen, bittere Orangen, Goyaven, Kokosnüsse, Brot- und andere Früchte. Lieferten diese Bodenerzeugnisse einerseits die erwünschtesten Heilmittel für die Skorbut-Kranken, so erzeugte doch die, mit sumpfigen Ausdünstungen geschwängerte Luft so verderbliche Fieber, dass zwei Matrosen daran zu Grunde gingen. Dabei strömte ein unablässiger Regen herab und die Hitze wurde unerträglich. „Ich war auf der Küste von Guinea“, sagt Byron, „in Ostindien, auf der unter dem Äquator liegenden Insel St. Tomas, aber nirgends habe ich eine so entsetzliche Hitze angetroffen.“
Wenigstens konnte man sich hier aber leicht mit Geflügel und wilden Schweinen im durchschnittlichen Gewicht von 200 Pfund, reichlich versorgen, doch musste das Fleisch an Ort und Stelle verzehrt werden, da es schon nach einer Stunde zu faulen begann. Die Fische endlich, welche man hier an der Küste fing, waren so ungesund, dass alle, die davon, selbst nur mäßig aßen, sehr ernstlich erkrankten und wirklich in Lebensgefahr kamen.
Nach neunwöchentlichem Aufenthalte verließen die beiden Schiffe am 1. Oktober, reichlich versehen mit Stärkungs- und Nahrungsmitteln, die Reede von Tinian wieder. Byron gelangte nach der schon von Anson gesehenen Insel Anatacan und steuerte immer weiter nach Norden, um womöglich den Nordost-Monsun zu erreichen, bevor er nach den Bashers kam, einem Archipel im äußersten Norden der Philippinen. Am 22. bekam er die Insel Grafton, die nördlichste jener Gruppe in Sicht, und erreichte am 3. November die Insel Timoan, welche Dampier schon als eine Örtlichkeit bezeichnet hatte, wo man sich leicht mit allerlei Nahrungs- und Erfrischungsmitteln versorgen könne. Die der malaiischen Rasse angehörigen Einwohner aber wiesen die Äxte, Messer und eisernen Instrumente, welche man ihnen als Tauschobjekte für Geflügel anbot, mit Nichtachtung zurück. Sie wollten Rupien haben. Zuletzt begnügten sie sich indessen doch noch mit einigen Taschentüchern als Preis für ein Dutzend Stück Federvieh, eine Ziege und deren Zicklein. Zum Glück erwies sich der Fischfang sehr ergiebig, denn es war fast unmöglich, sich stets frische Nahrungsmittel zu beschaffen.
Byron ging also am 7. November wieder unter Segel, passierte Poulo-Contor in weiter Entfernung und ankerte einmal bei Poulo-Toya, wo er eine Sloop mit holländischer Flagge, aber rein malaiischer Besatzung antraf. Dann erreichte er Sumatra, hielt sich längs dessen Küste und warf am 28. November Anker vor Batavia, dem Hauptsitz der holländischen Herrschaft in Ostindien.
Auf der Reede lagen hier noch mehr als hundert große und kleine Schiffe, so sehr stand jener Zeit der Handel der Indischen Compagnie in Blüte. Die Stadt selbst erfreute sich damals des höchsten Glanzes. Ihre breiten, wohl angelegten Straßen, die sehr gut unterhaltenen und mit prächtigen Bäumen besetzten Kanäle und die gleichmäßigen Häuser verliehen ihr einen Anblick, der sehr lebhaft an die Städte der Niederlande erinnerte. Portugiesen, Chinesen, Engländer, Holländer, Perser und Malaien belebten die Promenaden und die Geschäftsgegenden der Stadt; Feste, Empfangsfeierlichkeiten und Vergnügungen jeder Art erweckten in jedem Fremden eine hohe Vorstellung von ihrem Wohlstande und erhöhten den Reiz des Aufenthaltes hierselbst. Der einzige Übelstand – für Seeleute, welche eine so lange Reise hinter sich hatten, freilich nicht der kleinste – war die Ungesundheit des Ortes, wo die Fieber nie aufhören. Da Byron diese Verhältnisse kannte, beeilte er sich, neuen Proviant zu erhalten, und lichtete schon nach zwölftägigem Aufenthalte wieder die Anker.
Trotz der Kürze dieser Rast hatte sie doch schon zu lange gewährt. Kaum waren die Fahrzeuge durch die Sunda-Straße gekommen, als ein heftiges putrides Fieber die Hälfte der Mannschaft auf das Lager warf und drei Matrosen sogar tötete.
Nach achtundvierzigtägiger Reise bekam Byron die Küste Afrikas in Sicht und ging drei Tage später in der Tafelbay vor Anker.
Die Stadt am Kap lieferte alles, was er brauchte, Lebensmittel, Wasser, Arzneien, alles wurde mit einer Eile verladen, welche sich nur durch die Sehnsucht nach der Heimkehr erklärt, und endlich richtete man nun die Schiffsschnäbel nach den Gestaden der Heimat.
Nur zwei Ereignisse unterbrachen die eintönige Fahrt über den Atlantischen Ozean.
„Auf der Höhe von St. Helena, sagt Byron, erhielt das Schiff plötzlich bei schönstem Wetter, günstigem Winde und in weiter Entfernung vom Lande einen so harten Stoß, als sei es auf eine Bank aufgefahren. Die Heftigkeit der Bewegung brachte uns alle auf die Beine und wir eilten schleunigst auf Deck. Da sahen wir das Meer sich im weiten Umkreise blutig färben, was unsere Befürchtungen bald zerstreute. Wir schlossen daraus, dass wir auf einen Wal oder ein ähnliches Seesäugetier gestoßen wären und unser Schiff wahrscheinlich ohne Beschädigung davongekommen sei, was sich auch bestätigte.“
Einige Tage später befand sich die „TAMAR“ in einem so schlechten Zustande und hatte vorzüglich am Steuerruder so schwere Havarien erlitten, dass man eine Maschinerie erfinden musste, dasselbe einstweilen zu ersetzen, und sich genötigt sah, die Antillen anzulaufen, da es gefährlich erschien, die Reise noch weiter fortzusetzen.
Am 9. Mai 1766 warf die „DAUPHIN“ bei Dunes Anker, nach einer Reise um die Erde, welche nahezu dreiundzwanzig Monate gedauert hatte.
Von allen Erdumsegelungen der Engländer war diese die glücklichste gewesen. Bis zu dieser Zeit hatte man auch noch keine solche in ausschließlich wissenschaftlichem Interesse ausgeführt. Wenn die Ergebnisse derselben nicht so reichlich ausfielen, wie man erwartet haben mochte, so ist dafür weniger der Befehlshaber, der ja hinreichende Proben seiner Befähigung ablegte, verantwortlich zu machen, als das Gremium der Lords der Admiralität, deren Instruktionen nicht bestimmt genug lauteten, und welche nicht dafür Sorge getragen hatten, wie es später üblich wurde, der Expedition Spezial-Gelehrte für die verschiedenen Fächer der Wissenschaft beizugeben.
Übrigens ließ man Byron alle Gerechtigkeit widerfahren. Man belohnte ihn mit dem Admiralstitel und übertrug ihm ein wichtiges Kommando in Ostindien. Der letzte Teil seines Lebens, das im Jahre 1786 endigte, bietet keine für unser Thema geeigneten Anhaltspunkte, wir beschäftigen uns mit demselben hier also nicht weiter.
* * *