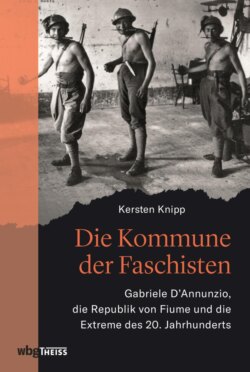Читать книгу Die Kommune der Faschisten - Kersten Knipp - Страница 13
Interpret seiner Zeit
ОглавлениеDie Musik, die lauen Nachmittage und die lauen Abende – D’Annunzio beschreibt die Szene zwei Jahre später in der Zeitung Fanfulla – fügen sich zu einem ganz eigenen Erleben zusammen, das über eher formbewussten Kunstgenuss etwa in einem Konzertsaal weit hinausgeht. In den Räumen des Musikers ist das Klavierspiel mehr als nur Musik. Es wird zu einer Art Lebensstil, fast einem Bekenntnis. Der Salon wird zum geweihten Raum, die Versammelten zu Anhängern einer neuen, musisch inspirierten Religion. Alle pflegen eine unbedingte Hingabe, sind bereit, sich auf den Schwingen der Musik in andere Sphären tragen zu lassen. Auch die Sängerin Mary Tescher gehört zu dem Kreis. Sie trägt insbesondere Schubert-Lieder vor. Und zwar, berichtet D’Annunzio weiter, „mit derart süßer Hingabe und ausgesuchter Kunst, dass Paolo Tosti gelegentlich seine Begleitung unterbrach und in einem Anfall von Begeisterung wortlos zu gestikulieren begann“. Die Melancholie der Schubert’schen Lieder, vorgetragen von der im Rhythmus sich wiegenden Sängerin, gekleidet in einen eleganten Jersey – zu was lädt das ein, wenn nicht zu unbedingter, und keineswegs nur künstlerischer Hingabe? „Wenn sie vortrug, wirkte sie wie eine große Blume.“
D’Annunzio ist von Rom verzaubert. Und umgehend beginnt er, zunächst als Journalist, über diesen Zauber zu schreiben. Die Arbeitsmöglichkeiten sind gut. Italien ist seit rund 20 Jahren geeint. Der junge Staat tut alles, die auf seinem Gebiet lebenden Menschen in Italiener zu verwandeln. Noch sind sie es nicht: Weiterhin identifizieren sie sich mit dem Dorf, der Stadt, der Region, in der sie leben. Alle weiteren Bezüge kümmern sie wenig. Um die Herzen fortan möglichst auch für die vereinte Nation schlagen zu lassen, legt der Staat ein gewaltiges Kulturprogramm auf. Universitäten werden ausgebaut oder neu gegründet, Bibliotheken erweitert oder ebenfalls ins Leben gerufen. Akademien blühen auf, zur Bewahrung und Inszenierung des kulturellen Erbes entstehen neue Museen: die Italiener sollen ihrer Geschichte ins Auge schauen, verstehen, wer sie sind und was sie eint.
Allen voran aber werden die Schulen gefördert: Im Jahr der Reichseinigung, 1861, sind über zwei Drittel der Italiener des Lesens und Schreibens unkundig. Energisch geht der Staat den Analphabetismus an. Ein neues Schulgesetz sieht einen kostenlosen, aber obligatorischen Elementarunterricht von zwei Jahren vor. Zugleich geht es darum, sie zu tatkräftigen, entschlossenen Bürgern zu erziehen. Bleibt die Bildung der Italiener allzu weit zurück, wird das Land den Anschluss an die modernen Industriestaaten im Norden nicht schaffen. Das aber setzt eine umfassende kulturelle Mobilisierung voraus. Die Italiener sollen zu aktiven, energischen und entschlossen handelnden Arbeitern und Unternehmern erzogen werden. Volere è potere heißt ein volkspädagogischer Band des Zoologen und Senators Michele Lessona, „Wollen heißt können“ – eine Sammlung berühmter Italiener, an denen ihre Nachfahren und Landsleute sich ein Beispiel nehmen mögen. An die Kinder wandte sich mit diesem Anlegen Carlo Lorenzini alias Carlo Collodi mit seinem Roman Le avventure di Pinocchio, zunächst ab 1881 als Fortsetzungsgeschichte erschienen. Der gleichnamige Held: ein aus Holz geschnitzter junger Schelm mit langer Nase, stürmisch, unbedacht und im Zweifel träge, aus dem erst nach und nach ein verantwortungsbewusster Mensch wird. Verhält er sich unangemessen, wächst seine ohnehin schon lange Nase – ein probates Mittel, die Spielregeln der Zivilisation zu übernehmen. Klar ist, es kostet Mühe, Trägheit zu überwinden und sich angemessen zu verhalten – es führt aber kein Weg daran vorbei. „Ob der Mensch nun reich oder arm geboren wird, immer hat er die Pflicht, etwas zu tun, sich zu beschäftigen, zu arbeiten. Wehe dem Müßiggänger. Müßiggang ist eine hässliche Krankheit, die man schon bei Kindern heilen muss, denn wenn sie dann groß sind, heilt sie nicht mehr.“56
Zugleich müssen die Italiener ein Weiteres lernen, nämlich sich quer über das gesamte Land zu verständigen. Bislang hatten sie überwiegend oder ausschließlich in ihren Dialekten gesprochen – eine lebende Nationalsprache gab es nicht. Diese musste erst geschaffen werden. Nach einer Intervention des Linguisten Graziado Isaia Ascoli setzte sich die seit der Renaissance gepflegte Literatursprache als neues Referenzmodell durch. Deren Basis wiederum war das Toskanische, angereichert um zahllose Begriffe und Wendungen, die die Dichter des vergangenen halben Jahrtausends in sie hineingetragen hatten. Dieser Korpus, fand Ascoli, war hinreichend groß, um nicht nur eine Verständigung der Italiener untereinander zu ermöglichen, sondern das Königreich auch an die Entwicklungen der Moderne anzuschließen.
Um der neuen Sprache eine möglichst breite Grundlage zu verschaffen, sind auch die Schriftsteller gefordert. Ihre Bücher sollen helfen, den Italienern den Abschied vom Analphabetismus zu erleichtern, sie mit der gesprochenen und mehr noch der Schriftsprache vertraut zu machen. Ihre Arbeit ist ausdrücklich gefragt. An den staatlichen Einrichtungen – allen voran den Universitäten – finden Dichter und Autoren Möglichkeiten, ihre Karriere auf ein – halbwegs – solides ökonomisches Fundament zu stellen. Zugleich öffnen sich ihnen die in jenen Jahren entstehenden Zeitungs- und Buchverlage. In Zeiten, in denen die Italiener über immer größere Räume miteinander zu kommunizieren beginnen, gehören Zeitungen und Bücher zu den grundlegenden Kommunikationsmitteln. Über sie laufen die Nachrichten und Debatten, die das Land zu führen beginnt. Natürliche Anlaufstellen für die Schriftsteller sind zunächst die literarischen Zeitungen und Zeitschriften: die Nuova Antologia, gegründet 1866, La Farfalla (1873), die Cronaca bizantina (1881) oder La Folla (1901).
Die Tageszeitungen – die bereits 1848 gegründete Gazzetta del Popolo, La Stampa (1867) oder der Corriere della Sera (1876) – visieren eine erheblich größere Leserschaft an. Noch kennen die Verleger den Geschmack ihres Publikums allenfalls ansatzweise, entsprechend groß sind die Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen – die Märkte wollen erkundet und verstanden sein. Die Redaktionsleitungen müssen sich mit Geschmack und Interessen ihrer Leser vertraut machen und diese dann bedienen. Das bedeutet etwa, Ereignisse so zu präsentieren, dass sie ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit erregen. Zugleich müssen die neuen Blätter sich kurz fassen. Denn noch haben die Leser nicht allzu viel Geduld für gedruckte Texte, noch haben sich die Zeitungen als selbstverständlich genutzte Medien nicht durchgesetzt. Entsprechend sparsam geht es zu: Das Standardmodell einer Zeitung besteht in jener Zeit aus gerade einmal vier Seiten, von denen jede in fünf Spalten gegliedert ist. Dies hält zum einen die Kosten in überschaubaren Grenzen (vier Seiten sind leichter gefüllt als acht oder gar zwölf), zum anderen entspricht es der wenig ausgeprägten Neigung oder gar dem Widerwillen des Publikums, für eine Zeitung Geld auszugeben.57 Dazu müssen die Herausgeber die Leser in den kommenden Jahren erst noch erziehen.
Freilich sind auch die Medien selbst von Anfang an ein schillerndes Gewerbe: „voller Theaterdonner, Erfolgen und Misserfolgen, Überraschungen und Skandalen, kurzzeitigen Projekten, Allianzen zwischen verschiedenen Gruppen und wütenden Trennungen“, kurzum, all den Klatschgeschichten, die zum Leben eben auch gehören und die bis heute nichts an Attraktivität verloren haben.58 Immerhin sind es diese Geschichten, ob sie nun aus der Welt der Medien oder anderen Bereichen moderner Gesellschaften kommen, die nach und nach eine Massenkultur erzeugen, Themen auf eine nationale Ebene heben und so die Italiener – alle Italiener – zum Gespräch mit und über sich selbst bringen. Ganz wesentlich über die Medien beginnen die Bürger des jungen Königreichs sich als Angehörige einer Nation zu erkennen.
Von Anfang an trägt auch die Kultur zu dieser Bewusstwerdung bei. Sie präsentiert sich spielerisch, ist mehr Unterhaltung als Analyse, bietet leichten, nicht allzu fordernden Stoff, umschmeichelt den Leser – und ganz wesentlich auch die Leserin –, führt ihn oder sie an die schönen Seiten des Lebens. Der Corriere della Sera etwa unternimmt dies – sehr erfolgreich – mit einem Appendice, einer täglichen Rubrik, die Fortsetzungsromane, Sittenbilder aus dem alltäglichen Leben, Theaterrezensionen oder sonstige kulturelle Themen präsentiert. Der Appendice erschien entweder im unteren Bereich der ersten oder der zweiten Seite und lief dort über sämtliche fünf Spalten, deutlich abgetrennt vom Hauptteil – das Feuilleton führte so auch graphisch eine eigenständige Existenz.59
Als D’Annunzio in Rom eintrifft, hat der Dichter Edoardo Scarfoglio gerade die Leitung der im Vorjahr gegründeten Zeitung Il Capitan Fracassa übernommen, benannt nach einem Roman des französischen Dichters Théophile Gautier. Das Buch des Franzosen gehört zur Gattung des Mantel-und-Degen-Romans, den damals kursierenden Abenteuergeschichten, konzentriert um einen oder mehrere Helden im Kampf gegen das Elend der Welt. Der Titel der Zeitung deutet es an: Auch sie muss sich um ihre Leser bemühen, ihnen neben Informationen auch einen ordentlichen Schuss abenteuerlicher Unterhaltung bieten.
Der junge D’Annunzio, bemerkt Scarfoglio, ist genau der Typus Journalist, den die Zeitung braucht. Der junge Dichter, erinnert sich der Herausgeber später, kam „im schönen und frischen Reichtum seiner Jugend sowie mit einem ganzen Stapel Poesie und poetischer Prosa nach Rom“.60 Bald schon habe D’Annunzio ihm, Scarfoglio, einen Besuch in der Redaktion abgestattet. „Ich lag ausgestreckt auf einer Bank in den Redaktionsräumen des Capitan Fracassa und gähnte inmitten der belanglosen Unterhaltungen der Anwesenden. Doch beim ersten Anblick dieses kleingewachsenen jungen Mannes mit seinem lockigen Kopf und den sanft femininen Augen, der mich mit einer weiblichen Stimme ansprach und sich selbst vorstellte, war ich wie erschüttert. Mit einem Ruck sprang ich auf. Eine ähnliche Wirkung rief er auch bei anderen hervor. Wir gingen zusammen in den Salon, und alle in der Redaktion umringten ihn. Niemals erhielt ein Schriftsteller in diesen Räumen, wo Bewunderung und Neugier auf alles Neue so leicht zu wecken sind, einen derart festlichen Empfang.“
Der junge D’Annunzio wird einer der produktivsten Autoren der Zeitung. Bald wird er auch für mehrere andere der gerade entstehenden Blätter schreiben: Cronaca bizantina, Tribuna, Il Fanfulla oder Il Fanfulla della Domenica. Zunächst zeigt sich der junge Mann gelangweilt von seinem neuen Beruf. Er habe sich „in die mageren Arme des Journalismus“ begeben und sei damit dazu verurteilt, sich einer „elenden täglichen Mühe“ zu unterziehen, notiert er.61 Er braucht indessen nicht lange, um dieser Mühe einen gewissen Glanz zu verschaffen, sie in etwas Höheres – fast schon in Kunst – zu verwandeln. Die vielen Pseudonyme, unter denen er bald auftritt – er firmiert, unter anderem, als Duca Minimo, Sir Charles Vere de Vere, Bull Calf, Happemouche, Shiun-Sui-Katki-Kava –, lassen den spielerischen Charakter erkennen, mit dem er seine Zeitungstexte angeht. Ohnehin sind seine Texte keine Chroniken im traditionellen Sinn. Sie beschränken sich nicht darauf, die Wirklichkeit möglichst detailgetreu wiederzugeben. Stattdessen gewinnt er ihr einen künstlerischen Mehrwert ab, schildert die Vorkommnisse unter ungewohnten, aufregenden Aspekten. Der römische Alltag, gibt er seinen Lesern zu verstehen, ist bunt, er lässt sich aus den unterschiedlichsten Perspektiven vermessen, in den unterschiedlichsten Farben, Temperaturen beschreiben. Selbst das banalste Thema lässt sich in Kunst verwandeln. Das ist das D’Annunzio’sche Credo. Darunter tut es der Dichter-Journalist nicht.
Und doch ist Kunst nicht alles. Um zu wirken, um wahrhaft groß zu sein, muss sie ein Weiteres: Sie muss die Gedanken und Empfindungen ihrer Zeit erfassen, ihr Schöpfer muss mit der Welt verbunden sein, ihre Energien atmen und aus ihnen etwas machen. D’Annunzio ist genauso wenig naiver Journalist wie selbstgenügsamer Künstler. Keiner seiner Texte, auch die journalistischen nicht, ist unschuldig. Alles, was er schreibt, ist auf Wirkung aus, will etwas anstoßen – nicht zuletzt die eigene Karriere. Wer es mit Texten zu etwas bringen will, notiert er, muss sich an die Masse richten, muss erfassen, was sie bewegt, muss ihre Sehnsüchte, Aspirationen, Träume kennen. „Wenn der moderne Künstler der große Interpret und Botschafter seiner Zeit werden will, steht es ihm an, sich Zug um Zug in den Strom des Lebens zu begeben und die eigene mit der kollektiven Psyche zu verbinden, um die dunklen, aber unaufhörlichen, unaufhaltbaren Strömungen zu spüren.“62